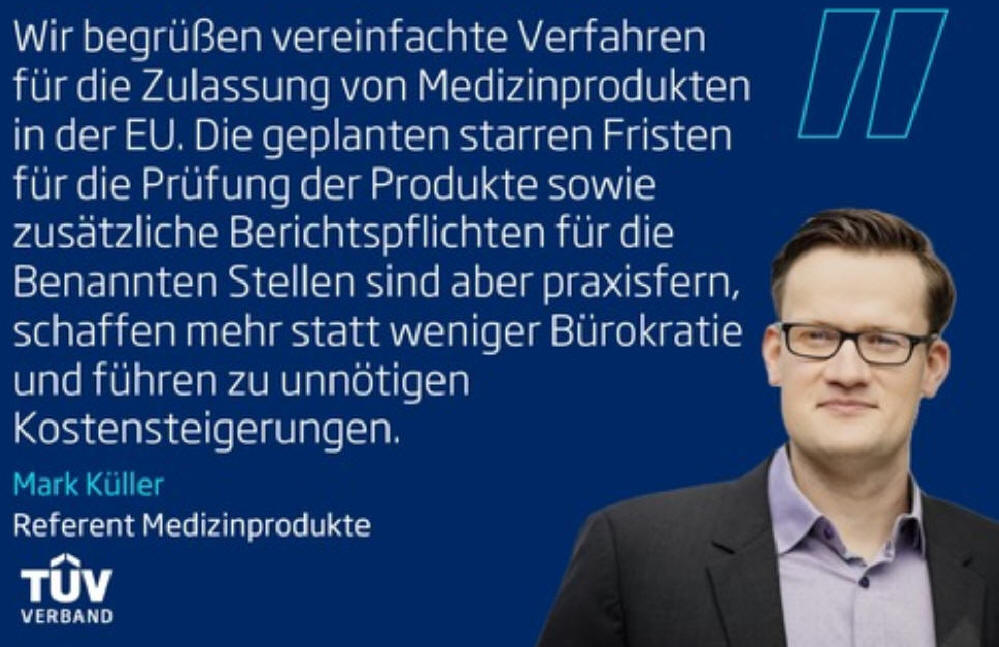|
|
|
|
KVNO startet Kampagne für mehr Ärzte-Nachwuchs |
|
„Deine Praxis.
Dein Freiraum.“
· Kampagnenstart Anfang 2026
·
Werbung für Tätigkeit in eigener Praxis
· Regionale
Kampagnenmotive fördern gezielte Ansprache
Düsseldorf/Duisburg, 29. Januar 2026 – „Die Kassenärztliche
Vereinigung Nordrhein (KVNO) engagiert sich mit Nachdruck für
eine verlässliche, wohnortnahe und zukunftsfeste ambulante
Versorgung im Rheinland. Und erweitert Ihr Maßnahmenpaket nun
um einen zusätzlichen und besonderen Baustein: Mit der neuen
Nachwuchskampagne „Deine Praxis. Dein Freiraum.“ wirbt die KV
gezielt um junge Ärztinnen und Ärzte, die die ambulante
Versorgung im Landesteil langfristig sichern und spürbar
verbessern sollen.

„Unser Ziel ist es, die ambulante Versorgung im Nordrhein
für die Menschen hier vor Ort bestmöglich zu sichern“, sagt
Dr. med Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KVNO. „Wir
können zwar die politischen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen nur bedingt beeinflussen, aber wir können
versuchen, junge Menschen für eine Niederlassung zu gewinnen
und den Ärztinnen und Ärzten in Nordrhein eine bestmögliche
Hilfestellung zu bieten. Sowohl über finanzielle Förderung
als auch persönliche Unterstützung. Dafür setzen wir uns
jedes Jahr aufs Neue ein!“ betont Dr. Bergmann. „Genau darum
geht es auch bei dieser Kampagne.“

Beispielhafte Sichtbarkeit der KVNO-Kampagne im Laufe der
kommenden Monate. Eines der auffälligen Kampagnen-Plakate.
Motiv erstellt mit adobe stock by LIGHTFIELD STUDIOS,
AntonioDiaz, opolja, StudioLaMagica, peopleimages.com,
PeopleVideos, deagreez bearbeitet mit Midjourney und Magnific
Ai.
Kampagne als wichtige Erweiterung bestehender
Maßnahmen zu passendem Zeitpunkt Die Kampagne sei eine
wichtige Erweiterung der zahlreichen Maßnahmen zur Sicherung
der ambulanten Zukunft Nordrheins, so der KVNO-Vorstand. Sie
startet dabei zu einem passenden Zeitpunkt: Viele Praxen
suchen in den kommenden Jahren eine Nachfolge. Die KV wirbt
deshalb gezielt um Nachwuchs und begleitet zusätzlich den
Praxisstart eng – damit Übergaben gelingen und die Versorgung
vor Ort gesichert bleibt.
Dr. Bergmann erklärt die
Bedeutung einer Niederlassung: „Wer eine eigene Praxis
übernimmt oder gründet, schafft kontinuierliche
Ansprechbarkeit, kurze Wege und persönliche Betreuung –
entscheidend für Prävention, Früherkennung und eine
verlässliche Behandlung im Alltag.“ Die Nachwuchskampagne der
KVNO macht jungen Ärztinnen und Ärzten deshalb gezielt die
Vorteile der ambulanten Praxisarbeit sichtbar:
selbstbestimmtes Arbeiten, Verantwortung für den eigenen
Patientenkreis und Flexibilität, die eine kontinuierliche
Versorgung ermöglicht.
Kampagne mit zwei Säulen:
Information und Unterstützung
Crossmedial und regional
ausgesteuert, führt die Kampagne Interessierte auf die
Anlaufstelle dein-praxisstart.de – mit kompakten
Informationen und einem digitalen Selbsttest zur eigenen
Eignung für die Praxis. Authentische Testimonials und
regionale Bezüge sorgen für Nähe und Glaubwürdigkeit. Die
Nachwuchskampagne der KVNO wird das gesamte Jahr 2026 im
Rheinland präsent sein und durchgängig für eine hohe
Sichtbarkeit des Themas Niederlassung sorgen.
Gleichzeitig bietet die KVNO konkrete Unterstützung für
angehende Praxisinhaberinnen und -inhaber – mit direktem
Effekt auf die Versorgung: persönliche Beratung von der
ersten Idee bis zur Eröffnung, Orientierung zu
Niederlassungswegen, Finanzierung, Standortwahl und
Teamaufbau sowie – wo nötig – finanzielle Förderung über den
Strukturfonds. Dieses Serviceversprechen reduziert
Anlaufzeiten, erleichtert Praxisübergaben und stabilisiert
bestehende Standorte, damit Patientinnen und Patienten
verlässlich versorgt werden.
„Das Jahr 2026 steht bei
uns im Fokus der Nachwuchsgewinnung“, sagt Dr. Bergmann. „Wir
möchten in diesem Jahr möglichst viele, neue Ärztinnen und
Ärzte für eine Niederlassung gewinnen. Davon profitieren
letztlich alle, nicht nur die Patienten. Unsere Testimonials
in der Kampagne bestätigen es: Arzt sein in einer eigenen
Praxis ist einer der schönsten Berufe, die es gibt!“
|
|
TÜV-Verband kritisiert starre
Fristen für die Prüfung von Medizinprodukten
|
|
Vorschläge der
EU-Kommission für eine Überarbeitung der
Medizinprodukte-Verordnung schießen zum Teil über das Ziel
hinaus. Starre Verfahren schaffen mehr Bürokratie, erhöhen
die Hürden für den Marktzugang und können zu mehr
scheiternden Prüfungen führen. Die Folge wären Mehrkosten für
die Hersteller und das gesamte Gesundheitssystem.
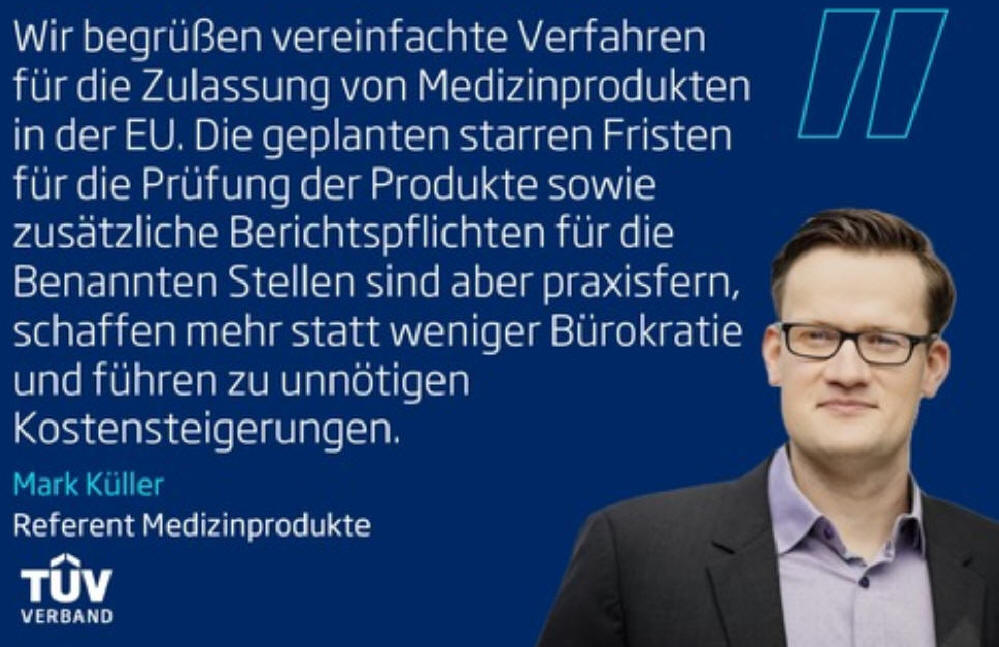
(C)Tobias Koch
Berlin, 28. Januar 2026 – Die
EU-Kommission hat am 16. Dezember 2025 Vorschläge für eine
umfangreiche Überarbeitung der Medical Device Regulation
(MDR) und der In-vitro Diagnostic Regulation (IVDR)
vorgelegt. Ziel ist es, die erst seit dem Jahr 2017 gültigen
und seitdem bereits mehrfach überarbeiteten Regelungen für
den Marktzugang von Medizinprodukten in der Europäischen
Union zu vereinfachen und die Zulassungsverfahren zu
beschleunigen.
Wesentlicher Bestandteil des geplanten
Rechtsakts sind konkrete zeitliche Vorgaben für die Prüfung
von Medizinprodukten durch die Benannten Stellen sowie
zusätzliche Berichtspflichten. Benannte Stellen sind
staatlich autorisierte, unabhängige Organisation, die von
einer nationalen Behörde benannt und überwacht werden, um
Prüfungen bei Medizinprodukten durchzuführen, bevor diese auf
den europäischen Markt gebracht werden dürfen.
„Der
TÜV-Verband begrüßt grundsätzlich alle Bestrebungen, die
Anforderungen an die Prüfung von Medizinprodukten und die
Arbeit der Benannten Stellen in Europa zu harmonisieren und
die Verfahren zu vereinfachen, warnt aber davor, über das
Ziel hinauszuschießen und damit sogar gegenteilige Effekte zu
erzielen“, sagt Mark Küller, Referent für Medizinprodukte
beim TÜV-Verband. „Starre Fristen für die Prüfung von
Medizinprodukten sind praxisfern, schaffen mehr statt weniger
Bürokratie und können zu unnötigen Kostensteigerungen
führen.“
Zeitliche Vorgaben für Prüfungen praxisfern
und kostensteigernd
Bisher gibt es keine zeitlichen
Vorgaben, wie lange ein Prüfverfahren bei Medizinprodukten
dauern muss. Die Länge variiert aufgrund einer Vielzahl von
Faktoren wie zum Beispiel der Komplexität des Produkts,
seines Risikopotentials und der Qualität der Vorbereitung des
Herstellers auf die Prüfung. Der Vorschlag für einen
Rechtsakt sieht nun jedoch die Festlegung fester Fristen für
die unterschiedlichen Schritte bei der Prüfung von Produkten
vor.
„Die Fristen wurden pauschal festgelegt.
Entscheidende Faktoren wie die Größe eines Herstellers, die
Anzahl an Produkten des Herstellers, die Komplexität der
Produkte oder die mit den Produkten verbundenen Risiken für
Anwender:innen und Patient:innen sind nicht berücksichtigt
worden“, sagt Küller. Diese und weitere Faktoren bestimmen
aber den Umfang der zu erfüllenden gesetzlichen Anforderungen
und damit den Prüfumfang der Benannten Stellen.
Es
gelten somit die gleichen Fristen für einen kleinen
Hersteller eines einzelnen Produkts mit geringem Risiko für
Patienten, wie auch für einen international tätigen großen
Hersteller mit einer Vielzahl von Produkten mit einem hohen
Risiko für Patienten. „Sind die Verfahren nach Ablauf der
Fristen nicht abgeschlossen, scheitern die Prüfungen“, sagt
Küller.
Die Verfahren müssten dann komplett neu
gestartet werden, ohne die Möglichkeit, sich einvernehmlich
auf die Verlängerung einer Frist zu einigen. Der Marktzugang
der Produkte würde sich verzögern. Küller: „Die Vielzahl
unterschiedlicher Fristen und Bedingungen führt zu deutlich
komplexeren und bürokratischeren Prüfverfahren und somit
höheren Kosten für die Hersteller. Sie machen Produkte teurer
und belasten am Ende das Gesundheitssystem.“
Mehr
Bürokratie ohne Mehrwert
Darüber hinaus werden zusätzliche
Berichtspflichten für die Benannten Stellen geschaffen. So
sollen zum Beispiel Daten zur minimalen, durchschnittlichen
und maximalen Dauer von Prüfverfahren sowie den mit ihnen
verbundenen Kosten veröffentlicht werden. Da Prüfungen sehr
individuell sind und von einer Vielzahl von Faktoren wie der
Vorbereitung des Herstellers, der Anzahl und der Komplexität
der Produkte und des mit den Produkten verbundenen Risikos
abhängen, haben solche Daten nur eine geringe Aussagekraft.
„Hersteller können die Preise von Benannten Stellen
am besten vergleichen, indem sie sich individuelle Angebote
einholen und nicht, indem sie auf aggregierte und im
Einzelfall nicht aussagekräftige Daten zugreifen, sagt
Küller. Die Prüfung und der Vergleich solcher Kosten- und
Zeitstrukturen mit Blick auf wettbewerbliche und
wirtschaftliche Anforderungen könne Teil der behördlichen
Überwachung sein. „In der vorgeschlagenen Form entsteht vor
allem zusätzliche Bürokratie, die Prüfungen teurer macht und
keinen Mehrwert schafft“, sagt Küller. „In der Folge führen
die Vorgaben zu zusätzlichen Belastungen für das
Gesundheitssystem.“
Unabhängigkeit der
Produktprüfungen gefährdet
Benannte Stellen arbeiten in
Vertretung für den Staat und werden dabei streng behördlich
überwacht – dies jedoch in einer effizienten
privatwirtschaftlichen Struktur. Sie müssen dabei frei von
jeglichem Druck insbesondere finanzieller Art sein, der ihr
Urteil oder die Ergebnisse ihrer Prüfungen beeinflussen
könnten. Ihr oberstes Ziel ist die Produktsicherheit und
damit die Sicherheit von Anwender:innen und Patient:innen.
Durch die von der Europäischen Kommission vorgesehenen
Berichts- und Prüfvorgaben wird dieses grundlegende Prinzip
jedoch in Frage gestellt, da über nicht aussagekräftige
Kennzahlen Aussagen zur Leistungsfähigkeit, Arbeitsweise und
den Kosten einer Benannten Stelle erzeugt werden sollen.
Der TÜV-Verband ruft die Kommission daher dazu auf, die
Vorgaben im Sinne der Patientensicherheit, aber auch der
Effizienzsteigerung und Entbürokratisierung, zu überarbeiten,
und hat dafür konkrete Vorschläge erarbeitet.
Ein
ausführliche Stellungnahme des TÜV-Verbands und der
Interessengemeinschaft der Benannten Stellen für
Medizinprodukte in Deutschland (IGNB) ist abrufbar unter:
https://www.tuev-verband.de/fileadmin/user_upload/ig-nb/2026_TUV_Association_and_IG-NB_Position_COM_Implementing_Regulation_on_Notified_Body_Requirements.pdf
|
|
„Streit um telefonische Arbeitsunfähigkeit ist
Phantom-Diskussion“ |
|
Statement des Vorstandsvorsitzenden der
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Dr. med. Frank Bergmann, zur
aktuellen Diskussion um angeblich hohe Krankenstände im Land im
Zusammenhang mit der telefonischen Krankschreibung (Telefon-AU).
Düsseldorf/Köln/Duisburg, 22. Januar 2026 – „Der Streit um die
telefonische Arbeitsunfähigkeit ist eine Phantom-Diskussion! Die
beklagten Probleme des vergleichsweise hohen Krankenstandes in
Deutschland sind nicht durch die telefonische Arbeitsunfähigkeit
bedingt. Die telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist für
die Praxen im Land ein funktionierendes Instrument für persönlich
bekannte Patientinnen und Patienten sowie chronisch Erkrankte.

Dr.
med. Frank Bergmann, KVNO-Vorstandsvorsitzender, Quelle: KVNO
Die Regeln, ob und wann eine Krankschreibung telefonisch
erfolgen kann und darf, sind nach der Corona-Pandemie zu Recht
verschärft worden: Eine Telefon-AU ist nur zulässig, wenn die Praxis
die Patientin oder den Patienten kennt und selbst keine
Videosprechstunde anbietet.
Auch daher ist der Anteil telefonischer AUs im Verhältnis zur
Gesamtzahl an Krank-schreibungen faktisch gering: Laut Daten
des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung aus
dem Herbst letzten Jahres machten telefonische
Krankschreibungen zuletzt lediglich 0,9 Prozent aller
entsprechenden Fälle bundesweit aus – die hohen Krankenstände
im Land entstehen sicher nicht aus diesem Verfahren, sondern
haben andere Ursachen.
Zudem ist die AU kein
medizinisches Heilmittel, sondern ein arbeitsrechtlicher
Nachweis. Zur Senkung der Krankenstände, braucht es
Strukturreformen statt Symboldebatten – etwa Karenzregelungen
oder alternative Nachweismodelle. Ein Ende der Telefon-AU
würde im Ergebnis am Krankenstand nichts ändern, wohl aber
die Praxen künftig wieder mehr-belasten.“
|
|
Aktuelle Erkältungswelle in NRW
|
|
Ärztliche
Hilfe auch per Videosprechstunde möglich
· Online oder per Telefon: passende Hilfe per 116 117
·
Videosprechstunden speziell für Kinder und Erwachsene
Düsseldorf, 16.01.2026 – Die Grippe- und Erkältungssaison
im Land ist in vollem Gange. Entsprechend hoch ist derzeit
die Auslastung von Haus- und Kinderarztpraxen sowie des
ambulanten Notdienstes. Vor allem von der Influenza sind laut
Robert-Koch-Institut (RKI) momentan nahezu alle Altersgruppen
betroffen. Ebenso sind RSV- und Corona-Erkrankungen zunehmend
verbreitet.
Empfehlung: bei Symptomen besser
auskurieren
„Die Lage in den Praxen ist insgesamt zwar
noch nicht besorgniserregend, dennoch sollten wir mit Blick
auf die nahenden Tage des Straßenkarnevals achtsam sein. Das
heißt: Wer Symptome verspürt, an Fieber, Husten und Schmerzen
leidet, bleibt am besten zu Hause und kuriert sich in Ruhe
aus.
Ebenso helfen Hygienemaßnahmen wie das Einhalten
der Husten- und Niesetikette, regelmäßiges Händewaschen oder
Abstandhalten. Vulnerable Gruppen sollten in diesen Tagen
besonders auf sich achten, damit sie unbeschadet durch die
Winterzeit kommen“, sagt der Vorstandsvorsitzende der
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO), Dr. med. Frank
Bergmann.
Ärztlicher Rat, ohne das Haus zu verlassen:
Videosprechstunde
Und wenn es doch ärztlicher Rat gefragt
ist? „Außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten der Haus-
und Fachärzte, vor allem am Wochenende oder an Feiertagen,
hilft Erkrankten in Nordrhein der ärztliche
Bereitschaftsdienst“, sagt Dr. Bergmann. „Und das
verlässlich, niedrigschwellig und ohne Umwege über die
Klinik.“
Erste Anlaufstelle ist die kostenlose
Servicenummer 116 117. Sie ist rund um die Uhr erreichbar und
führt Patientinnen und Patienten nach einer strukturierten
Ersteinschätzung direkt zum passenden Angebot: entweder in
eine der rund 90 Notdienstpraxen der KVNO oder – wenn nötig –
vermittelt sie einen ärztlicher Hausbesuch bei immobilen
Personen. Die dritte Möglichkeit verspricht ebenfalls Hilfe
ohne das Haus zu verlassen: eine Videosprechstunde – für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Videosprechstunden im ambulanten Bereitschaftsdienst
Die
Videosprechstunden der KVNO machen medizinische Hilfe
besonders schnell und unkompliziert: Kinder, Jugendliche und
Erwachsene können Beschwerden per Video-Gespräch mit einem
Arzt/einer Ärztin zunächst abklären, geeignete
Behandlungsschritte besprechen und bei Bedarf ein eRezept
erhalten – häufig erübrigt sich danach der Besuch in der
Praxis. Der Zugang läuft über die Rufnummer 116 117 oder
direkt über die Seiten www.kvno.de/kinder bzw.
www.kvno.de/erwachsene
Nach der Anmeldung kommt der
Terminlink per E‑Mail. Notwendig sind nur die
Versichertendaten, eine stabile Internetverbindung sowie
Smartphone, Tablet oder Computer mit Kamera und Mikrofon –
idealerweise in ruhiger Umgebung.
Die kinderärztliche
Videosprechstunde ist samstags, sonntags und feiertags von 10
bis 22 Uhr verfügbar, das Angebot für Erwachsene samstags,
sonntags und feiertags von 9 bis 21 Uhr.
Ärztliche
Hausbesuche vor allem für Bettlägerige möglich
Für nicht
mobile Patientinnen und Patienten organisiert die 116 117
einen ärztlichen Hausbesuch. Auf Wunsch informiert der
Service über die Erreichbarkeit fachärztlicher Notdienste im
Landesteil, etwa Augenheilkunde, HNO und Kinder.
Adressen und Öffnungszeiten der Notdienstpraxen in Nordrhein
stehen online unter www.kvno.de/notdienst

Foto „KVNO“
|
|
Dringender Appell zur Blutspende: Blut wird JETZT
benötigt!
|
|
Duisburg, 13. Januar 2026 - In den
vergangenen Wochen mussten zahlreiche Blutspendetermine
witterungsbedingt kurzfristig abgesagt werden. Viele der
dennoch durchgeführten Termine waren deutlich schwächer
besucht als üblich. Gleichzeitig führt die anhaltende Grippe-
und Erkältungswelle dazu, dass viele potenzielle Spenderinnen
und Spender vorübergehend nicht spenden können.
Bereits zu Jahresbeginn ist das Spendenaufkommen deshalb, und
wegen der Feiertage, unter dem notwendigen Niveau geblieben.
Die Auswirkungen sind deutlich spürbar: Die Vorräte sinken,
die Lagerreichweite beträgt aktuell nur noch rund 1,5 Tage.
Der DRK-Blutspendedienst West ruft die Bevölkerung
eindringlich zur Blutspende in NRW, Rheinland-Pfalz und im
Saarland auf. Die Versorgung mit Blutpräparaten ist aktuell
angespannt und droht sich weiter zu verschärfen.
Winterwetter, eine ausgeprägte Infektwelle und ein schwacher
Start ins Spendenjahr treffen auf einen unverändert hohen
Bedarf in den Kliniken.
Blutpräparate sind nur
begrenzt haltbar und können nicht auf Vorrat produziert
werden. Schon wenige Tage mit zu wenigen Spenden wirken sich
unmittelbar auf die Patientenversorgung aus. „Die Situation
ist ernst. Krankenhäuser benötigen täglich Blut für
Operationen, Notfälle, Krebstherapien und die Behandlung
chronisch kranker Menschen. Diese Versorgung darf nicht ins
Wanken geraten“, erklärt Stephan David Küpper, Pressesprecher
des DRK-Blutspendedienstes.
„Blutspenden lassen sich
nicht aufschieben – was heute nicht gespendet wird, fehlt
morgen in den Kliniken“, so Küpper weiter. Der
DRK-Blutspendedienst geht verantwortungsvoll mit den knappen
Beständen um. Eine nachhaltige Stabilisierung der Versorgung
ist jedoch nur möglich, wenn kurzfristig deutlich mehr
Menschen Blut spenden.
Das DRK appelliert daher an
alle gesunden und spendefähigen Bürgerinnen und Bürger, jetzt
Verantwortung zu übernehmen und zeitnah einen Termin zur
Blutspende wahrzunehmen. Bereits wenige Tage mit hoher
Spendenbereitschaft können entscheidend dazu beitragen, die
Lage zu entspannen.
Aktuelle Termine und
Informationen zur Blutspende finden sich unter:
www.blutspende.jetzt
Wer unsicher ist, ob eine Blutspende – zum Beispiel wegen der
Einnahme bestimmter Medikamente – möglich ist, kann sich
kostenfrei bei der Hotline des DRK-Blutspendedienstes unter
0800 11 949 11 beraten lassen. Alternativ steht unter
www.blutspende.jetzt ein praktischer Online-Check zur
Verfügung.
Warum ist die Blutspende beim DRK so
wichtig? Der DRK-Blutspendedienst West gewährleistet eine
sichere medizinische Grundversorgung für mehr als 23
Millionen Menschen in seinem Einzugsgebiet. Insgesamt stellt
das DRK 78 Prozent des gesamten Blutbedarfs bereit.

Blutspenden werden dringend benötigt
Blutspende-Termin reservieren und Leben retten Um Wartezeiten
zu vermeiden und die Abläufe optimal zu gestalten, bittet das
Rote Kreuz darum, sich vorab unter
www.blutspende.jetzt oder über die Hotline einen Termin
zu reservieren. Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren, der
sich gesund fühlt. Eine obere Altersgrenze gibt es nicht
mehr.
Zum Termin bitte den Personalausweis oder
Führerschein mitbringen. Die eigentliche Blutspende dauert
nur etwa fünf bis zehn Minuten – und kann bis zu drei
Schwerkranken oder Verletzten helfen.
|
|
KVNO stellt ambulanten Fahrdienst neu auf
|
|
Fahrdienst ab
sofort mit vielen Vorteilen
· Pilotstart ab
Januar 2026 im Raum Düsseldorf/Neuss
· Nordrheinweiter
Rollout ab April
· Entlastungen für die Ärzteschaft:
Weniger Aufwand,mehr Fokus auf die Patienten, gerechte
Kosten, bessere Steuerung, schnellere Abrechnung
· Vorteil
für die Patienten: eine nachhaltig gesicherte Versorgung mit
mehr Qualität
Düsseldorf, 6. Januar 2026 – Die
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) treibt die
Modernisierung des ambulanten Notdienstes weiter voran: Ab
sofort übernehmen Kooperationsärztinnen und -ärzte
medizinisch notwendige Hausbesuche. Sie übernehmen in den
Abend- und Nachstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen
den ambulanten Fahrdienst – und dies zentral von der KVNO
geplant, flexibel besetzt und digital unterstützt.
Die bislang für Haus- und Fachärzte in Nordrhein bestehende
Pflicht, auch im Rahmen des allgemeinen Notdienstes – je nach
Dienstplan – Hausbesuche zu übernehmen, ist zum Jahresstart
2026 ruhend gestellt worden. „Ein klarer Schnitt mit
spürbarer Entlastung für die Niedergelassenen in ganz
Nordrhein“, sagt KVNO-Vorstandsvorsitzender Dr. med. Frank
Bergmann.
Start in Modellregion Düsseldorf/Neuss
Ein Pilot ist am 1. Januar 2026 in Düsseldorf und Neuss
gestartet. Mit den gesammelten Erfahrungen beginnt dann ab
April 2026 der Rollout in ganz Nordrhein. Kernelemente sind
eine zentrale Planung der Fahrdienste durch die KVNO,
optimierte Neu-Zuschnitte der Fahrdienstbezirke und digitale
Prozess-Unterstützung zur Steigerung von Effizienz und
Qualität.
Rahmenbedingungen für Niederlassung
verbessern
„Die Reform des Fahrdienstes ist für uns der
Startpunkt einer zukunftsfähigen und sicheren Gestaltung des
ambulanten Notdienstes“, beschreibt Dr. Bergmann die
Bedeutung der Fahrdienstreform.
„Wir entlasten die
Praxen von zusätzlichen Diensten und Zeitaufwänden - gerade
an Wochenenden. Damit steigern wir die Attraktivität einer
ambulanten Tätigkeit. Denn gerade die Dienstbelastungen im
Notdienst schrecken viele junge Kolleginnen und Kollegen von
einer Niederlassung ab“.
Künftig werden Haus- und
Fachärzte damit grundsätzlich regulär „nur“ noch für Dienste
in einer der gut 90 KVNO-Notdienstpraxen berücksichtigt,
diese Pflicht bleibt weiterhin bestehen. „Damit schaffen wir
eine sofort spürbare Entlastung für die Niedergelassenen –
sowohl finanziell als auch bei den Arbeitsstunden“, so Dr.
Bergmann. „Durch das Neukonzept entasten wir unsere
Kolleginnen und Kollegen um weit über 100.000 Dienststunden.
Jedes Jahr.“

Bildquelle: „KVNO“
Reform sorgt auch für eine bessere
Versorgung der Patienten
Gleichzeitig sorgt die Reform für
mehr Qualität in der Versorgung immobiler Patientinnen und
Patienten. Dr. Bergmann: „Mit unserer neuen Software nehmen
wir den Ärztinnen und Ärzten sehr viel Verwaltungsarbeit ab
und durch die zentrale Steuerung können wir schneller und
flexibler reagieren.“ Im besten Fall könne das auch die
Wartezeit für den nächsten Patienten verkürzen, so der
KVNO-Vorstand.
„Und durch die Kooperation mit einem
Dienstleister, der die Fahrzeuge und Fahrer stellt, kann sich
der Arzt voll auf die Vorbereitung und Nachbereitung des
Hausbesuches konzentrieren. Denn das ist, was für uns alle an
erster Stelle steht: eine bestmögliche und gesicherte
Versorgung der Menschen in Nordrhein.“ Bisher mussten viele
Haus- und Fachärzte für die Hausbesuche noch ihre eigenen
PKWs nutzen. Auch das fällt nun weg. Dazu kommt: Besonders zu
den Nachstunden ist die Begleitung durch einen Fahrer ein
Sicherheitsgewinn.
Großes Interesse und breite
Unterstützung in der Ärzteschaft
Die Aufgaben im
ärztlichen Fahrdienst in Nordrhein übernehmen ab sofort alle
Ärztinnen und Ärzte, die sich bewusst für den Dienst
entschieden und dazu eine Kooperationsvereinbarung mit der
KVNO abgeschlossen haben. Das Interesse ist groß.
Dr.
Bergmann: „Für eine sichere Umsetzung benötigen wir rund 500
Kooperationsärzte. Inzwischen können wir auf rund 800
interessierte Fachleute zählen.“ Man freue sich über den
großen Zuspruch. „Das zeigt, dass die KVNO mit dieser Reform
genau den richtigen Weg gegangen ist!“, so Dr. Bergmann.
Auch die Mitglieder der Vertreterversammlung im
vergangenen November unterstützen die Reform: Der
entsprechende Antrag des Vorstands zur Umsetzung des Konzepts
wurde mit großer Mehrheit von der VV beschlossen und erntete
viel Lob: Diese Reform zeige die Handlungsfähigkeit der KVNO
und sei ein großer Wurf.
Neue Struktur der
Fahrdienstbezirke Grundlage für bessere Steuerung
Auch
eine bessere Steuerung der Einsätze war im Blick der
Fahrdienst-Reform. Dr. Bergmann: „Wir hatten bislang 54 teils
völlig unterschiedliche Bezirke mit ebenso unterschiedlichen
Anforderungen. Mit dem neuen System, aufgeteilt in 20
Bereiche, können wir viel besser und bei Bedarf sogar
innerhalb einer Schicht auf steigende Bedarfe dynamisch
reagieren - etwa bei Brücken- oder Feiertagen.“
Die
„fahrenden“ Ärztinnen und Ärzte sind während ihrer Dienste
fortwährend mit der 116 117-Disposition der KVNO in Köln
verbunden. Ihre digital übermittelten Einsätze dokumentieren
sie auf Tablets, die die KVNO zur Verfügung stellt. Darüber
können sie online auch alle wichtigen bzw. relevanten Angaben
zum Erkrankten schon vor dem Eintreffen vor Ort erhalten.
Vorteile auch bei der Finanzierung: Neukonzept schafft
Kostentransparenz
Zur Finanzierung des Konzepts hat die
KVNO ab 2026 die solidarische Mitgliedsumlage neu
aufgestellt. Künftig beträgt diese transparent und
einheitlich 242 Euro pro Quartal - sowohl für die
Organisation der Sitzdienste als auch der neuen Fahrdienste.
Damit gehören die Beitragsunterschiede bei der bisherigen
Finanzierung der örtlichen Fahrdienste der Vergangenheit an.
Dr. Bergmann: „In einigen Kreisen lagen die Beiträge
der Ärzteschaft deutlich über diesem Wert. Das gehört nun
endlich auch der Vergangenheit an!“ Und: Die bisher zum
Notdienst verpflichteten Ärztinnen und Ärzte müssen künftig
keine eigenen Dienste mehr übernehmen und keine Vertretungen
suchen.
Fahrdienstmodell aus Köln als Vorbild
Einen
ersten Beweis für die Praxistauglichkeit des neuen
Fahrdienstkonzept gibt es bereits in der Stadt Köln. Das
Stadtgebiet wurde von der KVNO Anfang 2025 von fünf
kleinteiligen auf zwei Fahrdienstbereiche neu zugeschnitten.
Berücksichtigt wurden auch hier Arztdichte, räumliche Lage
und Einwohnerzahlen - im Ergebnis sind die Dienste seitdem
effizienter organisiert und gleichmäßig über die
Niedergelassenen in Köln verteilt.
Für den nun
anstehenden weiteren Rollout hat die KVNO die gewonnenen
Erkenntnisse zu Fallzahlen, Strecken und Einwohnerzahlen mit
wissenschaftlicher Unterstützung ausgewertet und für den
gesamten Landesteil simuliert.
Weitere Informationen
zum ambulanten Notdienst in Nordrhein gibt es unter
www.kvno.de/notdienst
|
|
Zum 1. Januar 2026: Neue
Krankenhausplanung für Nordrhein-Westfalen tritt vollständig
in Kraft
|
|
Minister
Laumann: Die neue Krankenhausplanung wirkt, sie stärkt die
Krankenhauslandschaft und die Behandlungsqualität
Düsseldorf, 29. Dezember 2025 - Mit dem Start des neuen
Jahres wird der nordrhein-westfälische Krankenhausplan, eines
der wichtigsten Projekte der Landesregierung, vollständig in
die Praxis umgesetzt und damit abgeschlossen: Nachdem am 1.
April 2025 der Großteil der Regelungen landesweit in Kraft
getreten ist, kommen am 1. Januar 2026 die Regelungen in den
verbleibenden zehn von insgesamt 64 Leistungsgruppen dazu.
Das bedeutet: Die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen können
Leistungen aus allen Leistungsgruppen mit dem neuen Jahr nur
noch anbieten, wenn diese ihnen in den
Feststellungsbescheiden zugewiesen worden sind.
Bei den verbleibenden zehn
Leistungsgruppen, die nun umgesetzt werden, handelt es sich
um Leistungsgruppen der Kardiologie (EPU / Ablation,
Interventionelle Kardiologie, Kardiale Devices), der
Notfallversorgung (Bauchaortenaneurysma, Carotis operativ/
interventionell, Stroke Unit), der Orthopädie (Endoprothetik
Hüfte, Endoprothetik Knie, Wirbelsäuleneingriffe) und um die
Leistungsgruppe „Bariatrische Chirurgie“. Für diese bestand
eine Übergangsfrist bis zum Ende des Jahres 2025, da die
erforderliche Anpassung von Kapazitäten in den Krankenhäusern
aufgrund der hohen Fallzahlen oder der besonderen
Notfallrelevanz zusätzlich Zeit in Anspruch genommen hat.
„Ende 2024 hat das Land die
Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen mit einem
vollkommen neuartigen Krankenhausplan neugestaltet und vor
allem auf eine solide und zukunftsfähige Basis gestellt. Was
unseren Plan so richtungsweisend macht ist, dass wir als
erstes Bundesland nicht auf Betten setzen, sondern auf Basis
des tatsächlichen Bedarfs, klaren Qualitätsstandards und
eindeutigen Erreichbarkeitsvorgaben planen. Ein Kerninhalt
des neuen Plans ist, dass er insbesondere bei hochkomplexen
Leistungen Behandlungsschwerpunkte in den verschiedenen
Krankenhäusern ausbaut.
Gleichzeitig baut er Doppel- und Mehrfachvorhaltungen der
gleichen Leistungen in benachbarten Einrichtungen ab. Neun
Monate nach dem Start der Umsetzung ist klar: Der neue
Krankenhausplan wirkt. Durch die spürbare Konzentration von
komplexen Leistungsgruppen bei einer gleichzeitigen guten
Erreichbarkeit der Grundversorgung verbessert er zum einen
die Versorgungsqualität für die Patientinnen und Patienten.
Zum anderen dämmt er den ruinösen Wettbewerb der
Krankenhäuser um Fallzahlen und Personal ein. Ich freue mich,
dass der neue Krankenhausplan für Nordrhein-Westfalen in
Kürze vollständig in Kraft tritt und seine ganze stärkende
Wirkung auf die Krankenhauslandschaft entfalten kann“, sagt
Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.
„Dass die neue Krankenhausplanung
für die allermeisten Krankenhäuser eine deutliche Veränderung
bedeutet und es daher zu Überprüfungen durch die
Verwaltungsgerichte kommt, war allen Beteiligten zu jeder
Zeit klar. Immerhin handelt es sich um die größte
gesundheitspolitische Reform in Nordrhein-Westfalen seit
Jahrzehnten. Wenn ich mir die zahlreichen Entscheidungen der
Gerichte zu unseren Gunsten anschaue, dann stelle ich fest,
dass wir mit unserer Planung ganz offensichtlich den
richtigen Weg eingeschlagen haben“, so Minister Laumann
weiter.
Bei den
Verwaltungsgerichten sind aktuell 94 Hauptsacheverfahren und
72 Eilverfahren anhängig (Stand: 22. Dezember 2025), die sich
zumeist gegen einzelne Planungsentscheidungen richten. Zum
Vergleich: In der Planung wurden rund 6.200
Einzelentscheidungen getroffen. Klagen (also
Hauptsacheverfahren) gegen einen Feststellungsbescheid zur
Krankenhausplanung haben keine aufschiebende Wirkung. Die
Eilverfahren beziehen sich auf parallel oder zuvor
eingereichte Klagen und wurden mit dem Ziel eingereicht, die
aufschiebende Wirkung der beklagten Zuweisungsentscheidungen
des Landes bis zu einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren
zu erwirken. Die Klagefrist ist abgelaufen.
Von den
72 Eilverfahren sind bislang 45 Verfahren erstinstanzlich von
den Verwaltungsgerichten zugunsten des Landes entschieden
worden, weitere 17 ganz oder teilweise zugunsten von
Krankenhäusern. Vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster als
nächster Instanz sind bisher insgesamt 40 Beschwerden gegen
diese Eilentscheidungen eingelegt worden, davon sechs durch
das Land Nordrhein-Westfalen. 14 Beschwerden wurden bisher
zugunsten des Landes entschieden, vier ganz oder teilweise
zugunsten der Krankenhäuser. Bezüglich der Hauptverfahren
liegen noch keine Urteile vor.
Die Ergebnisse des
Krankenhausplanungsverfahrens im Überblick
Wohnortnahe Grundversorgung
Ein zentraler Grundsatz der neuen
Krankenhausplanungssystematik in Nordrhein-Westfalen ist,
dass für 90 Prozent der Bevölkerung je Landesteil ein
Krankenhaus mit internistischer und chirurgischer Versorgung
mit dem Auto innerhalb von 20 Minuten erreichbar sein soll.
Dieses Ziel wurde übererfüllt: 98,6 Prozent der Bürgerinnen
und Bürger im Rheinland und 93,1 Prozent der Bürgerinnen und
Bürger in Westfalen-Lippe erreichen nach Umsetzung der neuen
Planung in 20 Minuten das nächste Krankenhaus, in dem sie
internistisch und chirurgisch versorgt werden können.
Denn aufgrund ihrer
Notfallrelevanz hat das Gesundheitsministerium in den
Leistungsgruppen Intensivmedizin, Allgemeine Chirurgie und
Allgemeine Innere Medizin landesweit beinahe alle Anträge
berücksichtigt. Entsprechend ist mit der neuen Planung eine
wohnortnahe Grundversorgung weiterhin sichergestellt.
Schwerpunktbildung in der Spezialversorgung
Um die
Qualität der Krankenhausbehandlungen für die Patientinnen und
Patienten zu steigern, zielt die neue nordrhein-westfälische
Krankenhausplanung darauf ab, Doppel- und
Mehrfachvorhaltungen in räumlicher Nähe abzubauen und
Schwerpunkte in den Leistungsportfolios der einzelnen
Krankenhäuser aufzubauen. Das gilt insbesondere für die
Leistungsgruppen, die gut planbar sind, beispielsweise in der
Orthopädie.
Beispiel Endoprothetik Knie:
214
Anträge landesweit – 136 Zuweisungen (= minus 36 Prozent)
Beispiel Endoprothetik Hüfte:
236 Anträge landesweit – 137 Zuweisungen (= minus 42 Prozent)
Das
gilt aber auch für Bereiche, in denen eine hochspezialisierte
Versorgung und große Expertise nötig sind, beispielsweise der
Onkologie. Hier ist eine Konzentration auf weniger
Krankenhausstandorte mit mehr Erfahrung und Expertise
dringend erforderlich, um für die Patientinnen und Patienten
die bestmögliche Behandlung anbieten zu können. Daher wurden
nicht allen Krankenhäusern, die Anträge für diese
Leistungsbereiche gestellt haben, die entsprechenden
Leistungsgruppen zugewiesen.
Beispiel Behandlung von Leberkrebs:
113
Anträge landesweit – 29 Zuweisungen (= minus 74 Prozent)
Beispiel Behandlung von
Speiseröhrenkrebs:
71 Anträge landesweit – 26
Zuweisungen (= minus 63 Prozent)
Gleichzeitig gibt es Bereiche,
die stark notfallrelevant sind, bei denen eine Konzentration
nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Ein Beispiel
hierfür sind kardiologische Angebote.
Beispiel Interventionelle Kardiologie:
165
Anträge landesweit – 141 Zuweisungen (= minus 15 Prozent)
Die Ergebnisse der Krankenhausplanung sind im Detail
einsehbar unter:
https://www.mags.nrw/startseite/gesundheit/krankenhausplanung-nrw/ergebnisse-der-krankenhausplanung-nrw
Finanzielle Unterstützung der Krankenhäuser
Zur Umsetzung der
Krankenhausplanung stellt das Land den Krankenhäusern in
dieser Wahlperiode insgesamt 2,5 Milliarden Euro zur
Verfügung. Davon fließen zwei Milliarden Euro in die
Einzelförderung von Krankenhäusern. 500 Millionen Euro werden
als Kofinanzierung für Maßnahmen verwendet, die aus dem
Transformationsfonds des Bundes gefördert werden.
Im Rahmen des
Transformationsfonds sind für die nordrhein-westfälischen
Krankenhäuser – vorbehaltlich der Zustimmung des Landtags als
Haushaltsgesetzgeber – bis zum Jahr 2035 insgesamt zehn
Milliarden Euro aus Landes- und Bundesmitteln sowie möglichen
Eigenbeteiligungen der Krankenhausträger vorgesehen. Damit
stehen den Kliniken in den nächsten zehn Jahren insgesamt
zwölf Milliarden Euro aus Einzelförderung und
Transformationsfonds für die Umsetzung der notwendigen
Strukturveränderungen zur Verfügung.
|
|
Änderungen bei Schutzimpfungen
gegen Meningokokken und Gürtelrose – STIKO-Empfehlungen
umgesetzt
|
|
Berlin, 18. Dezember 2025 – Der
Leistungsanspruch auf Schutzimpfungen gegen
Meningokokken-Erkrankungen und Herpes zoster (Gürtelrose)
wird sich voraussichtlich ab Februar 2026 ändern. Der
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die aktualisierten
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert
Koch-Institut (STIKO) in die Schutzimpfungs-Richtlinie
übernommen.
Zum Schutz vor Meningokokken-Erkrankungen
sieht die STIKO nun eine Impfung für alle Kinder und
Jugendlichen im Alter von 12 bis 14 Jahren vor, während die
Impfung für Kleinkinder entfällt. Die Impfung gegen
Gürtelrose wird anderes als bisher für Personen mit erhöhtem
Erkrankungsrisiko bereits ab 18 Jahren empfohlen.
Zudem hat die STIKO präzisiert, in welchen Fällen von einer
erhöhten gesundheitlichen Gefährdung durch eine Gürtelrose
auszugehen ist. Die Beschlüsse des G-BA zur Änderung der
Schutzimpfungs-Richtlinie werden nun dem Bundesministerium
für Gesundheit zur rechtlichen Prüfung vorgelegt und treten
nach einer Nichtbeanstandung und Veröffentlichung im
Bundesanzeiger in Kraft.
|
|
Vermittlungsausschuss
unterbreitet Einigungsvorschlag zum Sparpaket bei
Klinik-Vergütungen
|
|
Berlin, 17. Dezember 2025 - In seiner
konstituierenden Sitzung am 17. Dezember 2025 hat der
Vermittlungsausschuss einen Einigungsvorschlag zum Gesetz zur
Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege
verabschiedet.

Foto: Blick in den Sitzungssaal mit den Mitgliedern des
Vermittlungsausschusses.
© Bundesrat | Thomas Trutschel
Der Bundesrat hatte den Vermittlungsausschuss am 21.
November 2025 wegen eines Artikels des Gesetzes angerufen,
der die Klinikvergütungen für 2026 regelt. Danach sollen
durch Aussetzen der sogenannten Meistbegünstigungsklausel
Ausgaben der Krankenkassen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro
eingespart werden. Der Bundesrat kritisierte diese Pläne zu
Lasten der Krankenhäuser und verwies auf negative
Auswirkungen auf deren finanzielle Situation in 2026 und den
folgenden Jahren.
Meistbegünstigungsklausel bleibt
ausgesetzt - Folgen für 2027 werden ausgeglichen
Der
nun im gemeinsamen Ausschuss von Bundestag und Bundesrat
gefundene Einigungsvorschlag sieht vor, die Auswirkungen der
Einsparungen auf das Jahr 2026 zu begrenzen.
Konkret
soll die Meistbegünstigungsklausel für das Jahr 2026
ausgesetzt bleiben. Um jedoch negative Folgen für die
Finanzierung der Krankenhäuser in den darauffolgenden Jahren
auszuschließen, soll bei der Vereinbarung des
Landesbasisfallwertes für das Jahr 2027 ein um 1,14 Prozent
erhöhter Landesbasisfallwert für 2026 zugrunde gelegt werden.
Für die meisten Krankenhäuser kann dies durch eine
Ergänzung der Regelungen zum Krankenhausentgeltgesetz
geschehen, wie vom Vermittlungsausschuss vorgeschlagen.
Damit dies für alle Krankenhäuser gilt, müssen auch
psychiatrische und psychosomatische Kliniken einbezogen
werden. Für diese hat die Bundesregierung in einer
Protokollerklärung zugesichert, die
Bundespflegesatzverordnung - die nicht Gegenstand der
Vermittlungsverfahrens war - schnellstmöglich entsprechend zu
ändern.
Bundestag und Bundesrat am Zug
Bevor der
gefundene Kompromiss wirksam werden kann, müssen Bundestag
und Bundesrat darüber abstimmen. Im Bundestag ist die
Abstimmung für den 19. Dezember 2025 vorgesehen. Gleich im
Anschluss, am selben Tag, entscheidet dann auch der
Bundesrat, ob er das geänderte Gesetz billigt oder Einspruch
einlegt.
Schwesig und Hoppenstedt zu Vorsitzenden
gewählt
Da es sich um die erste Sitzung des
Vermittlungsausschusses in der 21. Legislaturperiode des
Bundestags handelte, musste sich der Ausschuss zu Beginn der
Sitzung zunächst konstituieren.
Als
Ausschussvorsitzende wählten die 16 Mitglieder des Deutschen
Bundestages und die 16 Mitglieder des Bundesrates erneut den
niedersächsischen Abgeordneten Dr. Hendrik Hoppenstedt (CDU)
und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern
Manuela Schwesig. Beide wechseln sich vierteljährlich ab. Den
ersten Turnus übernimmt Dr. Hendrik Hoppenstedt.
|
|
Hilfe auch an den Feiertagen
|
|
· Erste Anlaufstelle:
Servicenummer 116 117
· Videosprechstunde für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
· Zwischen den Jahren auf
Praxis-Vertretungen achten
Düsseldorf, 16.
Dezember 2025 – Die medizinische Versorgung bei leichten
Erkrankungen, die ambulant versorgt werden können, ist in
Nordrhein auch an den bevorstehenden Feiertagen gesichert.
Wer an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen, an
Silvester oder Neujahr akut erkrankt, erhält Zugang zu
medizinischer Hilfe über den kostenlosen Patientenservice
116 117.
Die Nummer ist auch an den
Feiertagen rund um die Uhr erreichbar. Die Mitarbeitenden
vermitteln nach einer professionellen und strukturierten
Ersteinschätzung - je nach Symptomen - entweder einen
direkten Arztkontakt per Video-/Telefonanruf oder einen
Hausbesuch bei immobilen Patienten.
Auch die
Vermittlung in eine der rund 90 Notdienstpraxen der
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) ist möglich. Im
Fall medizinischer Notfälle kann eine Weiterleitung an den
örtlichen Rettungsdienst erfolgen. Informationen zu Adressen
und Öffnungszeiten der Notdienstpraxen gibt es zum Beispiel
online unter www.kvno.de/notdienst.
Ärztliche
Hausbesuche vor allem für Bettlägerige möglich
Für
Patientinnen und Patienten, die nicht geh-fähig sind, kann
über die 116 117 ein ärztlicher Hausbesuch organisiert
werden. Auf Wunsch informiert die 116 117 auch über die
Erreichbarkeit fachärztlicher Notdienste im Landesteil – hier
für Augenheilkunde, HNO und Kinder.
Weiteres Angebot:
Videosprechstunden im ambulanten Bereitschaftsdienst
Ergänzend zur Versorgung durch einen Arzt im
Bereitschaftsdienst in einer der KVNO-Praxen haben alle
Anrufenden, Eltern erkrankter Kinder ebenso wie Erwachsene,
im Akutfall die Möglichkeit, kostenlos eine Videosprechstunde
im Notdienst durchzuführen.
Auch per Videocall zum
Beispiel über das Handy können mit einer Ärztin /einem Arzt
Symptome abgeklärt und erste Behandlungsmaßnahmen besprochen
werden. Bei Bedarf ist der Erhalt eines eRezeptes ebenso
möglich. Häufig ist im Anschluss dann kein weiterer
Praxisbesuch notwendig.
Die Videosprechstunde im
kinderärztlichen Notdienst ist grundsätzlich samstags,
sonntags und feiertags von 10 bis 22 Uhr verfügbar. Das
Pendant für Erwachsene samstags, sonntags und feiertags von 9
bis 21 Uhr. Angefragt werden können beide
Videosprechstunden-Angebote der KVNO entweder über die
Servicenummer 116 117 oder über
www.kvno.de/kinder bzw.
www.kvno.de/erwachsene
Anschließend erhalten
Eltern per E‑Mail einen Terminlink und sollten die
Versichertendaten des Kindes bereithalten. Für die Nutzung
genügt eine stabile Internetverbindung sowie ein Smartphone,
Tablet, Notebook oder Computer mit Kamera und Mikrofon –
bestenfalls in einer ruhigen Umgebung.
Zwischen den
Jahren: auf Vertretungen achten
Zwischen dem 27. Dezember
und dem 3. Januar bleiben einige Praxen im Rheinland
urlaubsbedingt geschlossen. Während der regulären
Sprechzeiten übernehmen andere Praxen vor Ort die Vertretung.
Patientinnen und Patienten sollten rechtzeitig auf
entsprechende Aushänge in der Praxis, Hinweise auf dem
Anrufbeantworter oder Informationen auf den Praxis-Websites
achten. Auch sofern regelmäßig Medikamente eingenommen werden
müssen, sollte die benötigte Menge ebenfalls mit Blick auf
die Feiertage rechtzeitig vorab überprüft werden.
Weitere Informationen zum ambulanten Notdienst in Nordrhein
gibt es unter
www.kvno.de/notdienst
|
|
Stellungnahme der hauptamtlichen
unparteiischen Mitglieder des G-BA
Zum Entwurf eines
Gesetzes zur Anpassung der Krankenhausreform
|
|
Berlin, 15.
Dezember 2025 - Zum Krankenhausreformanpassungsgesetz – KHAG:
Stellungnahme zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Alle
Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben und Verordnungsentwürfen
finden Sie auf der Website des G-BA unter
Stellungnahmen.
|
|
Verkauf des ehemaligen
Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus in Meiderich erfolgreich
abgeschlossen
|
|
Evangelisches Klinikum
Niederrhein übergibt früheren Standort an duisport
Duisburg, 15. Dezember 2025 - Gut ein Jahr nach dem Umzug des
Herzzentrums aus dem alten Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus in
Duisburg-Meiderich an den neuen Standort Duisburg-Fahrn hat
das Evangelische Klinikum Niederrhein das frühere
Krankenhausareal erfolgreich veräußert. Neuer Eigentümer der
Immobilie ist die Duisburger Hafen AG (duisport).

Foto Evangelisches Klinikum Niederrhein gGmbH
Mit dem im Dezember 2025 beurkundeten Vertragsabschluss
ist eine Lösung gefunden worden, die dem Stadtteil, der Stadt
Duisburg und der weiteren strukturellen Entwicklung
gleichermaßen zugutekommt. Statt eines über Jahre
leerstehenden Klinikgebäudes erhält der traditionsreiche
Standort eine neue Perspektive und bleibt in Nutzung.
„Der Verkauf des ehemaligen Gebäudes unseres Herzzentrums
in Meiderich ist für uns ein wichtiger Meilenstein“, sagt
Dipl. Kfm. Franz Hafner, Vorsitzender der Geschäftsführung
des Evangelischen Klinikums Niederrhein. „Die
herzmedizinische Versorgung findet selbstverständlich
weiterhin im neuen Herzzentrum Duisburg am Standort
Duisburg-Fahrn statt – modern, zukunftsfähig und auf Wachstum
ausgerichtet.
Gleichzeitig tragen wir Verantwortung für
die Standorte, die wir verlassen. Uns war wichtig, dass hier
kein ‚Lost Place‘ entsteht, sondern eine kluge Nachnutzung,
die strukturell und wirtschaftlich Sinn ergibt – für
Meiderich und für die Region.“
Die Gespräche über
den Verkauf verliefen zügig und in guter, vertrauensvoller
Zusammenarbeit. „Die schnelle Einigung und die gute
Kooperation mit duisport zeigen, dass gemeinsame Lösungen
möglich sind, wenn alle Beteiligten die Perspektive des
Stadtteils im Blick haben“, so Hafner weiter.
Auch
Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link begrüßt den Abschluss
ausdrücklich: „Die Übernahme des ehemaligen
Krankenhausstandorts durch Duisport ist nicht nur für die
Menschen in Meiderich eine sehr gute Nachricht. Diese Lösung
vermeidet Leerstand und eröffnet neue Perspektiven für die
weitere Entwicklung des Stadtteils.“
Mit der Übernahme
durch duisport beginnt nun die nächste Entwicklungsphase für
das Areal des früheren Kaiser-Wilhelm-Krankenhauses. Die
Fläche soll einer zukunftsorientierten Nutzung zugeführt und
fest im Stadtgefüge verankert werden. Bereits im kommenden
Jahr startet duisport mit dem Rückbau des früheren
Herzzentrums, um das Gelände für weitere Schritte
vorzubereiten.
duisport-CEO Markus Bangen: „Wir
prüfen derzeit verschiedene Ideen für die zukünftige Nutzung
des Geländes, zum Beispiel zu Wohnzwecken, und werden diese
gemeinsam mit der Stadt Duisburg und den Bürgerinnen und
Bürgern diskutieren. Unser oberstes Ziel ist es, keinen ‚Lost
Place‘ mitten in Meiderich entstehen zu lassen, sondern das
Areal in Abstimmung mit dem Stadtteil und den Menschen
weiterzuentwickeln.“
Mit dem jetzt vollzogenen
Verkauf des ehemaligen Gebäudes ist der Standortwechsel des
Herzzentrums nun auch immobilienseitig vollständig
abgeschlossen: Das Evangelische Klinikum Niederrhein
konzentriert sich auf seine modernen Klinikstandorte, während
der frühere Standort in Meiderich eine neue Rolle im
städtischen Gefüge erhält.
|
|
Blutspenden im Dezember |
|
DRK-Blutspendedienste rufen zur
Blutspende über die Feiertage auf und danken für großartiges
Engagement
Jede einzelne Spende 2025 hat Leben
gerettet und Patientinnen und Patienten in oft ausweglosen
Situationen Hoffnung und eine neue Lebensperspektive
gegeben.Die aktuelle Krankenwelle wirkt sich bereits spürbar
auf das Blutspendeaufkommen aus – ein Warnsignal, das die
angespannte Situation zum Jahresende zusätzlich verschärft.
Mit Beginn der Advents- und Weihnachtszeit steht eine
sensible Phase an: Während viele Menschen im Feiertagsmodus
sind, bleibt der Bedarf an Blutpräparaten in den Kliniken
kontinuierlich hoch – etwa durch planbare Behandlungen vor
dem Jahresende sowie durch Notfälle. Gleichzeitig gehen die
Spendezahlen traditionell zurück

Blutspende Heute / DRK-Blutspendedienst West
Jede einzelne
Blutspende 2025 hat Leben gerettet und Patientinnen und
Patienten in oft ausweglosen Situationen Hoffnung und eine
neue Lebensperspektive gegeben. Die DRK-Blutspendedienste
danken allen Blutspenderinnen und Blutspendern in Deutschland
für ihr herausragendes Engagement in diesem Jahr.
Dank
des verlässlichen Einsatzes der Spendergemeinschaft konnte
die Versorgung mit lebenswichtigen Blutpräparaten in vielen
Regionen über das gesamte Jahr hinweg sehr stabil gehalten
werden – trotz Hitzeperioden im Sommer, hoher
Krankheitswellen und der üblichen Schwankungen in
Ferienzeiten. Obwohl das Jahr noch nicht vorüber ist, ist es
bemerkenswert, wie gut die Blutversorgung bislang
aufrechterhalten werden konnte. Um diese positive Lage auch
im Dezember fortzuführen, werben die Blutspendedienste
besonders jetzt für eine kontinuierliche Spendenbereitschaft,
auch in der Advents- und Weihnachtszeit.
Was gut lief,
darf auch gut weiterlaufen – aber Vorzeichen sind
herausfordernd
Die aktuelle Krankenwelle wirkt sich
bereits jetzt spürbar auf das Blutspendeaufkommen aus – ein
Warnsignal, das die angespannte Situation zum Jahresende
zusätzlich verschärft. Mit Beginn der Advents- und
Weihnachtszeit beginnt eine Phase, in der viele Menschen
erfahrungsgemäß sehr beschäftigt sind und die Zeit für eine
Blutspende fehlt. Dennoch bleibt der Bedarf an Blutpräparaten
in den Kliniken kontinuierlich hoch – etwa durch planbare
Behandlungen vor dem Jahresende sowie durch Notfälle
Gemeinsam stabil durch den Jahreswechsel: Die
DRK-Blutspendedienste appellieren daher an die Bevölkerung,
die angebotenen Termine im Dezember wahrzunehmen –
insbesondere auch an den Brückentagen und zwischen den
Jahren. Mehr als hunderte Termine deutschlandweit – jetzt
Liege sichern Bundesweit bieten die DRK-Blutspendedienste im
Dezember mehrere hundert Spendetermine an. Sie bieten die
ideale Gelegenheit, das Jahr mit einer außergewöhnlich guten
Tat zu beenden und aktiv zur Versorgungssicherheit über die
Feiertage beizutragen.
Termine in der Nähe sowie
Informationen zur Spende sind jederzeit über
www.blutspende.de abrufbar.
Blutspenden im Westen:
Alle
aktuellen Blutspendetermine, sowie Informationen rund um das
Thema Blutspende sind kostenfrei unter 0800 11 949 11 oder
unter www.blutspende.jetzt tagesaktuell abrufbar. Facebook &
Instagram: @blutspendejetzt.
|
|