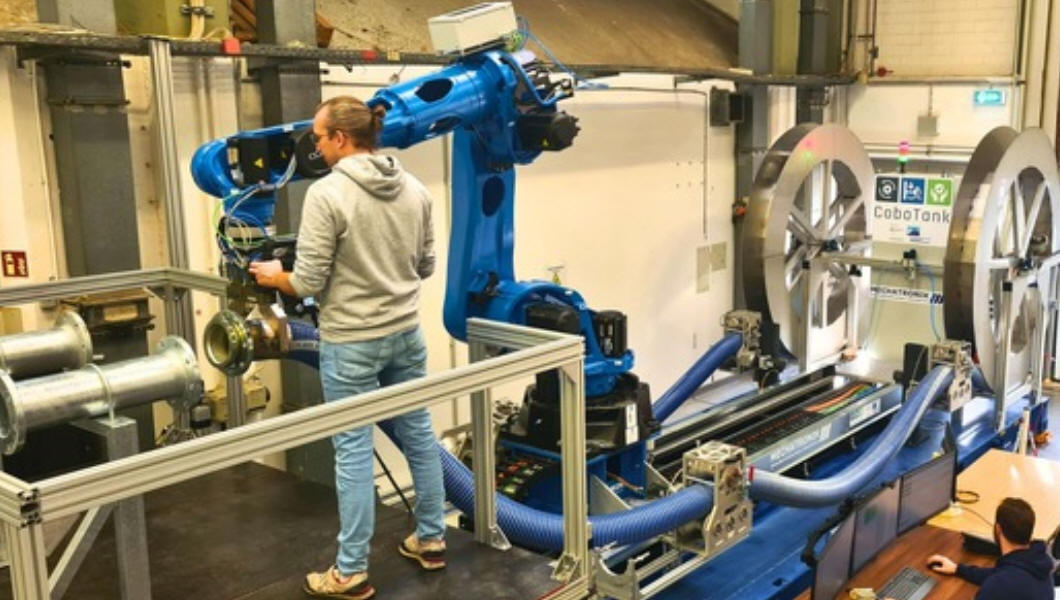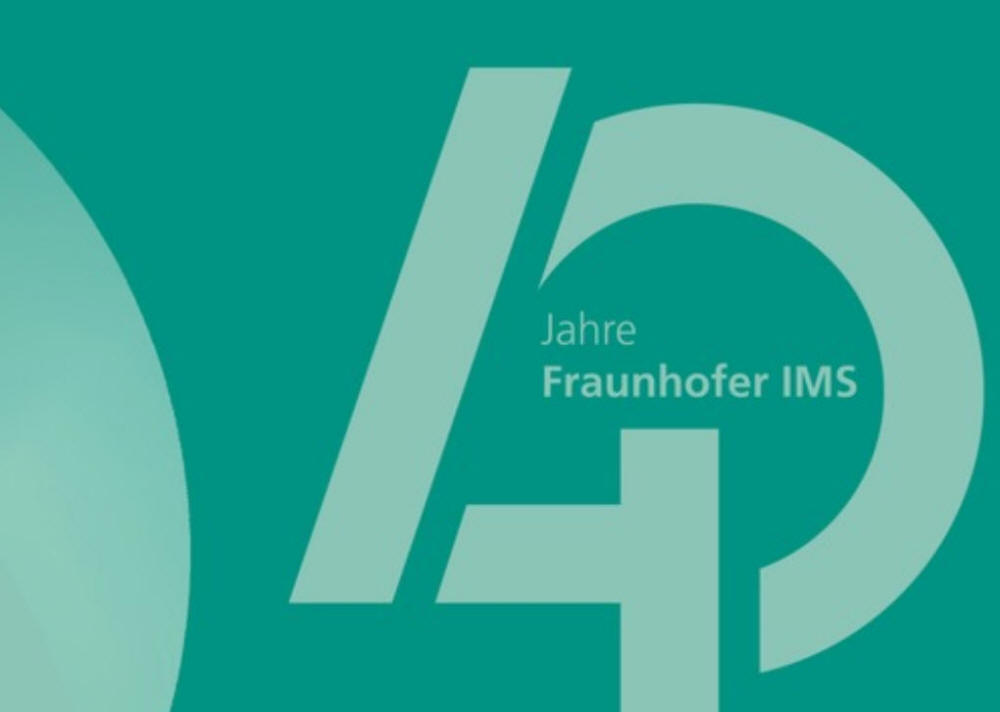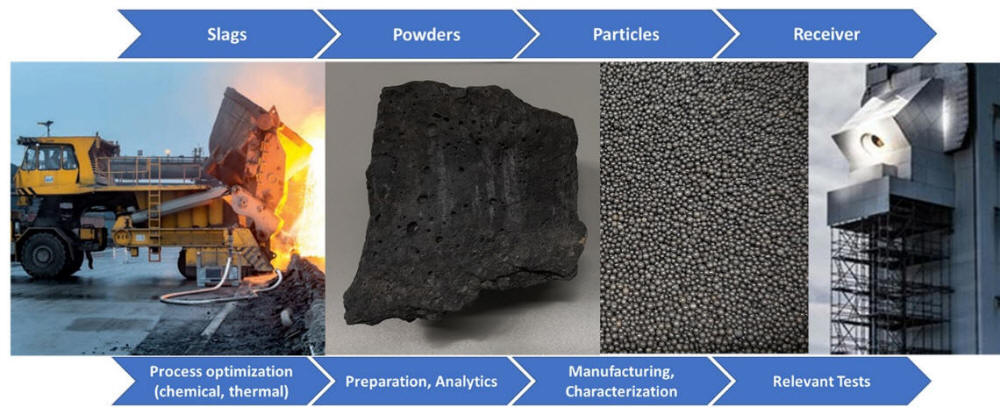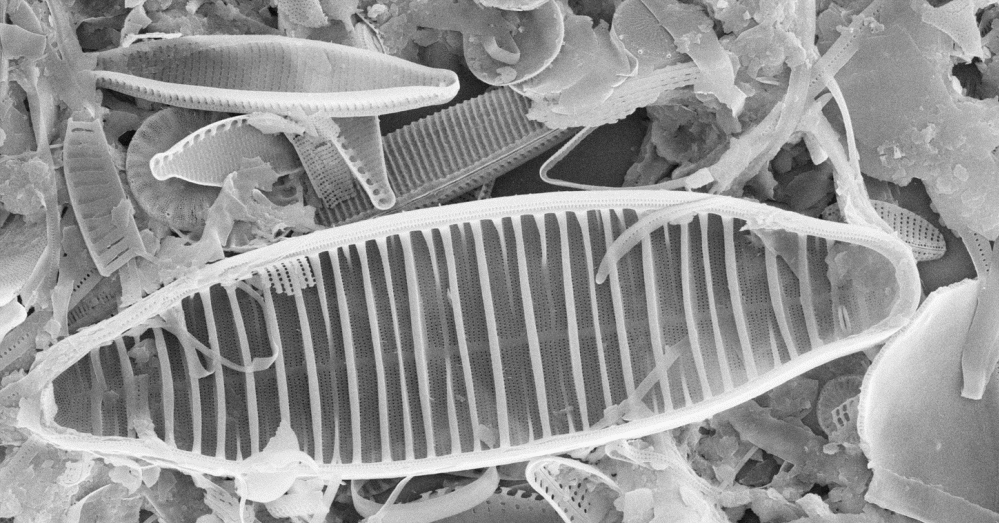•
2024 •
2023
•2021/2022
•
2020
•
2019
Sitemap Redaktion Harald Jeschke •
2024 •
2023
•2021/2022
•
2020
•
2019
Sitemap Redaktion Harald Jeschke |
|
|
|
|
Roboter „CoboTank“ übernimmt schwere Lasten im Hafen
|
|
Duisburg, 1. Dezember 2025 - Ein Tankschiff zu beladen ist Schwerstarbeit.
Verladeschläuche von bis zu 70 Kilogramm müssen vom Steiger an Bord
gebracht werden. Wie ein kollaborativer Roboter diese Aufgabe
übernimmt und zugleich die Sicherheit erhöht, zeigen Forschende der
Universität Duisburg-Essen und des DST am 4. Dezember in Duisburg.
Beim Zukunftstag Flüssiggutlogistik präsentieren sie die
Ergebnisse des mit 2,75 Millionen Euro vom Bundesministerium für
Digitales und Verkehr geförderten Projekts „CoboTank“.
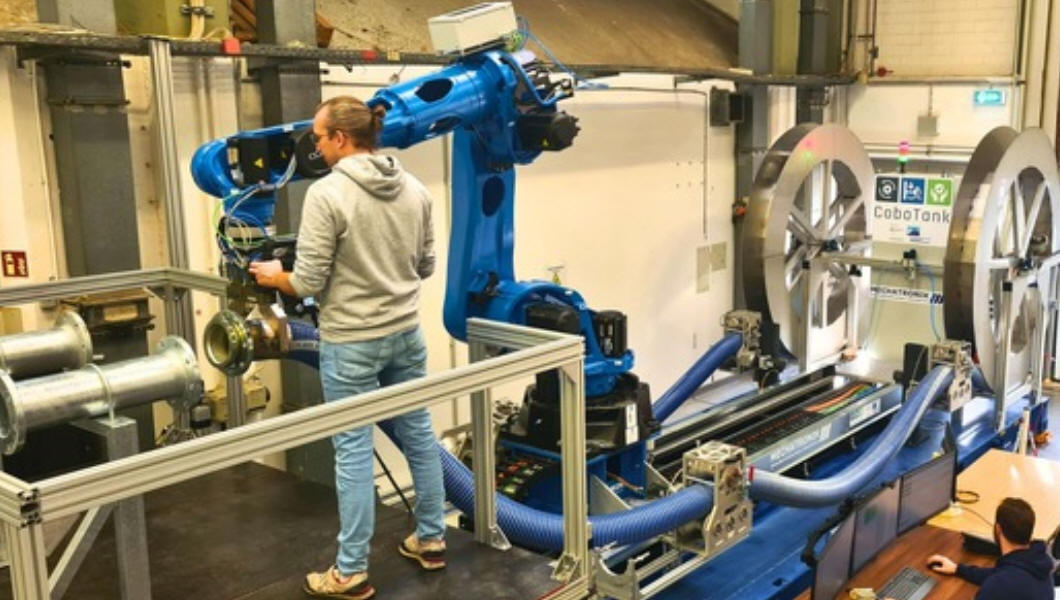
Das Robotersystem
übernimmt künftig die Schwerlast. Copyright: UDE/Markus Nieradzik
Für die deutsche Chemiebranche ist die Binnenschifffahrt zentral:
Rund die Hälfte der landesweiten Flüssiggüter wird über Rhein, Elbe
und andere Wasserstraßen transportiert. Doch die Branche kämpft mit
dem Fachkräftemangel.
„Die Tätigkeit pendelt zwischen
Kraftakt und monotoner Überwachung“, sagt PD Dr. Magnus Liebherr vom
Fachgebiet Allgemeine Psychologie: Kognition der Universität
Duisburg-Essen. Beim An- und Abkoppeln der Schläuche ist körperliche
Leistung gefragt, während der stundenlangen Beladung höchste
Aufmerksamkeit – denn im Fehlerfall muss binnen Sekunden reagiert
werden.
Hier setzt der neue Roboter an. „Unser Robotersystem
trägt das Gewicht, der Mensch trifft die Entscheidungen“, erklärt
Tobias Bruckmann, Professor am Lehrstuhl für Mechatronik der
Universität Duisburg-Essen. Der Roboter nimmt die schweren Schläuche
automatisiert auf, führt sie zum Schiff und gleicht dabei dessen
Bewegungen aus. An Bord steuert die Bedienperson den Roboterarm über
eine intuitive Handführung präzise zum Anschlussflansch. Danach
übernimmt sie nur noch leichte Handgriffe wie das Verbinden des
Erdungskabels.
Das reduziert die körperliche Belastung
deutlich – und halbiert den Personalbedarf: Statt vier Fachkräften
reichen künftig eine an Bord und eine in der Leitstelle. Damit die
Zusammenarbeit reibungslos funktioniert, verfügt das System über
umfangreiche Sensorik: Ein Kraft-Momenten-Sensor registriert die
Bewegungsimpulse der Bedienperson, weitere Sensoren überwachen
Umgebung und Schiffsbewegungen.
Die größte Herausforderung
sei gewesen, so Bruckmann, die sichere Kooperation zwischen Mensch
und einem vergleichsweise großen Roboter zu gewährleisten – und ihn
zugleich so präzise zu regeln, dass er selbst bei Wellengang
millimetergenau mit dem Schiff mitläuft. Zudem musste ein völlig
neues Bedienkonzept in ein Arbeitsumfeld integriert werden, das seit
Jahrzehnten von Handarbeit geprägt ist.
Ein entscheidender
Erfolgsfaktor: Das Hafenpersonal war von Beginn an eingebunden – vom
„alten Seebären“ bis zum Nachwuchs. Das kollaborative Robotersystem
„CoboTank“ ist in Originalgröße am Lehrstuhl für Mechatronik zu
sehen. Im Hafenforschungslabor HaFoLa des DST – Entwicklungszentrums
für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V. – bilden fünf
verschiedene Demonstratoren im Maßstab 1:16 den gesamten Ablauf vom
Anlegen bis zum Umschlag ab.
Die Versuchshalle mit einem 18
Meter langen Hafenbecken bildet Topographie und Infrastruktur
realitätsnah nach und dient als Testzentrum für neue Technologien.
„Durch die Skalierung können wir technische Konzepte kosteneffizient
in die Praxis übertragen und im Zusammenspiel erproben“, erklärt
Cyril Alias vom DST. „So erkennen wir Optimierungspotenziale, die
Simulationen oft nicht zeigen.“
|
|
Neue Anlage für
synthetisches Erdgas in Duisburg Licht + Luft = Kraftstoff
|
|
Duisburg,
20. November 2025 - Am
Zentrum für Brennstoffzellen-Technik, einem An-Institut der
Universität Duisburg-Essen, nimmt Greenlyte Carbon Technologies am
20. November seine erste kommerzielle Liquid-Solar-Anlage in
Betrieb. Sie basiert auf Prozessschritten, die an der Universität
Duisburg-Essen erforscht und entwickelt wurden.
CO₂ wird aus der Luft gebunden und
grüner Wasserstoff erzeugt – eine Technologie, die die
Ausgangsstoffe für klimaneutrale Kraftstoffe liefert. Die feierliche
Eröffnung übernahm Hendrik Wüst, Ministerpräsident von
Nordrhein-Westfalen, im Beisein weiterer hochrangiger
Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft.

Gruppenfoto vor der neuen Anlage mit
Ministerpräsident Hendrik Wüst (1. Reihe, 4.v.l.) und Rektorin Prof.
Dr. Barbara Albert (1. Reihe 3.v.r) Copyright: Britt Knautz
Die Direct Air Capture-Technologie ist
darauf ausgelegt, Kohlendioxid (CO₂) effizient aus der Umgebungsluft
zu entfernen und in synthetische Kraftstoffe umzuwandeln. Bereiche
wie Luftfahrt, Schifffahrt und Industrie können somit ihren Ausstoß
an klimaschädlichem CO₂ deutlich senken.
Die nun in Duisburg eröffnete Anlage im
industriellen Maßstab nutzt eine Kombination aus CO2-Bindung und
Wasserelektrolyse, um die Grundstoffe für synthetisches Erdgas zu
erzeugen (Details des Verfahrens: siehe unten). Die Anlage am
Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT) wird jährlich etwa 40
Tonnen CO₂ aus der Luft binden und als Reingas bereitstellen, wovon
ein Teil in der ZBT-eigenen Anlage zu insgesamt fünf Tonnen
synthetischen Erdgases (SNG) umgesetzt wird.
Die modulare Technik lässt sich leicht
skalieren und läuft vollständig elektrisch – ein Vorteil gegenüber
bisherigen Verfahren, die auf hohe Temperaturen angewiesen sind und
deutlich schlechtere Wirkungsgrade aufweisen.
Die nachhaltige
Zukunftstechnologie basiert auf der 15-jährigen
Forschungsarbeit von Dr. Peter Behr, der sich an der
Universität Duisburg-Essen intensiv mit dem Prozess des
Carbon Capture auseinandergesetzt und gemeinsam mit Florian
Hildebrand und Dr. Niklas Friederichsen 2022 die Greenlyte
Carbon Technologies GmbH gegründet hat.
An der nun in Duisburg eröffneten
Anlage ist neben dem Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik
und Energiesysteme der Universität Duisburg-Essen auch der
Lehrstuhl für Technische Thermodynamik der RWTH Aachen
beteiligt.* Die Universität Duisburg-Essen unterstützte,
indem ihr Gründungszentrum GUIDE die Ausgründung begleitete.
„Diese Anlage zeigt
eindrucksvoll, wie Ergebnisse der universitären Forschung in
Startups und industrielle Dimensionen transferiert werden
können“, sagt Prof. Dr. Barbara Albert, Rektorin der
Universität Duisburg-Essen. „Mit Greenlyte wird Wissen aus
der Forschung umgesetzt in moderne Technologie für
Klimaneutralität.“
Mitgründer Dr. Niklas
Friederichsen sieht im Wasserstoff-Testfeld am Campus
Duisburg den idealen Standort für die Liquid-Solar-Anlage:
“Das Wasserstoff-Testfeld des ZBT befindet sich 20 km
entfernt vom Firmensitz der Greenlyte Carbon Technologies.
Wir glauben an schnelle, iterative Entwicklungsprozesse, für
die räumliche Nähe und ein enger Austausch mit den
Kolleg:innen von unschätzbarem Wert sind. Am Standort selbst,
aber insgesamt im Ruhrgebiet, wurde über die letzten Jahre
eine Fülle an Infrastruktur und Wasserstoff-Know-How
aufgebaut, von dem wir als innovatives Unternehmen sehr
profitieren.
Hier können wir unsere
Technologie im industriellen Maßstab weiterentwickeln, um sie
robust und über viele tausend Stunden validiert im nächsten
Schritt zu kommerzialisieren. Die Eröffnung heute ist für uns
ein wichtiger Meilenstein in der Demonstration unserer
Technologie auf industrieller Skala.”
Zur Verfahrenstechnik: Die
Direct-Air-Capture-Technologie basiert auf einem
kontinuierlich betriebenen, dreistufigen Prozess: Absorption:
Umgebungsluft wird durch eine Säule geleitet, in der
Kohlendioxid (CO₂) mit einem unternehmenseigenen
Absorptionsmittel reagiert. Das Gas wird dabei in Form von
Bicarbonat chemisch gebunden. Kristallisation und Trennung:
Die bicarbonatreiche Lösung wird kontrolliert
auskristallisiert. Es bilden sich feste Carbonatkristalle,
die unkompliziert zu handhaben und zu lagern sind.
Elektrochemische Desorption: Eine
wässrige Bicarbonatlösung wird elektrochemisch direkt zu
Kohlendioxid (CO2) und Wasserstoff (H2) umgewandelt. H2 und
CO2 stehen direkt als Ausgangsstoff für die Synthese von
synthetischem Kraftstoff wie z.B. SNG oder Methanol zur
Verfügung. Das Absorptionsmittel wird für den nächsten Zyklus
regeneriert.
Die modular aufgebaute
Technologie arbeitet mit ungiftigen Materialien und lässt
sich flexibel mit intermittierenden erneuerbaren
Energiequellen koppeln. * Zu den Investoren von Greenlyte
Carbon Technologies gehören Earlybird, die Green Generation
Management GmbH, die Carbon Removal Partners AG, die AENU
Advisor GmbH und Partech.
Partner sind neben der
Universität Duisburg-Essen und dem ZBT unter anderem die
Evonik Industries AG, Düsseldorf Airport, das
Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion, die
Aachener Verfahrenstechnik der RWTH Aachen, die Fumatech BWT
GmbH, Uniper SE und MB Energy.
|
|
Recycling von IT-Geräten |
|
Studie: Mit gebrauchten IT-Geräten Treibhausgase reduzieren
Duisburg, 30. Oktober 2025 - Fraunhofer UMSICHT untersuchte
für Interzero, wie nachhaltig der Einsatz gebrauchter
IT-Geräte ist. Die Ergebnisse zeigen: Erhalten Smartphones,
Tablet- & Co. ein zweites Leben, lassen sich bis zu 37
Prozent Treibhausgase einsparen.
© Fraunhofer UMSICHT Wie nachhaltig ist der Einsatz
gebrauchter IT-Geräte? Wie nachhaltig ist der Einsatz
gebrauchter Technik wirklich?
Dieser Frage sind der Kreislaufwirtschaftsdienstleister
Interzero und Fraunhofer UMSICHT nachgegangen. Das Ergebnis:
Vor allem die Wiederaufbereitung gebrauchter Smartphones
trägt entscheidend zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen
bei. Die Studie »Treibhausgaseinsparungen durch Wiedernutzung
ausgewählter IKT-Geräte« fokussiert aktuelle Daten zur
Umweltwirkung wiederverwendeter IT-Geräte und nimmt dafür den
ökologischen Fußabdruck von Smartphone, Tablet & Co. bei
konventioneller und verlängerter Nutzung in den Blick.
Besonders im Fokus stehen dabei die Treibhausgasemissionen.
Reused Smartphones mit größtem Einsparpotenzial Die
Ergebnisse verdeutlichen erneut die Relevanz zirkulärer
Lösungen im Elektroniksektor: Je nach Gerätetyp lassen sich
durch Reuse oder Refurbishment zwischen 18 und 37 Prozent der
Treibhausgasemissionen einsparen. Mit 34,7 kg THG-Emissionen
fallen die Einsparungen durch die verlängerte
Produktlebensdauer bei Smartphones besonders hoch aus.
Im Vergleich zu einem einmaligen konventionellen Lebenszyklus
verursacht die erneute Nutzung eines Smartphones rund 37
Prozent weniger THG-Emissionen. Erneut genutzte Tablets
sparen rund 34 Prozent (59,4 kg THG-Emissionen). Gelangt ein
Laptop ins Refurbishment, liegen die Einsparungen bei rund 31
Prozent (107 kg) und bei Desktop-PCs bei circa 18 Prozent
(163 kg) gegenüber der konventionellen Lebensdauer.

© Fraunhofer UMSICHT
»Die Studienergebnisse machen deutlich, dass nachhaltiges
Wirtschaften und wirtschaftliche Chancen Hand in Hand gehen
können. Refurbishment und Reuse schaffen neue
Wertschöpfungspotenziale und tragen gleichzeitig maßgeblich
zur Schonung unseres Planeten bei«, erklärt Philipp
Rittershaus, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fraunhofer
UMSICHT.
Über die Studie
Die Untersuchung »Treibhausgaseinsparungen durch
Wiedernutzung ausgewählter IKT-Geräte« basiert auf einer
Lebenszyklusanalyse, bei der alle Phasen
(Ressourcengewinnung, Produktion, Distribution, Nutzung,
Entsorgung) des Produktlebenszyklus berücksichtigt wurden,
sowie auf Primärdaten von Interzero zu allen Aufwänden der
Aufbereitung.
Es wurden zwei Nutzungsszenarien
analysiert: Reuse (Berücksichtigung weiterer Schritte wie
Aufbereitung, Transport und einer zweiten Nutzungsphase) und
Refurbishment (Berücksichtigung des Austausches einzelner
Komponenten zusätzlich zu Reuse). Die ermittelten
Einsparungen orientieren sich an den jeweiligen
Aufbereitungsprozessen von Interzero. Analysiert wurden die
Produktlebenszyklen von Smartphones und Tablets mit Fokus auf
das Reuse-Nutzungsszenario sowie die von Notebooks und
Desktop-PCs mit Fokus auf das Refurbishment-Nutzungsszenario.
|
|
Neues Merkblatt zu Metallschäden durch Wasserstoff |
|
Das neue
TÜV-Verband-Merkblatt 1276 zeigt, wie gasförmiger Wasserstoff
auf Metalle einwirkt und wie sich Schäden an Anlagen
vermeiden lassen. Es bietet Fachleuten praktische Hilfe bei
der Auswahl geeigneter Materialien und Prüfverfahren.
Berlin/Duisburg, 20. Oktober 2025 – Wasserstoff gilt als
Energieträger der Zukunft. Das Gas lässt sich klimaneutral
herstellen, vielseitig einsetzen und langfristig speichern.
Doch damit Wasserstoff sicher transportiert, gespeichert und
genutzt werden kann, müssen die dabei verwendeten Materialien
besonders robust und sorgfältig geprüft sein.

„Wasserstoff kann Metalle im Laufe der Zeit verändern und
schwächen“, sagt Ingo Blohm, Referent für
Beschaffenheitsanforderungen und Dampfkesselanlagen beim
TÜV-Verband. „Leitungen und Tanks können dadurch Risse
bekommen, undicht werden oder im schlimmsten Fall brechen.“
Wie sich das vermeiden lässt, zeigt ein aktuelles Merkblatt
des TÜV-Verbands. Darin wird beschrieben, wie sich geeignete
Materialien auswählen und prüfen lassen, um
Wasserstoffanlagen sicher zu betreiben. „Die Werkstofffrage
entscheidet mit über den Erfolg der Wasserstoffwirtschaft“,
sagt Blohm.
„Unser Ziel ist es, das technische Wissen in klare
Empfehlungen für den sicheren Anlagenbetrieb zu übersetzen.“
Passend dazu rückt auf der Hamburger Messe „Hydrogen
Technology Expo Europe“ das Thema Material- und
Anlagensicherheit in den Fokus der Wasserstoffbranche und
beleuchtet ein Feld, zu dem der TÜV-Verband mit dem neuen
Merkblatt einen wichtigen Beitrag leistet.
Wenn Wasserstoff das Metall verändert
Der Umgang mit gasförmigem Wasserstoff stellt Materialien auf
eine harte Probe. Dringt das Gas in ein Metall ein, schieben
sich seine winzigen Atome zwischen die Metallatome. Dadurch
verändert sich die innere Struktur: das Material wird
spröder, verliert an Festigkeit und kann unter Belastung
plötzlich versagen. „Besonders häufig ist die
wasserstoffinduzierte Rissbildung“, sagt Blohm.
„Dabei dringt Wasserstoff in feinste Poren des Metalls ein
und schwächt dort die Bindungen zwischen den Atomen.“ Unter
Belastung können so winzige Risse entstehen, die sich im
Laufe der Zeit unbemerkt vergrößern und schließlich zum Bruch
eines Bauteils führen. Eine andere Form der Schädigung ist
das sogenannte Blistering.
Hier sammelt sich Wasserstoffgas in kleinen Hohlräumen im
Inneren des Materials. Der entstehende Druck kann das Metall
aufwölben oder sogar ablösen. Auch an Schweißnähten kann
Wasserstoff gefährlich werden. Unter Spannung entstehen dort
bevorzugt Risse, ein Effekt, den Fachleute als
Spannungsrisskorrosion bezeichnen. „Solche Schäden entstehen
oft schleichend und bleiben lange unentdeckt“, sagt Blohm.
„Gerade deshalb ist es entscheidend, die Mechanismen genau zu
kennen und schon bei der Planung geeignete Materialien
auszuwählen, die diesen Belastungen standhalten.“
Werkstoffprüfung und Konstruktion: So bleibt Metall unter
Wasserstoff stabil
Um solche Schädigungen zu verhindern, braucht es aus Sicht
des TÜV-Verbands technisches Wissen, klare Prüfverfahren und
praxisnahe Leitlinien. Genau hier setzt das Merkblatt an. Es
zeigt, welche Prüfverfahren sich eignen, um
wasserstoffbedingte Schäden rechtzeitig zu erkennen. Dazu
gehören Ultraschallprüfungen, mit denen sich feine Risse oder
Veränderungen im Inneren des Metalls aufspüren lassen, ebenso
wie Röntgen- oder Druckprüfungen, die Schwachstellen sichtbar
machen, bevor sie sicherheitsrelevant werden.
Zudem enthält das Merkblatt Hinweise, wie sich Bauteile so
gestalten und fertigen lassen, dass sie weniger anfällig für
Versprödung oder Rissbildung sind. Ein Schwerpunkt liegt
dabei auf der Schweißtechnik. „Beim Verbinden von
Metallteilen entstehen oft hohe Temperaturen und Spannungen,
die den Werkstoff anfälliger machen können“, sagt Blohm.
Durch bestimmte Schweißverfahren, Zusatzwerkstoffe und eine
gezielte Wärmebehandlung nach dem Schweißen lassen sich
innere Spannungen reduzieren. Dadurch bleibt das Metall
stabil.
Auch die Konstruktion der Bauteile spiele eine wichtige
Rolle, so Blohm: „Wenn Bauteile so gestaltet werden, dass
sich Kräfte gleichmäßig verteilen, lassen sich Schwachstellen
von vornherein vermeiden. Sanfte Übergänge statt scharfer
Kanten, die richtige Wandstärke oder eine glatte Oberfläche
können darüber entscheiden, ob ein Bauteil Jahrzehnte hält
oder frühzeitig Risse bekommt.“
Wasserstoff bringt neue Herausforderungen für Regelwerke
Obwohl Wasserstoffanwendungen in Industrie, Energieversorgung
und Mobilität zunehmen, fehlen bislang verbindliche Regeln,
wie Materialien unter Wasserstoffeinfluss zu bewerten sind.
In bestehenden Normen und technischen Regelwerken wird das
Thema Wasserstoffversprödung bisher nur am Rande behandelt.
Mit dem neuen Merkblatt gibt der TÜV-Verband Fachleuten aus
Planung, Prüfung und Betrieb von Wasserstoffanlagen eine
klare Orientierung an die Hand und ergänzt bestehende
Vorschriften um praxisnahe Handlungsempfehlungen.
„Viele bestehende Regelwerke wurden für konventionelle Gase
entwickelt und berücksichtigen die besonderen Eigenschaften
von Wasserstoff bislang nur unzureichend“, sagt Blohm. „Mit
der zunehmenden Nutzung von Wasserstoff entstehen neue
technische Anforderungen, auf die sich Normung und Praxis
schrittweise einstellen. Unser Merkblatt bietet dafür eine
erste Orientierung und fasst den bisherigen Wissensstand
zusammen.“
Neues Merkblatt online verfügbar
Das neue TÜV-Verband Merkblatt 1276 „Schädigung metallischer
Werkstoffe durch den Einfluss von gasförmigem Wasserstoff -
Einführung für Sachverständige“ ist ab sofort als digitale
Version im Onlineshop des TÜV-Verbands erhältlich und kostet
95,94 Euro:
https://shop.tuev-verband.de/merkblaetter/MB-WERK-Werkstoffe/Schaedigung-metallischer-Werkstoffe-durch-den-Einfluss-von-gasfoermigem-Wasserstoff-Einfuehrung-fuer-Sachverstaendige-MB-WERK-1276?mtm_campaign=1276pm
Vom 21. bis 23. Oktober 2025 treffen sich auf der Hydrogen
Technology Expo Europe in Hamburg zudem Vertreter:innen der
internationalen Wasserstoffbranche. Damit greift die Messe
ein Thema auf, das auch für den TÜV-Verband zentral ist: die
Sicherheit von Materialien und Anlagen im Umgang mit
Wasserstoff.
|
|
Fraunhofer IMS setzt Impulse
beim MST Kongress 2025
|
|
Duisburg, 29. September 2025 - Künstliche
Intelligenz, Quantentechnologie und nachhaltige
Mikroelektronik: Das Fraunhofer IMS zeigt auf dem
MikroSystemTechnik (MST) Kongress 2025 in Duisburg, wie
Forschungslösungen von heute die Technologien von morgen
gestalten. Durch die Mitwirkung von Institutsleiter Prof. Dr.
Anton Grabmaier in der Kongressleitung gestaltet das
Fraunhofer IMS die Ausrichtung des MST Kongresses auch auf
strategischer Ebene mit.

@ Fraunhofer IMS
Das Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS ist vom 27. bis 29. Oktober 2025 gemeinsam
mit weiteren Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft im Rahmen
der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) auf
dem MikroSystemTechnik Kongress in der Mercatorhalle Duisburg
vertreten.
Der MST Kongress ist das zentrale Forum für
Mikrosystemtechnik im deutschsprachigen Raum und bringt unter
dem Motto »Nothing is as constant as change« Expertinnen und
Experten aus Wissenschaft, Industrie und Politik zusammen.
Diskutiert werden aktuelle Entwicklungen und Zukunftsthemen
der Mikroelektronik: von intelligenter Sensorik über
Quantentechnologien bis hin zu nachhaltiger
Informationstechnik.
Forum für die enge Zusammenarbeit zwischen angewandter
Forschung und Industrie
Prof. Dr. Anton Grabmaier, Institutsleiter des Fraunhofer
IMS, übernimmt in diesem Jahr gemeinsam mit Prof. Martin
Hoffmann von der Ruhr-Universität Bochum die Rolle des
Conference Chair und verantwortet somit die wissenschaftliche
Leitung des Kongresses.
Unterstützt werden sie dabei von Dr. Attila Bilgic, Co-Chair
und CEO der KROHNE Messtechnik GmbH. »Der MST Kongress steht
wie kaum ein anderes Forum für die enge Zusammenarbeit
zwischen angewandter Forschung und Industrie«, sagt
Grabmaier.
»Das Fraunhofer IMS fokussiert sich beim Kongress auf
Technologiefelder wie Sensorsysteme, Quantentechnologien und
nachhaltige Mikroelektronik. Damit leistet das Institut einen
Beitrag zur nachhaltigen und wettbewerbsfähigen
Weiterentwicklung der Mikroelektronik in Deutschland.«
Technologien und Beiträge aus dem Fraunhofer IMS
Am Gemeinschaftsstand der Forschungsfabrik Mikroelektronik
Deutschland (FMD) zeigt das Fraunhofer IMS zahlreiche
Exponate, Demonstratoren und Fachbeiträge, die sich auf drei
zentrale Projekte konzentrieren: APECS, FMD-QNC und Green
ICT. Im Rahmen des EU-Chips-Act-Projekts APECS (Advanced
Packaging and Heterogeneous Integration for Electronic
Components and Systems) präsentiert das Institut innovative
Sensorlösungen und photonisch integrierte Schaltungen.
Das deutschlandweite FMD-QNC-Projekt bündelt Forschung im
Bereich Quanten- und neuromorphes Computing. Hier zeigt das
IMS unter anderem SPADs (Single-Photon Avalanche Dioden) für
Ionenfallen. Ergänzt wird der Auftritt durch Beiträge aus dem
Kompetenzzentrum Green ICT, das an energieeffizienten und
ressourcenschonenden Mikroelektroniklösungen arbeitet.
Gemeinsam mit weiteren FMD-Instituten werden anwendungsnahe
Entwicklungen präsentiert, die das Potenzial haben, die
Mikroelektronik der Zukunft maßgeblich zu prägen.
Neben den Exponaten bringt sich das Fraunhofer IMS mit
mehreren wissenschaftlichen Beiträgen in das
Konferenzprogramm ein. Vorträge kommen unter anderem zur
Entwicklung plasmonischer Metamaterialabsorber für
Multispektral-Bolometer, zur 3D-Integration
rückseitenbeleuchteter Bildsensoren sowie zur Entwicklung
eines RISC-V-basierten Systems-on-Chip für tragbare
Plethysmographie-Anwendungen. In der Postersession sind
IMS-Beiträge zu innovativen Mikro- und Nanotechnologien
vertreten.
Weitere Informationen finden Sie hier:
MikroSystemTechnik Kongress 2025.
Fraunhofer IMS
Mit intelligenten Sensorsystemen eine sichere und nachhaltige
Zukunft gestalten: In zahlreichen hochmodernen
Forschungslaboren arbeitet das Fraunhofer IMS mit über 200
talentierten wissenschaftlichen Mitarbeitenden und
Studierenden an innovativen mikroelektronischen Lösungen.
www.ims.fraunhofer.de
|
|
Gulf Cryo und Fraunhofer UMSICHT unterzeichnen Absichtserklärung
zur Förderung von Carbon Management Lösungen
|
|
Strategische
Partnerschaft
Am 17. September 2025 unterzeichneten das kuwaitische
Gasunternehmen Gulf Cryo und das Fraunhofer-Institut für
Umwelt-, Energie- und Sicherheitstechnik UMSICHT eine
Absichtserklärung (MoU) über eine strategische Partnerschaft
für Carbon Management Technologien.

MuO signing between Gulf Cryo and Fraunhofer UMSICHT, Kuwait
2025 © Gulf Cryo
Prof. Manfred Renner (l.), Institutsleiter Fraunhofer
UMSICHT, und Amer Huneidi, Vorstandsvorsitzender von Gulf
Cryo, bei der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding.

MuO signing between Gulf Cryo and Fraunhofer UMSICHT, Kuwait
2025 © Gulf Cryo
(v.l.) Peter Sauer (Stellvertretender Deutscher Botschafter
in Kuwait), Nouf Ali Behbehani (Amtierende Generaldirektorin
der Umweltbehörde), Dr.-Ing. Sebastian Stießel (Business
Developer Green Hydrogen Fraunhofer UMSICHT), Prof. Dr.-Ing.
Manfred Renner (Institutsleiter Fraunhofer UMSICHT), Amer
Huneidi (Vorstandsvorsitzender, Gulf Cryo), Dr. Muhammad
Muhammadieh (Vice President Großindsutrie, Gulf Cryo),
Abdallah Dalab (Leiter Strategische Beziehungen, Gulf Cryo)
Gulf Cryo, der regionale Marktführer Kuwaits für
End-to-End-Industriegase und Lösungen zur Dekarbonisierung in
der MENAT-Region, hat eine Absichtserklärung (Memorandum of
Understanding - MoU) mit dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-,
Energie- und Sicherheitstechnik UMSICHT unterzeichnet. Die
Absichtserklärung sieht eine strategische Kooperation in den
Bereichen Kohlenstoffumwandlung, Wasserstoff-Technologien und
Energieeffizienz vor, mit dem Ziel, den Übergang Kuwaits und
der gesamten Region zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu
beschleunigen.
Diese Partnerschaft ist Teil der langfristigen Strategie von
Gulf Cryo, in deren Rahmen das Unternehmen bereits
anwendungsnahe Forschung aufbaut. Diese Kapazitäten
ermöglichen es, Technologien, die auf die lokalen Bedürfnisse
zugeschnitten sind, zu erproben, zu skalieren und zu
kommerzialisieren.
Förderung der Dekarbonisierung und der Kreislaufwirtschaft
Gulf Cryo bringt seine Kompetenz in den Bereichen Industrie,
Markt und Anwendungen ein, während Fraunhofer UMSICHT über
eine langjährige Erfahrung in der anwendungsnahen Forschung
und Innovation mit den Schwerpunkten Circular Economy, Green
Hydrogen, Carbon Management und Local Energy Systems verfügt.
Gemeinsam wollen die beiden Organisationen die Lücke zwischen
Forschung und industrieller Umsetzung schließen und sich
dabei auf Dekarbonisierung und Lokalisierung konzentrieren,
um eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.
Die Vereinbarung steht im Einklang mit der Kuwait Vision
2035, die die Stärkung des Privatsektors, Innovation und
Umweltverantwortung in den Vordergrund stellt. Sie entspricht
auch der Forderung der Umweltbehörde nach einer engeren
Kooperation zwischen Regierung und Industrie, um Technologien
zu lokalisieren, die eine nachhaltige Wirtschaft ermöglichen.
Die Absichtserklärung wurde im Rahmen einer Zeremonie in
Kuwait unterzeichnet, an der Vertreter von Regierung,
Industrie, Forschung und Diplomatie teilnahmen.
»Diese Partnerschaft spiegelt unsere Rolle als nationaler
Wegbereiter für nachhaltige Lösungen wider. Partnerschaften
mit Experten wie Fraunhofer sind unerlässlich, um lokale
Innovationen voranzutreiben und die Energiewende zu
beschleunigen«, sagte Amer Huneidi, Vorstandsvorsitzender von
Gulf Cryo.
»Ich lade Behörden und Industrieunternehmen ein, sich uns anzuschließen,
um Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln, die sowohl
die Nachhaltigkeit als auch die Effizienz verbessern.
Gemeinsam können wir zeigen, dass Nachhaltigkeit keine Kosten
verursacht, sondern ein Katalysator für Innovationen und den
Aufbau stärkerer Volkswirtschaften ist«, fügte er hinzu.
»Die industrielle Umsetzung und Skalierung neuer Technologien
ist essenziell für die substanzielle Reduzierung der
CO2-Emissionen und die Förderung der Energiewende. Über
starke Partnerschaften mit Global Playern wie ‚Gulf Cryo‘
wird diese Veränderung gelingen«, sagte Prof. Dr.-Ing.
Manfred Renner, Leiter des Fraunhofer UMSICHT.
Gulf Cryo
Gulf Cryo ist ein regionaler Lösungsanbieter, der integrierte
Anwendungen für Industrie-, Medizin- und Spezialgase im
gesamten Nahen Osten liefert. Mit mehr als 70 Jahren
Erfahrung entwickelt und implementiert das Unternehmen
Technologien, die die Dekarbonisierung, Energieeffizienz und
Kreiswirtschaft vorantreiben. Gulf Cryo spielt eine wichtige
Rolle bei der Unterstützung nationaler Strategien in der
gesamten Region – zur Reduzierung von Emissionen, zur
Beschleunigung der Energiewende und zur Förderung von
Innovationen, die sowohl der Wirtschaft als auch der Umwelt
zugutekommen.
Fraunhofer UMSICHT
Wegbereiter in eine nachhaltige Welt
Fraunhofer UMSICHT unterstützt Industrie und Gesellschaft
beim Transfer in ein klimaneutrales und zirkuläres
Wirtschaftssystem. Unsere Forschung fokussiert auf Circular
Economy, Green Hydrogen, Carbon Management und Local Energy
Systems. Wir entwickeln Materialien und Verfahren für die
zirkuläre Nutzung von Ressourcen und für die elektrochemische
Herstellung, Nutzung und Speicherung von grünem Wasserstoff.
Zudem bieten wir Lösungen für eine nachhaltige Verwendung von
Kohlenstoff an und entwickeln Energiekonzepte für
klimaneutrale Wohn-, Gewerbe- und Industriestandorte.
Kompetenzen in Verfahrenstechnik, Energietechnik und
Materialentwicklung verbinden wir mit einem umfassenden Blick
auf die Herausforderungen, denen sich Großindustrie,
Mittelstand und Gesellschaft stellen. Wir beraten
ganzheitlich, zeigen Handlungsoptionen auf, wägen diese ab
und entwickeln die jeweils beste Lösung.
|
|
Zukunft der Künstlichen Intelligenz kommt nach Duisburg |
|
KI-StartUp Festival 2025 des
ZaKI.D
Duisburg, 27. August 2025 - Am 16. September 2025 lädt das
Zentrum für angewandte Künstliche Intelligenz Duisburg
(ZaKI.D) zum zweiten Mal zum kostenfreien KI-StartUp Festival
ein. Die Veranstaltung ist Teil der ruhrSTARTUPWEEK und
bringt unter dem Motto »KI-Start-ups für eine nachhaltige
Wirtschaft!« visionäre Gründerinnen und Gründer, Fachleute
und Talente zusammen.

© Zentrum für angewandte Künstliche Intelligenz Duisburg
(ZaKI.D)
Nach dem erfolgreichen Debüt im Jahr 2024 mit Highlights wie
spannenden Vorträgen, KI-gestützten Industrieanwendungen und
einem abwechslungsreichen Ideenmarkt dürfen sich
Besucherinnen und Besucher auch 2025 auf ein vielfältiges
Programm im Fraunhofer-inHaus-Zentrum freuen.
Die Keynotes und Fachimpulse beschäftigen sich mit den
aktuellen Herausforderungen und Chancen für KI-Start-ups: Dr.
Xenia Grote (WestAI) spricht darüber, was junge Unternehmen
wirklich brauchen, um sich erfolgreich im Markt zu
etablieren. Der Duisburger Gründer und Start-up-Mentor Marco
Peters berichtet, wie KI Gründerinnen und Gründer heute
stärken und unterstützen kann.
Monika Löber (KI.NRW) zeigt, wie Nordrhein-Westfalen ein
starkes KI-Ökosystem aufbaut. Außerdem beleuchtet Dr. Manuel
Bickel (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH)
den Beitrag von KI zur Ressourceneffizienz in Unternehmen.
Neben spannenden Vorträgen bietet das Festival
Networking-Formate wie Speeddating, eine Ausstellung von
ZaKI.D-Demonstratoren, Multiplikatoren und regionalen
Start-ups sowie eine Paneldiskussion mit den Referierenden.
Ziel ist es, Gründerinnen und Gründern, Unternehmen und
Interessierten eine Plattform zu geben, um sich zu vernetzen,
Ideen auszutauschen und gemeinsame Projekte zu entwickeln.
»Mit Künstlicher Intelligenz können Start-ups heute nicht nur
innovative Geschäftsmodelle aufbauen, sondern auch echte
Beiträge zu einer nachhaltigeren Wirtschaft leisten. Genau
diese Brücke möchten wir mit dem Festival schlagen«, sagt
Wolfgang Gröting, Leiter des Fraunhofer-inHaus-Zentrums.
Das Festival richtet sich an Start-ups, Gründerinnen und
Gründer, Studierende, Unternehmen sowie KI-Interessierte, die
neue Impulse für ihre Arbeit mitnehmen möchten. Termin:
Dienstag, 16. September 2025. Ort: Fraunhofer-inHaus-Zentrum,
Duisburg. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Zur Anmeldung
|
|
Vier Jahrzehnte Mikroelektronik »Made in Duisburg« |
|
Von robusten Mikrochips zur
Quantentechnologie: 40 Jahre Fraunhofer IMS
Duisburg, 12. August 2025 - Seit vier Jahrzehnten prägt das
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und
Systeme IMS die Mikroelektronikforschung in Deutschland und
weltweit. Heute bringt das Institut Licht auf Chips, Sensorik
in Gewebe und Intelligenz in Maschinen. Und das mit
Technologien, deren Anwendungen vom Implantat bis zur
Industrieanlage reichen.
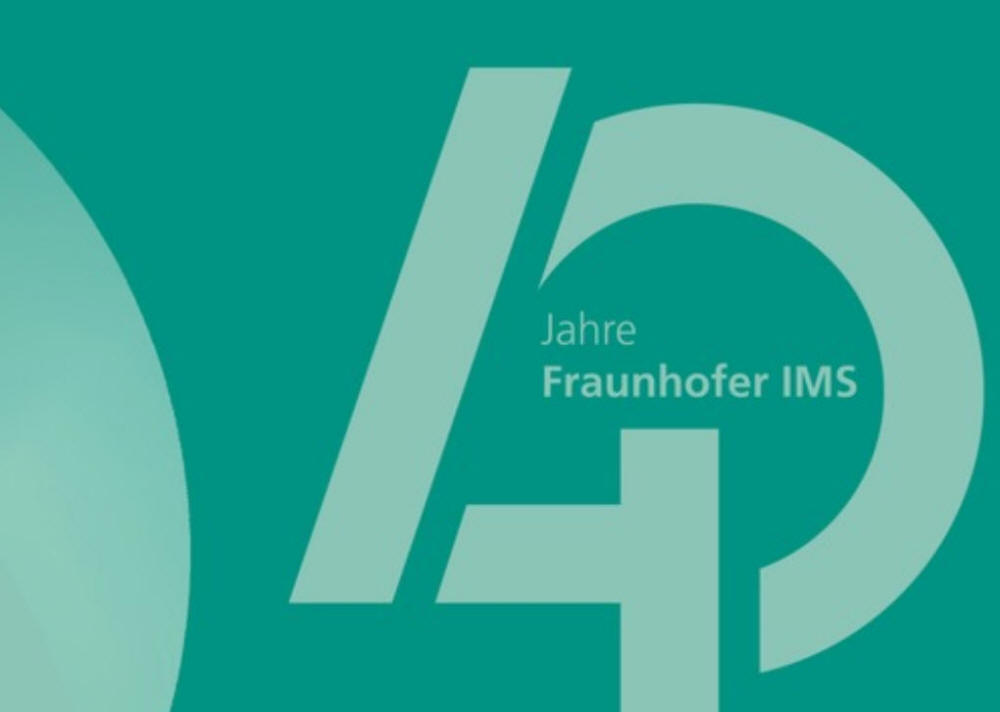
© Fraunhofer IMS
1985 waren PCs noch Exoten, und der Begriff »Künstliche
Intelligenz« ein Zukunftstraum. Heute steuern smarte Systeme
Medizingeräte oder Produktionsanlagen, oft mit Komponenten,
die in Duisburg entwickelt oder hergestellt wurden. Von der
ersten 4-Zoll-Wafer-Fertigung in den 1990er-Jahren bis zur
heutigen Entwicklung intelligenter Sensorsysteme: Das
Fraunhofer IMS hat sich stets weiterentwickelt und frühzeitig
auf neue Technologien gesetzt.
Technologiewandel als Konstante
Der wissenschaftliche Grundstein des Fraunhofer IMS wurde
bereits 1970 an der Universität Dortmund gelegt und nur zwei
Jahre nach der offiziellen Gründung konnte 1987 das neu
errichtete Institutsgebäude in Duisburg bezogen werden. Dort
nahm das Fraunhofer IMS mit einem eigenen Reinraum die
Entwicklung neuartiger CMOS-Herstellungsverfahren für
robuste, zuverlässige und automobiltaugliche Mikrochips auf.
Aufbau und Ausrichtung des Instituts prägte über viele Jahre
Prof. Dr. Günter Zimmer. Seit 2006 führt Prof. Dr. Anton
Grabmaier das Institut: mit klarem Fokus auf Anwendungen, die
Mikroelektronik für Mensch und Gesellschaft nutzbar machen.
Entwicklungen, wie der gemeinsam mit Partnern entwickelte
Hirndrucksensor für Hydrocephalus-Erkrankte oder
Retina-Implantate, mit denen Blinde wieder sehen können,
zeigen den direkten Einfluss der Forschung auf die
Lebensqualität vieler Menschen. Auch in der
Infrastrukturüberwachung, beispielsweise mit Betonsensoren
zur Korrosionsdetektion, setzte das Institut Standards.
Die langjährige Kooperation mit dem Unternehmen ELMOS zeigt,
dass sich IMS-Entwicklungen auch im hochqualitativen
automobilen Einsatz bewähren. Ein Meilenstein in der
photonischen Sensorik war die Entwicklung eines
LiDAR-Systems, also einer präzisen Abstandssensorik mit
Licht, mit extrem rauscharmer SPAD-Technologie
(Einzelphotonen-Detektoren). Diese Innovation machte das
Institut international sichtbar.
Heute: Hightech für die Lebenswelten von morgen
»Unsere Sensorik wird immer intelligenter. Sie erkennt
Veränderungen, bevor sie zum Problem werden«, sagt
Institutsleiter Prof. Dr. Anton Grabmaier. »Ob in
sicherheitsrelevanten Bildsensoren, biomedizinischen
Implantaten oder der Industrieautomatisierung:
IMS-Technologien helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen und
Systeme effizienter und sicherer zu machen.«
Die Verbindung von Sensorik und Künstlicher Intelligenz (KI)
ist dabei ein zentrales Thema: Mit Algorithmen gelingt es,
aus Bilddaten Vitalparameter wie Atemfrequenz und Puls zu
bestimmen; drahtlos und ohne direkten Hautkontakt. Die KI
dringt heute systematisch in neue Anwendungsbereiche vor, von
der Pflegeunterstützung über die Medizintechnik im häuslichen
Umfeld bis hin zur Industrie.
Gleichzeitig steigern die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler des Fraunhofer IMS die Leistungsfähigkeit
mikroelektronischer Bauelemente: Beispielsweise mit
3D-Integration, neuen Materialsystemen und Verfahren wie
Atomic Layer Deposition (ALD), mit denen sich ultradünne,
gleichmäßige Funktionsschichten im Nanometerbereich erzeugen
lassen.
Ein weiterer Fokus liegt auf der Integration photonischer
Funktionalitäten direkt in elektronische Systeme – eine
Schlüsseltechnologie für hochpräzise Sensorik, für
biomedizinischen Diagnostik oder der Quantentechnologie.
»Die Reinräume des Fraunhofer IMS bieten die ideale
Infrastruktur, um Forschungsergebnisse direkt in innovative
Bauteile zu überführen und im Anschluss zu skalieren und
transferieren,« schildert Prof. Dr. Anna Lena
Schall-Giesecke, die am Fraunhofer IMS die Kernkompetenz
»Technology« leitet und gleichzeitig als Professorin an der
Universität Duisburg-Essen forscht.
Zukunft aus Duisburg
Die Mikroelektronik hat das Ruhrgebiet verändert. Das
Fraunhofer IMS bleibt in seiner Rolle als Brückenbauer
zwischen Forschung und industrieller Anwendung ein aktiver
Treiber dieses Wandels. Mit moderner Reinraumtechnik,
interdisziplinärer Entwicklungskompetenz und anwendungsnahen
Technologielösungen bringt das Institut Mikroelektronik aus
Duisburg in Systeme weltweit.
|
|
Bezirksregierung Düsseldorf und Fraunhofer IOSB vermessen Ruhr
mit autonomer Wasserdrohne
|
|
•
Hightech-Einsatz
liefert erstmals vollständige und hochauflösende Daten aus
Flach- und Tiefwasserbereichen
Düsseldorf/Duisburg, 22. Juli 2025 - Die Bezirksregierung
Düsseldorf hat gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für
Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB in Karlsruhe
ein zukunftsweisendes Pilotprojekt zur Vermessung der Ruhr
durchgeführt. Zum ersten Mal kam dabei eine vom Fraunhofer
IOSB entwickelte autonome Wasserdrohne zum Einsatz, die in
einem rund sechs Kilometer langen Ruhrabschnitt bei Essen
hochauflösende Daten sowohl aus tiefen als auch flachen
Gewässerbereichen erfasst hat.
Die Wasserdrohne misst das Höhenrelief sowohl unter als auch
über der Wasseroberfläche mit bislang unerreichter Präzision
– und das nahezu vollständig automatisiert. Ausgestattet mit
einer Kombination aus Sonar- und optischen Sensoren kann sie
nicht nur die Gewässersohle und Uferbereiche in einem
Arbeitsgang erfassen, sondern auch selbstständig Hindernissen
ausweichen. So sind beispielsweise größere Gegenstände wie
auch beginnende Kolkbildungen an Bauwerken, also durch
Wasserstrudel erzeugte Vertiefungen, klar erkennbar.
„Einblicke, wie sie bisher nicht möglich waren“ „Durch den
Einsatz dieser Technologie konnten wir Einblicke in die
Unterwasserwelt der Ruhr erhalten, wie sie bisher nicht
möglich waren“, sagt Regierungspräsident Thomas Schürmann.
„Zum ersten Mal konnte der gesamte Vermessungsabschnitt in
seiner fast vollständigen Breite samt der Flachwasserbereiche
und der flachen Nebenarme dargestellt werden. Diese
Detailtiefe verbessert Entscheidungsgrundlagen erheblich –
etwa bei der Gewässerunterhaltung oder bei der Berechnung von
Hochwasserereignissen.“
Die Drohne ist nur zwei Meter lang, wiegt rund 80 Kilogramm
und hat einen geringen Tiefgang – damit ist sie besonders
geeignet für den Einsatz in flachen, naturnahen Gewässern.
Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zur herkömmlichen
Vermessung mit großen, bemannten Schiffen oder manuellen
Messlatten müssen empfindliche Flachwasserzonen nicht mehr
betreten werden. Die ökologische Belastung bleibt dadurch
minimal.
IOSB: Für die Entwicklung bis zur Marktreife auf Partner
angewiesen Die Erprobung in der Ruhr diente nicht nur der
Erfassung aktueller Daten, sondern auch dem Vergleich mit
bisherigen Messverfahren. Für die Ingenieure vom Fraunhofer
IOSB war es der erste Praxiseinsatz unter Realbedingen,
nachdem das System zuvor als internes Forschungsprojekt
entwickelt worden war.
“Mit der Idee, Gewässer mittels einer leichtgewichtigen,
unbemannten Plattform möglichst vollautomatisch zu vermessen,
haben wir bewusst Neuland betreten. Wir freuen uns sehr, dass
sich dieser Ansatz hier auch aus Anwendersicht ausgezahlt
hat”, sagt Projektleiter Dr. Janko Petereit. “Außerdem hilft
uns jeder Einsatz, unsere Technologie weiter zu optimieren.”
Die Forschenden hoffen deshalb auf weitere
Praxis-Pilotprojekte mit herausfordernden Anwendungsszenarien
für ihre Drohne. Damit die neue Technologie ihren Nutzen in
größerem Maßstab entfalten kann, werden letztlich aber auch
Unternehmenspartner benötigt.
Janko Petereit: “Für das eigentliche Ziel können sind wir als
Forschungsinstitut auf Partner angewiesen: Nämlich die neue
Technologie am Markt zu etablieren und sie im Dienste der
Gewässerunterhaltung und der sicheren Schiffbarkeit breit
verfügbar zu machen.”
Einen wichtigen Schritt in diese Richtung haben das
Fraunhofer IOSB und die Bezirksregierung Düsseldorf indes
getan: Sie haben mit ihrem Pilotprojekt neue Maßstäbe für
eine moderne, umweltschonende und effiziente
Gewässervermessung gesetzt – und gezeigt, wie digitale
Technologien in der Wasserwirtschaft konkret zum Einsatz
kommen können.
|
|
EU-Methodik für CO2-armen Wasserstoff und Kraftstoffe:
Kommission legt delegierten Rechtsakt vor
|
|
Brüssel, 9. Juli 2025 - Um die Entwicklung
eines Wasserstoffmarktes in Europa zu unterstützten, hat die
Europäische Kommission einen delegierten Rechtsakt zur
Einführung einer umfassenden Methodik zu CO2-armen
Wasserstoff und Kraftstoffen veröffentlicht.
EU-Energiekommissar Dan Jørgensen erklärte: „Wasserstoff wird
eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung unserer
Wirtschaft spielen. Mit einer pragmatischen Definition von
CO2-armem Wasserstoff, die den Energiemix aller EU-Länder
respektiert, bieten wir Investoren die notwendige Sicherheit.
Auf diese Weise unterstützen wir das Wachstum eines Sektors,
der sowohl für unsere Wettbewerbsfähigkeit als auch für
unsere Klimaziele von entscheidender Bedeutung ist.“
Wie im Deal für eine saubere Industrie hervorgehoben, sind
Rechtssicherheit und Kohärenz von entscheidender Bedeutung,
um Investitionen zu fördern und es den Erzeugern zu
ermöglichen, zu expandieren und letztlich das Wachstum des
Sektors zu beschleunigen. CO2-armer Wasserstoff wird die
Bemühungen um die Dekarbonisierung von Sektoren unterstützen,
in denen die Elektrifizierung derzeit keine praktikable
Option ist, wie der Luftverkehr, die Schifffahrt und
bestimmte industrielle Prozesse.
70 Prozent Treibhausgaseinsparungen
Um als CO2-arm zu gelten, müssen Wasserstoff und damit
verbundene Kraftstoffe einen Schwellenwert von 70 Prozent für
Treibhausgaseinsparungen im Vergleich zur Verwendung fossiler
Brennstoffe erreichen. Dies bedeutet, dass CO2-armer
Wasserstoff auf verschiedene Weise erzeugt werden kann,
beispielsweise mit Erdgas mit CO2-Abscheidung, -Nutzung und
-Speicherung (CCUS).
Die Methodik erkennt die Vielfalt des Energiemixes in den
Mitgliedstaaten an und bietet einen flexiblen und
pragmatischen Rahmen. In dem delegierten Rechtsakt wird nicht
der Anteil erneuerbarer Energien festgelegt, der für aus
Strom erzeugten Wasserstoff angerechnet werden kann. Die
Kommission wird diesen Aspekt bei der Überprüfung der der
Erneuerbare-Energien-Richtlinie anzugehen.
Konsultation zu Kernenergie 2026
Mit Blick auf die Zukunft wird die Europäische Kommission die
Auswirkungen der Einführung alternativer Wege auf das
Energiesystem und die Emissionseinsparungen sowie die
Notwendigkeit der Aufrechterhaltung gleicher
Wettbewerbsbedingungen bei der Beschaffung von vollständig
erneuerbarem Strom bewerten. Im Jahr 2026 wird sie eine
öffentliche Konsultation zu einem Entwurf einer Methodik für
die Nutzung von Strombezugsverträgen für die Kernenergie
einleiten, um für mehr Klarheit bei der Erzeugung von
CO2-armem Wasserstoff aus direkten nuklearen Quellen zu
sorgen.
Nächste Schritte
Der delegierte Rechtsakt wird nun dem Europäischen Parlament
und dem Rat übermittelt, die zwei Monate Zeit haben, um sie
zu prüfen und die Vorschläge entweder anzunehmen oder
abzulehnen. Auf Antrag kann der Prüfungszeitraum um zwei
Monate verlängert werden. Das Parlament oder der Rat haben
keine Möglichkeit, die Vorschläge zu ändern.
Hintergrund
In der Wasserstoff- und Gasmarktrichtlinie wird ein
vollwertiger Zertifizierungsrahmen für CO2-arme Kraftstoffe
festgelegt, der die in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie
festgelegten Vorschriften für erneuerbare Kraftstoffe
ergänzt. Gemäß Artikel 9 der Richtlinie muss die Kommission
bis spätestens 5. August 2025 eine Methode zur Bewertung der
Emissionseinsparungen von CO2-armen Kraftstoffen festlegen.
Die heutige Annahme folgt einem intensiven
Konsultationsprozess mit den wichtigsten Interessenträgern
und den Mitgliedstaaten. Ein erster Entwurf des delegierten
Rechtsakts wurde vom 27. September bis zum 25. Oktober 2024
zur Stellungnahme veröffentlicht. Der delegierte Rechtsakt
wurde anschließend in der Sachverständigengruppe für
erneuerbare und CO2-arme Kraftstoffe am 7. November 2024 und
am 19. Mai 2025 zweimal mit Sachverständigen der
Mitgliedstaaten erörtert.
|
|
Wissenschaft, die ankommt |
|
Oberhausen/Duisburg, 4. Juli 2025 - Zum
16. Mal hat der Förderverein des Fraunhofer UMSICHT den
UMSICHT-Wissenschaftspreis verliehen. Einmal mehr standen
Menschen im Mittelpunkt, die mit ihrer Arbeit dafür sorgen,
dass wissenschaftliche Themen verständlich kommuniziert und
von der Gesellschaft verstanden und anerkannt werden.
In der Kategorie Wissenschaft ging die Auszeichnung an
Dr.-Ing. Jakob Ungerland. Er leistet einen wichtigen Beitrag
zur Erforschung eines nachhaltigen und gleichzeitig
zuverlässigen Energiesystems. In der Kategorie Journalismus
sah die Jury Daniel Hautmann und seinen Artikel über Pro und
Contra von Offshore-Windparks sowie Dagmar Röhrlich und ihr
Feature über die zukünftigen Chancen für bezahlbare
Geothermie vorn.

Herzlichen Glückwunsch!
© Fraunhofer UMSICHT/Ilka Drnovsek
Von links: Daniel Hautmann, Dagmar Röhrlich, Prof. Dietrich
Grönemeyer und Dr.-Ing. Jakob Ungerland
© Fraunhofer UMSICHT/Ilka Drnovsek
UMSICHT-Wissenschaftspreis 2025
Solar- und Windenergie, grüner Wasserstoff, Elektromobilität,
aber auch immer häufigere Technologiesprünge und die
Notwendigkeit einer Kreislaufwirtschaft – das stellt uns vor
teils große Herausforderungen und beeinflusst unseren Alltag.
Eine gute Zusammenarbeit der Beteiligten ist essenziell für
den erfolgreichen Weg in Richtung Klimaneutralität. Und eine
entsprechende Kommunikation.

Denn nur, wer gut und vor allem richtig informiert ist, hat
Vertrauen und kann die Potenziale von Innovationen verstehen.
Der Förderverein des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-,
Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT setzt sich genau
dafür ein und zeichnet Wissenschaftler*innen und
Journalist*innen mit dem UMSICHT-Wissenschaftspreis aus, die
Forschungsergebnisse zu den Themen Umweltschutz und
Nachhaltigkeit der Allgemeinheit zugänglich machen.
Die einzelnen Preise sind mit je 2500 Euro dotiert. Ein Blick
auf das Programm der diesjährigen Preisverleihung versprach
bereits im Vorfeld einen interessanten Nachmittag am
Oberhausener Forschungsinstitut Fraunhofer UMSICHT – und das
Versprechen wurde vollends erfüllt. Auch Ina Brandes,
Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen, richtete eine Grußbotschaft an die
Anwesenden.
Kategorie Journalismus Print/Online: Daniel Hautmann
Der Preisträger Daniel Hautmann arbeitet als freier Autor und
Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine. Zudem ist
er Mitgründer des Audio-Labels Honig&Gold, mit dem er
Podcasts produziert und live auf die Bühne bringt. Sein
thematischer Fokus liegt auf Technologien, die Fortschritt
und Nachhaltigkeit verbinden.
Den UMSICHT-Wissenschaftspreis 2025 erhielt Daniel Hautmann
für seinen Artikel »Segen oder Sauerei?«, veröffentlicht im
P.M. Magazin. Er geht darin auf die ökologischen Auswirkungen
von Offshore-Windparks ein. Die Windfarmen tragen nicht nur
zur Stromproduktion bei, sondern bieten auch Rückzugsräume
mit reichlich Nahrungsangebot für bedrohte Tierarten wie den
Kabeljau.
»Im Rahmen meiner Recherche habe ich mit zahlreichen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über die Flora und
Fauna im Umfeld von Offshore-Windkraftanlagen gesprochen«, so
Daniel Hautmann. Neben den positiven Effekten gibt es
allerdings auch Bedenken zu langfristigen Auswirkungen durch
die Veränderungen der Ökosysteme.
Naturschützer etwa sorgen sich um Schweinswale und Zugvögel,
die Fischerei um ihre Fanggebiete. Beispiele zeigen, dass die
Mehrfachnutzung der Gebiete eine Lösung sein könnte. »Eins
steht fest: Durch den massiven Windkraft-Ausbau werden sich
Nord- und Ostsee wandeln. Wie genau, das ist heute noch gar
nicht absehbar und bedarf langfristiger Beobachtungen – auch
um nachhaltig handeln zu können.«
Kategorie Journalismus Audio/Video: Dagmar Röhrlich
»Billiger Bohren – High-End-Technologie für eine bezahlbare
Geothermie« lautet der Titel des Features im Deutschlandfunk,
für das Dagmar Röhrlich ausgezeichnet wurde. Die freie
Wissenschaftsjournalistin beleuchtet darin die
Herausforderungen und Fortschritte in der Geothermie,
insbesondere in der Tiefbohrtechnik.
»Die Nutzung von Erdwärme zur Erreichung der Klimaziele hat
ein enormes Potenzial. Das zeigt z. B. das Projekt FORGE in
Utah, bei dem Wärme nur durch das Gestein übertragen wird«,
erklärt Dagmar Röhrlich. Demgegenüber stehen jedoch die hohen
Bohrkosten und das Risiko, dass eine Lagerstätte nicht die
ausreichende Quantität oder Qualität aufweist. Expertinnen
und Experten aus verschiedenen Institutionen sprechen im
Fearture über aussichtsreiche neue Bohrmethoden.
Hierzu zählen etwa Elektroimpulsbohren oder Plasmabohren,
aber auch KI-gestützte Vorhersagen, die die Effizienz
steigern und gleichzeitig die Kosten senken könnten.
»Letztendlich hängt der Erfolg der Geothermie von der
Marktakzeptanz und der Investitionsbereitschaft ab«, fasst
Dagmar Röhrlich zusammen.
Kategorie Wissenschaft: Dr.-Ing. Jakob Ungerland
Der Wissenschaftler Jakob Ungerland hat an der Universität
Stuttgart und am Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesysteme ISE promoviert und beschäftigt sich mit
zukunftsfähigen Energiesystemen. Für seine Publikation im
Journal Energy Technology »Evaluation of Equivalent Dynamic
Active Distribution Network Models with Individual and
Aggregated Consideration of Grid Forming Converters« gab es
den UMSICHT-Wissenschaftspreis 2025.
Im Kern steht die Frage, wie ein ausschließlich auf
erneuerbaren Energien basierendes Energiesystem stabil und
ohne Blackouts betrieben werden kann. Jakob Ungerland
beschreibt die von ihm entwickelte Methodik zur praktikablen
dynamischen Modellierung von Verteilnetzen. »Genau dort
finden in Zukunft die Energieerzeugung und die
Systemstabilisierung statt. Und eine detaillierte
Verteilnetzmodellierung ist zu komplex und
Stabilitätsanalysen sind damit zu zeitaufwendig bzw. gar
nicht möglich«, erklärt Jakob Ungerland.
Seine Forschungsarbeit ermöglicht erstmals aussagekräftige
Stabilitätsstudien, die die Basis bilden für den
Strategieplan hin zu einem erneuerbaren Energiesystem.
Profiteure sind beispielsweise Netzplanungsabteilungen bei
den Netzbetreibern, die Bundesnetzagentur oder
Forschungseinrichtungen. Darüber hinaus kann mit der neuen
Methodik auch die optimale Integration stabilisierender
netzbildender Umrichter in ein Verteilnetz effizient
untersucht werden.
|
|
Schwimmendes Labor - Forschungsschiff NOVA getauft |
|
Duisburg, 23. Mai 2025 - Mit
glänzenden Solarzellen auf dem Dach und einem nahezu
verwaistem Steuerstand ist die NOVA alles andere als ein
gewöhnliches Schiff. Der Katamaran ist eine schwimmende
Forschungsplattform. An Bord erarbeiten Wissenschaftler:innen
der Universität Duisburg-Essen und des JRF-Instituts
Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme
(DST) zukunftsfähige Konzepte: Wie können alternative
Antriebe die Umwelt entlasten? Und wie lässt sich die
Schifffahrt sicher autonom betreiben? NOVA wurde heute
feierlich durch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer in
Ruhrort getauft.

Die NOVA bei einer Testfahrt in
Duisburg / Copyright Ilja Höpping, Stadt Duisburg
„Wir wollen das automatisierte
Fahren von Schiffen unter realen Bedingungen untersuchen –
dort, wo es eng, unübersichtlich und voll sein kann“, erklärt
Prof. Dr. Bettar el Moctar vom Institut für Nachhaltige und
Autonome Maritime Systeme (INAM) der Universität
Duisburg-Essen. Im Gegensatz zu Teststrecken ist die
Verkehrsdichte in Häfen und insbesondere auf dem Rhein hoch.
„Stoppmanöver einleiten, Kurs
ändern oder Kurs halten? Entscheidungen wie diese muss die
NOVA künftig selbst treffen – auch bei Nebel, Dunkelheit oder
hoher Verkehrsdichte.“ Dafür wird der 15 Meter lange
Katamaran mit sämtlicher Technik ausgerüstet, die für eine
vollständig automatisierte Fahrt nötig ist – einschließlich
komplexer Manöver wie Schleusenfahrten.
Angetrieben wird NOVA dabei rein
elektrisch. Die Energie liefern Akkus und eine Solaranlage
auf dem Dach. „Wir analysieren, wie sich unterschiedliche
Fahrweisen auf den Energieverbrauch auswirken – und wie sich
durch Automatisierung Kraftstoff und Emissionen einsparen
lassen“, so Dr. Jens Neugebauer, Oberingenieur am INAM.
NRW-Umweltminister Oliver
Krischer betont: „Mit dem innovativen Forschungsschiff NOVA
können zukunftsweisende Technologien praxisnah entwickelt und
erprobt werden. Wir bauen damit Nordrhein-Westfalens Position
als führender Forschungsstandort für eine nachhaltige
Binnenschifffahrt aus. Das trägt zum Klimaschutz bei und
stärkt die wirtschaftliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit
der Binnenschifffahrt als moderner Verkehrsträger."
„Dass das Forschungsschiff NOVA
hier in Duisburg zum Einsatz kommt, ist kein Zufall. Mit dem
größten Binnenhafen der Welt bieten wir für die Zukunft der
Binnenschifffahrt ein einzigartiges Erprobungsfeld“, sagt
Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg. „Damit
setzen wir nicht nur Impulse für Wissenschaft und Wirtschaft,
wir zeigen auch, dass wir hier in Duisburg Wandel klug und
nachhaltig gestalten.“
Auch die Rektorin der Universität
Duisburg-Essen, Prof. Dr. Barbara Albert, lobt das Projekt:
„Die NOVA steht exemplarisch für die Innovationskraft unserer
Universität – hier verbinden sich Spitzenforschung,
Nachhaltigkeit und technologischer Fortschritt auf
beeindruckende Weise.“
Der wissenschaftliche Vorstand
der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF) und Präsident
des Wuppertal Instituts Prof. Dr. Manfred Fischedick macht
deutlich: „Die Entwicklung und der Betrieb des innovativen
Forschungsschiffs NOVA sind ein Paradebeispiel für die
Philosophie der JRF. Sie hat sich mit ihren 15
Mitgliedsinstitutionen Forschung ‚Made in NRW‘ für
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik auf die Fahnen
geschrieben und steht für transferorientierte Forschung und
den Brückenschlag zwischen universitärer Forschung und der
Praxis.“
Das Projekt wird durch das
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen mit 1,17 Millionen Euro gefördert. Es
arbeiten hier das Institut für Nachhaltige und Autonome
Maritime Systeme, der Lehrstuhl für Mechatronik und das DST
zusammen. Das DST ist ein An-Institut der Universität
Duisburg-Essen und Mitglied der
Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF).
|
|
Forschungsschiff Nova wird in Ruhrort getauft
|
|
Duisburg, 21. Mai 2025 - Mit
glänzenden Solarzellen auf dem Dach und einem nahezu
verwaisten Steuerstand ist die „Nova“ alles andere als
ein gewöhnliches Schiff. Die „NOVA“ ist ein 15 Meter
langer Katamaran, optimiert für den Einsatz auf
Binnengewässern und im küstennahmen Bereich – auch bei
extremen Niedrigwasserständen.
An Bord erarbeiten
Wissenschaftler:innen der Universität Duisburg-Essen und
des Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und
Transportsysteme (DST) zukunftsfähige Konzepte: Wie
können alternative Antriebe die Umwelt entlasten? Und wie
lässt sich die Schifffahrt sicher autonom betreiben?
Die Schiffstaufe wird im Duisburger Hafen durch Oliver
Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen, vorgenommen. Die „NOVA“
ist ein 15 Meter langer Katamaran, optimiert für den
Einsatz auf Binnengewässern und im küstennahmen Bereich –
auch bei extremen Niedrigwasserständen.
Sie dient als Plattform für Forschung zum automatisierten
Fahren und zur Erprobung emissionsfreier Antriebe. Voll
ausgestattet mit Sensorik, ferngesteuert oder zukünftig
autonom unterwegs, eröffnet die „NOVA“ neue Wege
nachhaltiger Schifffahrt. Das Projekt wird durch das
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des
Landes Nordrhein-Westfalen mit 1,17 Millionen Euro
gefördert.

Forschungsschiff Nova/ Copyright Rupert Henn, DST
Mitten im
geschäftigen Trubel des Duisburger Hafens und auf dem vielbefahrenen
Rhein soll die Zukunft der Binnenschifffahrt erprobt werden – dort,
wo die Realität eng, unübersichtlich und voller Herausforderungen
ist. Kein steriles Testgelände, sondern ein echtes Verkehrschaos mit
Frachtschiffen, Sport- und Ruderbooten bildet die Bühne für den 15
Meter langen Katamaran „Nova“.
Er soll künftig selbstständig
durch dieses Gewusel navigieren – und das auch bei schlechten
Sichtverhältnissen, dichtem Gegenverkehr oder komplexen Manövern wie
dem Durchqueren von Schleusen. Ausgestattet mit modernster Technik
für automatisierte Fahrten, muss das Schiff in Echtzeit
Entscheidungen treffen: bremsen, ausweichen oder Kurs halten?
Die „Nova“ wird dabei rein elektrisch betrieben – gespeist von
Akkus und einer Solaranlage auf dem Dach. Parallel zur Navigation
wird auch der Energieverbrauch genau unter die Lupe genommen. Ziel
ist es, herauszufinden, wie sich automatisiertes Fahren auf
Effizienz und Emissionen auswirkt – und wie sich der Verkehrssektor
auf dem Wasser nachhaltiger gestalten lässt.
|
|
Innovationsmesse für die
Logistik der Zukunft am 20. Mai in Duisburg war ein
voller Erfolg
|
|
Duisburg, 21. Mai 2025 - Die vierte Ausgabe der Innovationsmesse
FUTURE LOGISTICS bringt internationale Logistikszene nach Duisburg.
300 Messebesucher:innen erleben internationale Innovationen rund um
die Fokusthemen Automatisierung und Robotik in einzigartiger
Museumsatmosphäre.
Am 20. Mai 2025 fand im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt in
Duisburg die vierte Ausgabe der Innovationsmesse FUTURE LOGISTICS
statt. Knapp 300 Teilnehmende kamen zusammen, um sich inmitten
historischer Schiffe über die neuesten technologischen Entwicklungen
in der Logistik auszutauschen.

Das Motto in diesem Jahr: Automation & Robotics – mit einem
besonderen Fokus auf die Internationalisierung der Logistikbranche.
Organisiert wurde die Messe von der startport GmbH, der
Innovationsplattform des Duisburger Hafens (duisport). Ziel ist es,
Startups mit Unternehmen, Investoren und Forschungseinrichtungen zu
vernetzen und Innovationen in die logistische Praxis zu bringen.
Ein starkes Signal für Internationalisierung
Ein besonderes Highlight der diesj‰hrigen Messe war die neu
eingeführte Internationale Sonderausstellung im Obergeschoss des
Museums. Hier präsentierten sich Startups aus Belgien, den
Niederlanden, Dänemark und der Türkei mit innovativen Lösungen zur
Automatisierung, KI und Prozessoptimierung.
Ergänzt wurde die Ausstellung durch ein starkes, teils
englischsprachiges Bühnenprogramm, das den internationalen Charakter
der Veranstaltung unterstrich – u. a. bei der Panel Discussion
“Crossing Borders: International Startups and the German Market”.
Impulse, Panels und Podcast
Auch auf der Hauptb¸hne drehte sich alles um die Zukunft der
Logistik. Die Teilnehmenden konnten sich u. a. freuen auf:
• die Keynote von Michal Hendel-Sufa (Principal, theDOCK) über
globale Innovationsdynamiken,
• ein hochkarätiges Panel mit Victor Kaupe (BASF) und Holger
Schneebeck (DHL),
• den Live-Podcast „Felgendreher & Friends“ mit Knut Alicke
(McKinsey), Erik Wirsing (DB Schenker) und Frank Vorrath (Danfoss),
• sowie praxisnahe Success Stories, etwa zur Einführung von
Motion-Mining-Technologie bei avitea Industrieservice.
Startup Guided Tours, Matchmaking und Networking mit Eis
Ein weiteres Highlight waren die dreimal täglich stattfindenden
Startup Guided Tours mit Live-Pitches, Q&A-Sessions und
themenspezifischen Schwerpunkten. Über die b2match-App konnten sich
G‰ste bequem zur Tour anmelden, Gespräche vereinbaren und gezielt
vernetzen. Auch beim Networking überzeugte die Veranstaltung mit
liebevollen Details: Neben einer Candybar in der internationalen
Ausstellung war vor allem das Eisfahrrad im Hof ein Publikumsmagnet
– natürlich auch mit veganer Variante.
Save the Date: Mai 2026 Jessica Friedrich, Communication Managerin
bei startport, zieht ein positives Fazit: „Wir sind stolz auf die
Weiterentwicklung von FUTURE LOGISTICS – besonders die neue
Internationalit‰t und die starke Bühne zeigen, dass die Community
wächst und offener für neue Perspektiven wird.
Ein Dank ging an unsere Flottenförderer, die die diesjährige Ausgabe
der FUTURE LOGISTICS mit ihrem Engagement ermöglicht haben:
EMO-LOG GmbH, Weiss+Appetito Gruppe, LiveCharger, CANCOM, BASF
Coatings, SCIO Automation, ZENIT GmbH, EEN NRW / NRW.Europa,
Kuehne+Nagel, Sinalco International Brands GmbH & Co. KG,
Rheinfels-Quellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG
Dank galt den Partnern aus der Logistikbranche, die durch ihre
Netzwerke, Zusammenarbeit und Reichweite zum Erfolg der Messe
beigetragen haben: duisport - Duisburger Hafen AG, Duisburg Business
& Innovation GmbH, Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AÖR, EY, avitea
GmbH, DeltaPort GmbH & Co. KG, Rhenus Logistics, Yusen Logistics,
TanQuid GmbH & Co. KG, Haeger & Schmidt Logistics, Weiss+Appetito
Gruppe, EY, DIT Duisburg Intermodal Terminal GmbH, avitea
Industrieservice GmbH, Dortmunder Hafen AG, M. Zietzschmann GmbH &
Co. KG, Dortmunder Eisenbahn GmbH, Captrain Deutschland-Gruppe
Die nächste Ausgabe von FUTURE LOGISTICS ist bereits in
Planung – wie immer im Mai. Das genaue Datum wird in
Kürze über die Social-Media-Kanäle von startport und auf
der EventWebsite bekanntgegeben.
startport im Überblick
Die startport GmbH engagiert sich als Tochtergesellschaft
des Duisburger Hafens dafür, eine kreative
Innovationskultur zu initiieren und die Weiterentwicklung
im Bereich Logistik und Supply Chain aktiv
voranzutreiben. Mit diesem Anspruch fördert und fordert
sie junge Startups, die gemeinsam mit duisport und den
hier angesiedelten Unternehmen zukunftsweisende Ideen für
die f¸hrende Logistikdrehscheibe im Herzen Europas
entwickeln.
|
|
Stahlwerksschlacken für die Solarenergie
|
|
Oberhausen/Duisburg, 13. Mai 2025 - Das
neue Forschungsprojekt STARS ist mit einem Kick-off im März
mit dem Ziel gestartet, in den nächsten drei Jahren
Stahlwerksschlacken als Ausgangsstoff zur Herstellung
hochwertiger Endprodukte für solarthermische Prozesse nutzbar
zu machen. Die Projektpartner Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) (Leitung), thyssenkrupp MillServices &
Systems GmbH und die LWK-PlasmaCeramic GmbH forschen an
nachhaltigen Lösungen für eine grüne Kreislaufwirtschaft.
Fraunhofer UMSICHT bewertet die neu zu entwickelnden Produkte
und Verfahren ökologisch. Das Projekt wird von der EU und dem
Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und
Energie des Landes NRW gefördert.
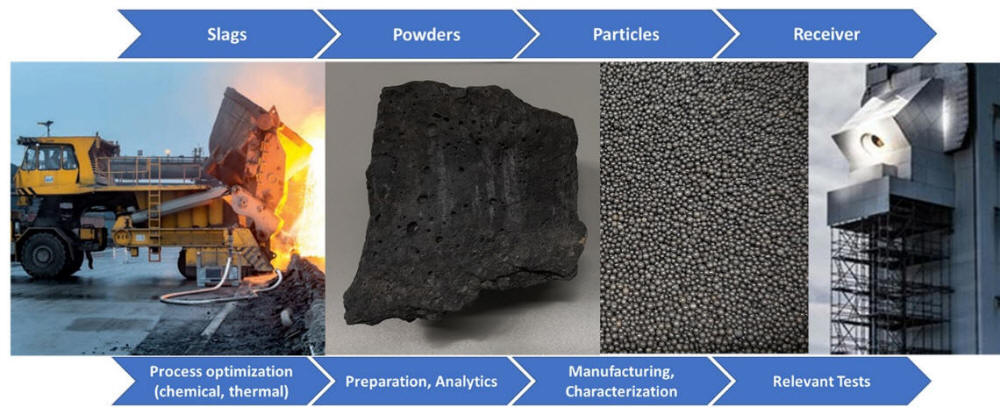
Das Projekt STARS ist gerade gestartet und möchte
Stahlwerksschlacken als Ausgangsstoff für hochwertige
Endprodukte für Solarenergie nutzen.
© DLR
Das Projekt wird von der EU und dem Ministerium für
Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW
gefördert. Eine grüne Kreislaufwirtschaft erfordert
nachhaltige Energie- und Stoffströme und dekarbonisierte
Industrieprozesse. Nur so können die Ziele des Pariser
Klimaabkommens zur Senkung der Treibhausgasemissionen
erreicht werden.
Im Projekt STARS – solarthermische Anwendungen für
sekundäre Rohstoffe aus der Stahlerzeugung – forschen die
vier Projektpartner an nachhaltigen Lösungen für
zukunftsfähige Energiespeichermaterialien. Ziel ist es,
Stahlwerksschlacken als Sekundärrohstoffe für keramische
Komponenten und Energieträgermaterial in der konzentrierenden
Solarthermie (Concentrated Solar Thermal- CST)
zu nutzen.
Die CST versucht, mittels Spiegeln und durch besondere Träger
ein verbessertes Solar-Wärme-Verhältnis der Solarenergie zu
gewährleisten. Neben der energetischen Effizienz sind dabei
vor allem auch produktbezogene Merkmale wie z.B. Komponenten
mit gleichbleibender Qualität und langer Lebensdauer,
recyclingfähige Komponenten oder Hochtemperaturmaterialien
besonders relevant. Expertise bei LCA von Schlackenverwertung
Hier setzt das Projekt STARS an.
Die Projektpartner verarbeiten die Stahlwerksschlacken zu
Partikeln als thermische Energiespeicher, zu keramischen
Beschichtungen und weiteren Komponenten für solarthermische
Prozesse. thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH bereitet
die Stahlwerksschlacken für die entsprechenden
Anwendungszwecke auf. Das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) und die LWK-PlasmaCeramic GmbH verarbeiten
diese mittels Granulation, Vertropfung und Sintering bzw.
Plasma-Coating innovativen
Produkten.
Das DLR wertet die technischen Eigenschaften der Produkte
aus, während Fraunhofer UMSICHT die neuen
Herstellungsprozesse und -komponenten in ihrem frühen
Entwicklungsstadium aus ökologischer Sicht bewertet. Hier
fließen die bestehenden Erfahrung in der Bewertung von
Schlackenverwertungskonzepte ein.
|
|
Maximaler Komfort für unterwegs – Das neue
Gazelle Arroyo C8+ Elite
|
|
Dieren,
Niederlande, 15. April 2025 – Gazelle bringt das rundum
erneuerte Modell Arroyo C8+ Elite auf den Markt. Die
aufrechte Sitzhaltung, die sanfte Unterstützung und der tiefe
Einstieg sorgen für maximalen Komfort und machen jede Fahrt
zum Vergnügen. Die Kombination aus Scheibenbremsen und
Rücktrittbremse garantiert Sicherheit bei Bremsmanövern. Die
Integration von Kabeln, Akku und Beleuchtung verleiht dem
Arroyo ein elegantes und durchdachtes Design.

Elegantes Rahmendesign
Der Rahmen des Arroyo C8+ Elite punktet mit Stabilität und
eleganter Optik. Die Kombination aus organischen und
markanten Designelementen sowie die Integration der
Komponenten sorgen für ein harmonisches Gesamtbild. Der
Mittelmotor ist nahtlos in den Rahmen integriert, der Akku
elegant im Unterrohr verborgen. Ein weiteres Designdetail ist
der im Schutzblech integrierte 70 Lux Scheinwerfer mit
Akkubetrieb, der besonders robust konstruiert ist.
Einfach in Fahrt
Mit dem tiefen Einstieg ist das Auf- und Absteigen mühelos.
Während der Fahrt sorgt die bequeme, aufrechte Sitzposition
für das ultimative Hollandrad-Feeling. Der kraftvolle Bosch
Smart System Active Line Plus Mittelmotor sorgt für eine
natürliche und leise Unterstützung. Mit einer Leistung von 50
Nm bleibt das Treten stets angenehm – ideal für Stadtfahrten
oder längere Touren.
Intelligent positionierte Ladebuchse
Der integrierte Bosch-Akku ist mit einem Schloss im Unterrohr
gesichert. Er kann separat oder direkt am Fahrrad aufgeladen
werden. Das Arroyo C8+ Elite verfügt über eine intelligent
platzierte Ladebuchse, so dass der Akku nicht entnommen
werden muss. Ein weiteres praktisches Detail: Die
verbleibende Akkukapazität lässt sich bequem auf der
Oberseite des Akkus ablesen. Mit einer Kapazität von 600 Wh
bietet der Akku eine hohe Reichweite.
Zuverlässige Schaltung
Ob Wochenendtour oder das tägliche Pendeln zur Arbeit – das
Arroyo C8+ Elite bietet viele Vorteile. Es verfügt über die
bewährte Nexus 8-Gang-Nabenschaltung von Shimano, die für
sanfte und präzise Schaltvorgänge steht. Die Kombination aus
Riemenantrieb und geschlossener Kettenführung macht das Rad
besonders wartungsarm und langlebig.
Sicheres Bremsverhalten
Das Arroyo C8+ Elite ist sowohl mit einer Rücktrittbremse als
auch mit hydraulischen Scheibenbremsen von Tektro
ausgestattet. Ob beim Bergabfahren oder bei plötzlichen
Stopps im Stadtverkehr – die hydraulischen Scheibenbremsen
sorgen für ein sicheres und schnelles Stoppen. Ein großer
Vorteil der Scheibenbremsen ist, dass sie bei allen
Witterungsbedingungen optimal funktionieren und eine exakte
Dosierung der Bremskraft ermöglichen.
Hochwertige Verarbeitung
Gazelle hat beim Design des Arroyo C8+ Elite besonderen Wert
auf eine luxuriöse Verarbeitung gelegt. Dies zeigt sich nicht
nur in der Integration von Systemen und Komponenten, sondern
auch in deren erstklassiger Qualität. So verfügt das E-Bike
über hochwertige Ledergriffe und einen komfortablen Selle
Royal Lena Sattel.
Die Federgabel sowie die gefederte Sattelstütze sorgen für
eine ruhige Fahrt, auch auf Straßen mit vielen Unebenheiten.
Das abnehmbare Bosch Kiox 300 Display bietet zahlreiche
smarte Funktionen und lässt sich bequem per Bluetooth
steuern. Wer sich für das Arroyo C8+ Elite entscheidet, wählt
eleganten Komfort.
Rahmenvarianten und Farben
Gazelle bietet das Arroyo C8+ Elite in den stilvollen Farben
Black Matt und Twilight Green Matt an. Das Modell ist sowohl
mit hohem als auch mit tiefem Einstieg erhältlich.
Das Arroyo C8+ Elite ist ab sofort verfügbar.
Über Koninklijke Gazelle
Koninklijke Gazelle stellt seit mehr als 130 Jahren
hochwertige und komfortable Fahrräder in der Stadt Dieren, in
Gelderland, Niederlanden her. Gazelle arbeitet jeden Tag hart
daran, das Radfahren attraktiver und sicherer zu machen. Das
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen zu
motivieren, so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad
zurückzulegen. Deshalb ist Gazelle bestrebt, das smarte
holländische Design und technische Innovationen immer weiter
voranzubringen. Auch in Sachen Nachhaltigkeit ist Gazelle
stets auf der Suche nach neuen Ansätzen. Im Unternehmen
selbst, aber auch darüber hinaus. Für weitere Informationen:
https://www.gazelle.de
.
|
|
Forschung vernetzt gestalten
|
|
Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF)
Jahresfeier 2025
Duisburg, 8. April 2025 - Am 7.
April 2025 hat die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF)
Mitglieder, Förderer, Partner, Freundinnen und Freunde sowie
Interessierte zur Jahresfeier nach Düsseldorf eingeladen. Die
Veranstaltung bot wie stets Raum für persönliche Begegnungen,
Austausch und neue Impulse zur Rolle außeruniversitärer
Forschung in Nordrhein-Westfalen.
In ihrem Grußwort würdigte Ina Brandes, Ministerin für Kultur
und Wissenschaft des Landes NRW, die Arbeit der JRF und
betonte die Bedeutung der Gemeinschaft für den
Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen: „Auf das, was die
JRF, was Sie alle in den Instituten, in der Geschäftsstelle,
im Vorstand und im Kuratorium erreicht haben, können Sie
stolz sein.
Als einziges deutsches Bundesland hat Nordrhein-Westfalen mit
der JRF eine solche Gemeinschaft von außeruniversitären
Forschungseinrichtungen. Gemeinsam stärken wir den
Forschungs- und Innovationsstandort Nordrhein-Westfalen und
vertreten seine Interessen nach außen. Das Land steht bei der
weiteren Entwicklung der JRF in diesen herausfordernden
Zeiten in jedem Fall auf Ihrer Seite!“

V.l.: Prof. Wolfgang Boos (FIR), Prof. Manfred Fischedick
(WI), Ramona Fels (JRF), Ministerin Ina Brandes, Prof. Dieter
Bathen (JRF), Prof. Anna-Katharina Hornidge, Prof. Bert
Bosseler (IKT) © JRF e.V.
Einblicke in das vergangene Jahr und die strategische
Entwicklung der JRF gaben die Vorstandsmitglieder Professor
Dieter Bathen und Ramona Fels. Ergänzend präsentierten die
Leitthemensprecherinnen und -sprecher in kurzen
Impulsvorträgen die themenübergreifende Zusammenarbeit der
JRF-Institute entlang der vier Leitthemen: Städte &
Infrastruktur, Gesellschaft & Digitalisierung, Industrie &
Umwelt sowie Globalisierung & Integration.
Ein Höhepunkt des Abends war die feierliche Verleihung des
JRF-Dissertationspreises 2025. Das Kuratorium der JRF,
vertreten durch seine stellvertretende Vorsitzende
Professorin Birgitt Riegraf, ehrte Dr. Jonas Zinke vom
JRF-Institut Energiewirtschaftliches Institut an der
Universität zu Köln (EWI) für seine herausragende
Dissertation mit dem Titel „On Market Designs for the
Transition of Power Systems towards Climate Neutrality“.
Die Arbeit von Dr. Zinke widmet sich der Integration
erneuerbarer Energien in den Strommarkt und leistet einen
wichtigen Beitrag zur Energiewende. Besonders überzeugte der
interdisziplinäre Ansatz, der ingenieur- und
wirtschaftswissenschaftliche Perspektiven zusammenführt.
Im Rahmen der Feier wurde außerdem Karl Schultheis,
langjähriger Vorsitzender des JRF-Kuratoriums, für seine
Verdienste mit der Ehrenmitgliedschaft im Kuratorium
ausgezeichnet. Sein Nachfolger als Vorsitzender des
Kuratoriums ist Raphael Tigges, wissenschaftspolitischer
Sprecher der CDU-Fraktion im NRW-Landtag. Beide Ehrungen
wurden in feierlicher Atmosphäre vor den Gästen der
Jahresfeier begangen.
Im Anschluss an den offiziellen Teil lud die JRF zum Empfang
im Haus der Wissenschaft ein – eine Gelegenheit zum
Austausch, zur Vernetzung und zur Vertiefung der Gespräche
des Abends
Die
Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft ist die
Forschungsgemeinschaft des Landes NRW. Aktuell zählt sie 15
wissenschaftliche Institute mit mehr als 1.600
MitarbeiterInnen in NRW und einem Jahresumsatz von über 144
Millionen Euro.Gegründet hat sich der gemeinnützige Verein
2014 als Dachorganisation für landesgeförderte, rechtlich
selbstständige, außeruniversitäre und gemeinnützige
Forschungsinstitute.
Unter dem
Leitbild „Forschung ‚Made in NRW‘ für Gesellschaft,
Wirtschaft, Politik“ arbeiten die JRF-Institute
fachübergreifend zusammen, betreiben eine gemeinsame
Öffentlichkeitsarbeit, fördern wissenschaftlichen Nachwuchs
und werden von externen Gutachter*innen evaluiert. Neben den
wissenschaftlichen Mitgliedern ist das Land NRW ein
Gründungsmitglied, vertreten durch das Ministerium für Kultur
und Wissenschaft.
|
|
Fortschritte in der automatisierten Verarbeitung von
Metallrohren |
|
Projektabschluss KIMETRO
Duisburg, 19. März 2025 - Erfolgreicher Abschluss: Mit einem
Treffen des ZaKI.D-Projektteams und der Firma Häuser & Co.
GmbH am 7. März 2025 wurde das erste Umsetzungsprojekt
KIMETRO des Zentrums für angewandte Künstliche Intelligenz
(ZaKI.D) erfolgreich beendet. Das Team unter Leitung von Ole
Werger erzielte bedeutende Fortschritte in der
automatisierten Verarbeitung von Metallrohren durch
Künstliche Intelligenz (KI).

Gwen Lengersdorf (ZaKI.D), Ole Werger (ZaKI.D), Andree
Schäfer (Duisburg Business & Innovation GmbH), Hendrik Häuser
(Häuser & Co. GmbH) und Julien Hoever (ZaKI.D) beim Treffen
zum Projektabschluss. ® ZaKI.D
Das Zentrum für angewandte Künstliche Intelligenz Duisburg
(ZaKI.D) hat sich zum Ziel gesetzt, fortschrittliche
KI-Technologien in die industrielle Praxis zu integrieren und
somit die Wettbewerbsfähigkeit von lokalen Unternehmen in und
um Duisburg zu steigern. In verschiedenen Umsetzungsprojekten
soll dieser Wissenstransfer gelingen. Das erste Projekt wurde
am Freitag, den 7. März 2025, abgeschlossen.
Zielsetzung von KIMETRO
Im Projekt »KIMETRO« (KI-unterstützte
METallROhr-Beschichtung) wurde eine Machbarkeitsstudie zur
KI-gestützten Erkennung der optimalen Temperatur und Dauer
der Wärmezufuhr auf unterschiedlichen Metallrohren
durchgeführt. Derzeit beurteilen Mitarbeitende die optimale
Verarbeitungstemperatur anhand eines spezifischen Glanzes der
Rohr-Oberfläche.
Künftig soll ein kameragestütztes System diesen Glanz
analysieren und die Metallrohrverarbeitung automatisieren.
Dafür wurden verschiedene Algorithmen des maschinellen
Lernens implementiert und evaluiert, die die Kamerabilder als
Datenquelle nutzen, um möglichst in Echtzeit die optimalen
Verarbeitungsparameter für das Werkstück zu bestimmen. So
wird sichergestellt, dass die Rohre mit gleichbleibender
Qualität produziert werden – vergleichbar mit der Prüfung
durch eine Fachkraft.
Zukunftsperspektiven: Schweißrobotik und neue
Werkstoffanwendungen
Mittelfristig sollen mit der Technologie die wenigen
verfügbaren Fachkräfte entlastet werden. Während des
Projektes wurden zahlreiche Bildreihen von der Verarbeitung
aufgenommen und analysiert. »Die Projektergebnisse bilden
eine solide Basis für zukünftige Anwendungen in der
automatisierten Fertigung, beispielweise für den Einsatz von
maschinellen Schweißrobotern«, sagt wissenschaftlicher
Mitarbeiter und KIMETRO-Projektleiter Ole Werger.
Das entwickelte Modell decke zudem ein großes Spektrum an
Werkstoffen ab, was die Anwendbarkeit der Technologie
erheblich erweitert. »Die KI-Technologie könnte
perspektivisch sogar besser sein als das menschliche Auge und
damit die Basis bilden, neue Werkstofflegierungen zu
entwickeln und verarbeiten zu können. Die Grenzen der
technischen Machbarkeit werden verschoben«, ergänzt
Geschäftsführer Hendrik Häuser.
Das erfolgreich abgeschlossene Projekt, das von
ZaKI.D-Projektleiter Prof. Torben Weis von der Universität
Duisburg-Essen und Andree Schäfer von der Duisburg Business &
Innovation GmbH initiiert wurde, soll nun als »Vorbild« für
zukünftige Umsetzungsprojekte im Rahmen des ZaKI.D-Projektes
dienen. »Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus
menschlicher Expertise und künstlicher Intelligenz die
Zukunft der industriellen Fertigung prägen wird«, fügt Werger
hinzu.
ZaKI.D: Das Zentrum für angewandte Künstliche Intelligenz
Duisburg (ZaKI.D) ist ein wegweisendes Projekt der Stadt
Duisburg. Es erhielt als erstes Projekt im
5-StandorteProgramm eine Förderung über ca. 18 Millionen Euro
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
sowie dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIKE).
Das Projekt konzentriert sich darauf, Künstliche Intelligenz
(KI) auf sehr kleinen Geräten wie Sensoren einzusetzen.
Dadurch können Datenschutzprobleme vermieden, wertvolle
Ressourcen geschont und neue Services direkt in Geräten oder
Maschinen angeboten werden. Ziel ist es, kleinen und
mittleren Unternehmen in der Region zu helfen, KI in ihre
Betriebe und Produkte einzubinden.
Das Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS, die Universität Duisburg-Essen und die
KROHNE Messtechnik GmbH arbeiten gemeinsam an dem Projekt.
Die Stadt Duisburg ist assoziierte Partnerin.
|
|
Herausforderungen und Chancen der Wasserstoffwirtschaft |
|
BVS – Wasserstoff: Hoffnungsträger
oder Hype?
Berlin/Chemnitz, 12. März 2025 - Grüner Wasserstoff, der aus
erneuerbaren Energien hergestellt wird, gilt als
Schlüsseltechnologie für eine klimaneutrale Zukunft. Doch wie
realistisch ist ein rascher Marktdurchbruch – und wie gut
sind Deutschland und Europa aufgestellt? Diese
Fragestellungen standen im Mittelpunkt eines Fachseminars des
BVS e.V. in der Referenzfabrik.H2 des Fraunhofer IWU in
Chemnitz. Wissenschaftliche und industrielle Experten
analysierten die wirtschaftlichen, technischen und
politischen Herausforderungen, die auf dem Weg zu einer
leistungsfähigen Wasserstoffwirtschaft zu bewältigen sind.
Hohe Nachfrage – Begrenztes Angebot
„Die Nachfrage nach grünem Wasserstoff steigt, doch
Produktion und Verfügbarkeit hinken hinterher", erläutert
Dirk Hennig, Bundesfachbereichsleiter Maschinen, Anlagen,
Betriebseinrichtungen beim BVS e.V. „Deutschland benötigt bis
2030 rund 4,5 Mio. Tonnen Wasserstoff – weltweit werden
derzeit lediglich etwa eine Million Tonnen produziert. Unsere
Aufgabe als Sachverständige besteht darin, Innovationen
objektiv zu bewerten und belastbare Fakten für fundierte
Entscheidungen bereitzustellen. Es reicht nicht, lediglich
grüne Wasserstoffprojekte zu fördern – wir müssen die gesamte
Lieferkette wirtschaftlich tragfähig gestalten, um eine
flächendeckende, marktreife Versorgung sicherzustellen.“
Einsatzbereiche und Praxisbeispiele
Obgleich Wasserstoff für viele noch ein abstraktes Thema
darstellt, zeigt sich bereits heute eine vielfältige
Anwendungspraxis:
Mobilität: Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge bieten eine
emissionsfreie Alternative zu herkömmlichen Antriebssystemen
und könnten insbesondere im Schwerlastverkehr von Bedeutung
sein.
Industrie: In der Stahlproduktion ersetzt Wasserstoff
zunehmend kohlenstoffbasierte Reduktionsverfahren und senkt
so die CO₂-Emissionen. Auch in der chemischen
Grundstoffherstellung findet Wasserstoff Anwendung.
Gebäudetechnik: Erste Projekte belegen den Einsatz von
Wasserstoff zur Wärmeversorgung in Wohn- und
Industriegebäuden.
Energieversorgung: Pilotprojekte untersuchen den Einsatz von
Wasserstoffspeichern als integralen Bestandteil der
Sektorenkopplung, also der Verbindung von Strom, Wärme und
Mobilität.
So ambitioniert sind die deutschen Wasserstoff-Ziele
Deutschland verfolgt beim Wasserstoff ambitionierte Ziele. So
soll den aktuellen Plänen der Bundesregierung zufolge bis
2030 eine Erzeugungskapazität von 10 Gigawatt für grünen
Wasserstoff entstehen. In der Referenzfabrik.H2 in Chemnitz
arbeiten Experten an industriellen Lösungen zur
Massenfertigung von Elektrolyseuren und Brennstoffzellen.
„Gleichzeitig stehen wir jedoch vor einigen wesentlichen
Herausforderungen“, so Dr.-Ing. Ulrike Beyer, Expertin für
Wasserstofftechnologien beim Fraunhofer IWU in Chemnitz: „Die
hohen Investitionskosten und begrenzten
Produktionskapazitäten erschweren eine flächendeckende
Versorgung. Zudem erfordert die spezifische Physik von
Wasserstoff neue Sicherheitskonzepte für den Transport und
die Speicherung des Gases. Und nicht zuletzt müssen wir eine
sichere und leistungsfähige Infrastruktur aufbauen, um die
Lieferketten langfristig zu sichern.“
Unabhängige Expertise Sachverständiger als wirtschaftlicher
Impulsgeber
Der BVS e.V., als Verband qualifizierter Sachverständiger,
liefert fundierte und praxisorientierte Bewertungen für
technologische Innovationen. „Wir werden von Unternehmen und
Behörden zu Wasserstofffragen konsultiert – unsere Aufgabe
ist es, faktenbasierte Antworten zu liefern“, erklärt Dirk
Hennig.
Das Fachseminar in Chemnitz verdeutlicht, dass grüner
Wasserstoff großes Potenzial bietet, jedoch nur durch
realistische Planung und wirtschaftliche Skalierbarkeit zu
einem integralen Bestandteil der Energiewende werden kann.
Der BVS e.V. wird diese Diskussion weiterhin aktiv
vorantreiben und sich für eine sachliche, differenzierte
Bewertung der Wasserstofftechnologie einsetzen. In diesem
Rahmen sind bereits weitere Fachveranstaltungen geplant, die
die neuesten Entwicklungen in der Wasserstoffwirtschaft
kritisch begleiten werden.
Über den BVS – Bundesverband öffentlich bestellter und
vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V.
Als bundesweit mitgliedsstärkste Vereinigung öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger gehören dem BVS
rund 3.000 Sachverständige an, organisiert in 12 Landes- und
13 Fachverbänden. Sie sind auf über 250 Sachgebieten tätig
und erfüllen die höchsten Standards im Sachverständigenwesen:
Grundsätzlich sind alle Mitglieder öffentlich bestellt und
vereidigt, anderweitig durch staatliche Stellen oder durch
Gesetz befugte Institutionen hoheitlich beliehen oder
zertifiziert.
https://www.bvs-ev.de/
|
|
Neue Untersuchungen
bestätigen Zusammenhang zwischen Weichmachern in Kinderurin
und Verwendung von Sonnenschutzmitteln
|
|
Duisburg, 25. Februar 2025 -
Maßnahmenpaket eingeleitet: Hersteller und Überwachungsbehörden
arbeiten an Minimierung – bundesweites Monitoring –
Sonnenschutzcremes sollten weiter verwendet werden
Aktuelle Untersuchungsergebnisse des Landesamtes für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz (LANUV) sowie der Chemischen und
Veterinäruntersuchungsämter (CVUÄ) in Nordrhein-Westfalen bestätigen
den Zusammenhang, dass der Weichmacher DnHexP (Di-n-hexyl-Phthalat)
aus Verunreinigungen im UV-Filter DHHB
(Diethylamino-hydroxybenzoyl-hexyl-benzoat) in Sonnenschutzmitteln
stammt.
Bisher untersuchte Sonnenschutzmittel wiesen teilweise
Verunreinigungen mit dem Weichmacher DnHexP auf. Dies zeigt sich
auch in den Kinderurin-Untersuchungen des LANUV. Die Belastungen
liegen jedoch für über 99 Prozent der 250 untersuchten Kinder
unterhalb der Schwelle für eine gesundheitliche Besorgnis. Somit ist
die Verwendung von Sonnenschutzmitteln in der Regel sicher. Aus
Gründen der Vorsorge muss aber sichergestellt sein, dass
Sonnenschutzmittel nicht mit DnHexP verunreinigt sind.
Die nordrhein-westfälischen Behörden haben außerdem zusammen mit
Kosmetikherstellern, vertreten durch die Fachverbände,
herausgefunden, dass es möglich ist, Sonnenschutzmittel so
herzustellen, dass der UV-Filter DHHB frei von Verunreinigungen ist.
Deshalb wurden Hersteller dazu aufgefordert, vorsorglich ihre
Produktion so umzustellen, dass keine schädlichen Weichmacher mehr
messbar sind.
Alle Bewertungen sind weiterhin vorläufig, da die bundesweit
laufende Ursachenforschung noch nicht abgeschlossen ist. Im
laufenden Jahr soll es ein neues bundesweites Monitoring geben, um
einen neuen Orientierungswert für die technische Vermeidbarkeit von
DnHexP im UV-Filter DHHB abzuleiten.
•
Ergebnisse der Kinderurin-Untersuchungen des LANUV (KiSA-Studie)
Das LANUV untersucht regelmäßig im Auftrag des Umweltministeriums
Nordrhein-Westfalen den Urin von 250 Kindern im Alter von zwei bis
sechs Jahren auf verschiedene Schadstoffe wie Weichmacher, Pestizide
oder Konservierungsmittel. Im Januar 2024 hatte das Landesamt
erstmals Mono-n-hexyl-Phthalat (MnHexP), ein
Stoffwechselabbauprodukt des Weichmachers DnHexP, im Kinderurin
gefunden.
Der Weichmacher DnHexP darf seit 2019 nicht mehr in kosmetischen
Mitteln enthalten sein, weil er im Verdacht steht, die Fruchtbarkeit
zu schädigen. In einer früheren Auswertung des LANUV vom März 2024
konnte bereits gezeigt werden, dass es einen Zusammenhang zwischen
der Nutzung von Sonnencreme und erhöhten MnHexP-Belastungen im Urin
der Kinder gibt.
Das LANUV hat daraufhin im Jahr 2024 zwei weitere Nachweisverfahren
geführt, die zum einen bei einer erneuten Kontrolle ähnlich
auffällige Werte ergaben: In weiteren 250 Kinderurinproben von
2023/2024 wurde bei 55 Prozent der Proben MnHexP nachgewiesen.
• Bei zwei Proben wurden
MnHexP-Konzentrationen gemessen, die oberhalb des von der Kommission
Human-Biomonitoring im März 2024 abgeleiteten gesundheitlichen
Beurteilungswertes (HBM-I-Wert) von 60 Mikrogramm pro Liter lagen.
Dieser HBM-I-Wert stellt einen Vorsorgewert für die
Allgemeinbevölkerung dar. Bei einer Überschreitung sollte der
Messwert kontrolliert, nach Quellen für die Belastung gesucht und
diese minimiert werden.
Zum anderen hat das Landesamt in Zusammenarbeit mit den für den
gesundheitlichen Verbraucherschutz zuständigen Behörden und
Wirtschaftsbeteiligten Sonnenschutzmittel als mögliche Quelle
identifiziert.
• „Die neuen
Untersuchungsergebnisse bestätigen den Zusammenhang, dass der
Weichmacher aus dem verunreinigten UV-A-Filter DHHB in
Sonnenschutzmitteln stammt“, erklärt Elke Reichert, Präsidentin des
Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. „Wir haben in
dieser Studienreihe nicht nur auf eine Belastung mit dem
Weichmachermetaboliten geschaut. Wir haben in den Urinproben der
Kinder auch nach Stoffwechselprodukten des verunreinigten UV-Filters
gesucht. Unsere Ergebnisse bestätigen für einen Großteil der Proben
den Zusammenhang zwischen dem Weichmacher und dem kontaminierten
UV-Filter.“
„Damit tragen die Ergebnisse des Landesumweltamtes NRW wesentlich
zur Aufklärung dieser bundesweiten Problematik bei. Die KISA-Studie
des LANUV ist wichtig, um frühzeitig Hinweise auf mögliche
Umweltbelastungen zu erhalten und gegensteuern zu können. Je mehr
Transparenz und Aufklärung wir schaffen, desto mehr Schutz
resultiert daraus am Ende für uns alle“, erklärt Umweltminister
Oliver Krischer.
Die Ergebnisse des LANUV zeigen auch, dass mindestens ein Drittel
der Kinder Abbauprodukte des UV-Filters aufwiesen, ohne dass der
Weichmachermetabolit bei ihnen nachgewiesen wurde. Dies bestätigt,
dass die Herstellung von UV-Filtern ohne DnHexP-Verunreinigung
möglich ist und dass DnHexP-freie Sonnenschutzprodukte am Markt
verfügbar sind.
Ergebnisse der Untersuchungen von Sonnenschutzmitteln durch die
Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter
Seit Anfang 2024 werden in Nordrhein-Westfalen und anderen
Bundesländern verstärkt Untersuchungen von Sonnenschutzmitteln und
von sog. UV-A-Filtern durchgeführt. Die CVUÄ in Nordrhein-Westfalen,
die für kosmetische Mittel zuständig sind, untersuchten 42
Sonnenschutzmittel.
Die Ergebnisse zeigen, dass die gemäß EU-Kosmetikverordnung
festgelegte maximale Einsatzkonzentration von zehn Prozent des
UV-A-Filters DHHB in kosmetischen Mitteln bei keinem der
untersuchten Produkte überschritten wurde. In 31 (74 Prozent)
untersuchten Produkten wurden DHHB-Gehalte nachgewiesen, in elf
Sonnenschutzmitteln war kein DHHB nachweisbar. Bei sechs
Sonnenschutzmitteln (14 Prozent) wurden DnHexP-Gehalte zwischen 0,8
und 5,9 mg/kg bestimmt. Bei 86 Prozent war kein DnHexP nachweisbar.
Die in Nordrhein-Westfalen ermittelten Analyseergebnisse decken sich
mit denen anderer Bundesländer.
Neben Sonnenschutzmitteln selbst wurden auch weitere zwölf Proben
des Rohstoffes DHHB (UV-A-Filter) analysiert. In allen Proben war
DnHexP nachweisbar. Bei zehn Proben lagen die Gehalte zwischen 9,9
bis 69,7 mg/kg; zwei Proben wiesen Gehalte von über 100 mg/kg auf.
Die ermittelten Analysenergebnisse zeigen, dass sich die
DnHexP-Gehalte im Rohstoff unterscheiden können.
Das Bundesamt für Risikobewertung geht davon aus, dass selbst bei
höheren Verunreinigungen ein hinreichender Sicherheitsabstand
besteht und eine gesundheitliche Beeinträchtigung daher sehr
unwahrscheinlich ist.
Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten die Ergebnisse, dass
die auf dem Markt bereitgestellten Sonnenschutzmittel sicher sind
und dass es auch Sonnenschutzmittel mit DHHB ohne nachweisbare
Verunreinigung mit DnHexP gibt.
Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen: „Die Chemischen und
Veterinäruntersuchungsämter in Nordrhein-Westfalen leisten mit ihren
Untersuchungen einen bedeutenden Dienst, um Verbraucherinnen und
Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung
zu schützen."
Das Verbraucherschutzministerium Nordrhein-Westfalen schließt sich
weiterhin allgemein der geltenden Empfehlung an, dass
Verbraucherinnen und Verbrauchern keinesfalls auf Sonnenschutzmittel
verzichten sollen, denn UV-Strahlung ist nach wie vor die
Hauptursache für die Entstehung von Hautkrebs.
Umfangreiches Maßnahmenpaket eingeleitet
Aufgrund der Zusammenhänge haben die zuständigen
Lebensmittelüberwachungsbehörden und die Wirtschaftsbeteiligten
Maßnahmen zur weiteren Minimierung der Verunreinigungen eingeleitet.
Zentral wird dabei die Herstellung von DHHB so umgestellt, dass das
Vorkommen von Verunreinigungen auf ein technisch machbares Minimum
reduziert wird.
Die Umsetzung entsprechender Maßnahmen wird von den
Lebensmittelüberwachungsbehörden kontrolliert.
Beim bundesweiten Monitoring 2025 soll ein analytisch ermittelter
Orientierungswert für die technische Vermeidbarkeit von DnHexP im
UV-A-Filter DHHB abgeleitet werden.
Auf EU-Ebene hat der wissenschaftliche Ausschuss für
Verbrauchersicherheit (SCCS) den Auftrag erhalten, die Reinheit des
UV-Filters in Sonnenschutzmittel neu zu bewerten.
Um die Bewertungsprozesse zu unterstützen, werden das
nordrhein-westfälische Umweltministerium und das
Verbraucherschutzministerium die aktuellen Untersuchungsergebnisse
einspeisen.
Das LANUV setzt die regelmäßigen Untersuchungen von Kinderurin auf
MnHexP im Rahmen der LANUV-KiSA-Studie fort.
Hintergrund
Weichmacher gehören zu den vom LANUV untersuchten Stoffen. Eine
wichtige Weichmacher-Gruppe sind die Phthalate. Diese Stoffe werden
im Körper des Menschen in sogenannte Metaboliten umgewandelt und mit
dem Urin ausgeschieden. Viele Phthalate sind für die Gesundheit des
Menschen schädlich, da sie Effekte auf das Fortpflanzungssystem
haben. Für eine Reihe von Phthalaten bestehen deshalb umfangreiche
Verwendungsbeschränkungen. Vom LANUV werden aktuell insgesamt 35
Phthalat-Metaboliten im Urin von Kindern untersucht.
• Allen an der Studie
teilnehmenden Erziehungsberechtigten bietet das LANUV eine
umfassende umweltmedizinische Beratung zu den ermittelten
Ergebnissen an. Kinder mit Überschreitungen können eine
Nachuntersuchung erhalten. Außerdem bietet das LANUV den
Erziehungsberechtigten an, nach den möglichen Quellen für die
erhöhte Belastung zu suchen.
Das LANUV untersucht regelmäßig im Auftrag des
NRW-Umweltministeriums die Schadstoffbelastung von Kindern aus
Nordrhein-Westfalen (KiSA-Studie NRW). Alle drei Jahre wird seit
2011 der Urin von jeweils 250 Kindern im Alter von zwei bis sechs
Jahren auf verschiedene Schadstoffe wie Weichmacher, Pestizide oder
Konservierungsmittel analysiert.
Der nächste reguläre Durchgang erfolgt in den Jahren 2026/27. Solche
Untersuchungen wie die KiSA-Studie NRW werden als
Human-Biomonitoring bezeichnet. Mit den LANUV-Daten aus dem
Human-Biomonitoring lassen sich zeitliche Veränderungen in der
Schadstoffbelastung der Kinder aufzeigen. Sie dienen als
Frühwarnsystem für das Erkennen von Belastungen mit Schadstoffen.
Informationen zur Studie des LANUV:
https://www.lanuv.nrw.de/themen/umwelt-und-gesundheit/umweltmedizin/umweltepidemiologie/schadstoffe-im-urin-von-kindern-bestimmung-von-schadstoffen-im-urin-von-kindern-aus-nrw
|
|
Gewässerreinigung mit Algen: Chemischer Verschmutzung
bekämpfen |
|
Duisburg, 24. Januar 2025 -
Europas Gewässer sind in schlechtem Zustand: Über die Hälfte
von ihnen ist chemisch stark belastet. Kein Wunder – täglich
werden in Europa in Industrie und Landwirtschaft bis zu
70.000 verschiedene Chemikalien eingesetzt. Forschende der
Universität Duisburg-Essen haben jetzt eine neue Methode
entwickelt, um verschmutzte Gewässer zu reinigen.
Ihre aktuelle Studie zeigt*, dass
fossilen Überresten von Kieselalgen (Diatomeen) Schadstoffe
effizient aus dem Wasser entfernen können, nachdem sie
chemisch modifiziert wurden.
Nahaufnahme der Kieselalgen aus
der Algensammlung der Universität Duisburg-Essen, Gut zu
erkennen sind unterschiedliche Porengrößen. Copyright:
UDE/Arbeitsgruppe Phykologie/CCAC
Über 500 Chemikalien finden
Forschende in Europas Flüssen, sie gelangen durch Industrie
und Landwirtschaft ins Gewässer und bedrohen die aquatischen
Lebensräume. Das Team um Juniorprofessorin Dr. Anzhela
Galstyan will die Chemikalien jetzt mit Algen beseitigen.
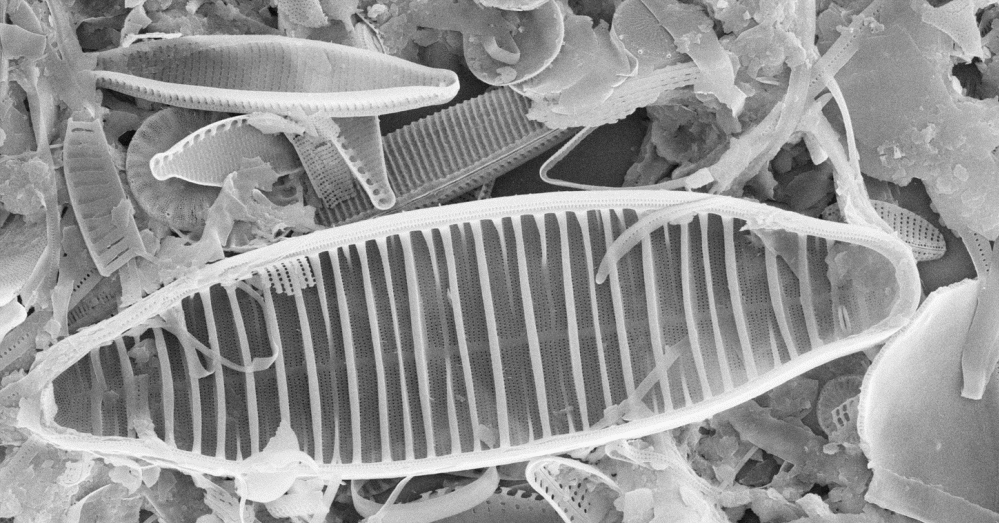
Nahaufnahme der Kieselalgen aus
der Algensammlung der Universität Duisburg-Essen, Gut zu
erkennen sind unterschiedliche Porengrößen. Copyright:
UDE/Arbeitsgruppe Phykologie/CCAC
Kieselalgen sind mikroskopisch
kleine einzellige Organismen, die in Gewässern leben und eine
Zellwand aus Kieselsäure (Siliziumdioxid) besitzen. Dank
seiner porösen Struktur kann es eine Vielzahl von
Schadstoffen aufnehmen“, erklärt Galstyan.
In der Studie testeten die
Forschenden Kieselalgenschalen an zwei exemplarischen
Schadstoffen, die häufig aus der Textilindustrie in Flüsse
und Grundwasser gelangen: Methylenblau und Methylorange. Um
die Adsorptionsfähigkeit zu verbessern, wurde das Kieselgur
chemisch modifiziert, indem seine Oberfläche mit speziellen
funktionellen Gruppen versehen wurde. „Das könnte problemlos
auch in industriellem Maßstab umgesetzt werden“, betont die
Juniorprofessorin für Nanomaterialien in aquatischen
Systemen.
Im Labor wurde das Kieselgur
unter verschiedenen Bedingungen getestet, etwa bei
unterschiedlichen Salzkonzentrationen und pH-Werten. Die
Ergebnisse sind gut: Unabhängig von den Bedingungen entfernte
das Material die Schadstoffe gleichbleibend effektiv.
Zum Vergleich zogen die
Forschenden Silica heran, ein Material, das bereits in der
Wasserreinigung etabliert ist. Kieselgur schnitt deutlich
besser ab: Nach einer Stunde wurden bis zu 100 Prozent des
Methylenblaus entfernt, das Silicia hingegen entfernte in der
selben Zeit nur 88% des Farbstoffs. Beim Methylorange nahmen
sowohl Silica als auch Kieselgur etwa 70 Prozent des
Schadstoffs auf.
„Wir sehen in Kieselgur eine
umweltfreundliche und kostengünstige Lösung zur
Wasseraufbereitung“, resümiert Galstyan. Der große Vorteil:
Algen sind ein nachwachsender Rohstoff und lassen sich mit
minimalem Energieaufwand züchten – ganz im Gegensatz zum
etablierten Filtermaterial Aktivkohle.
Nun prüfen die Forschenden, wie
Kieselgur in Membranen zur Wasserreinigung eingesetzt werden
kann. Dank der weltweit größten Algensammlung, die an der
Universität Duisburg-Essen beheimatet ist, sind die
Voraussetzungen für die Entwicklung dieser umweltfreundlichen
Technologie optimal.
* C. A. Ojike, V. Hagen, B.
Beszteri, A. Galstyan, Surface-Functionalized Diatoms as
Green Nano-Adsorbents for the Removal of Methylene Blue and
Methyl Orange as Model Dyes from Aqueous Solution. Adv.
Sustainable Syst. 2025, 2400776.
https://doi.org/10.1002/adsu.202400776
|
|
Membrantechnologie im Wasser- und Energiemanagement
Wichtiger Beitrag zur Versorgung
in Afrika
|
|
Duisburg, 14. Januar 2025 - Auf
dem afrikanischen Kontinent wächst die Bevölkerung stetig.
Sie mit sauberem Wasser und ausreichend Energie zu versorgen,
stellt für die Staaten eine Herausforderung dar. Die
Membrantechnologie könnte innovative und nachhaltige Lösungen
liefern. Im internationalen Projekt „WE-Africa, Membrane
Knowledge Hub“ wollen Forschende und Partner aus der
Wirtschaft deshalb eine Hochschul-Industrie-Plattform für
nachhaltiges Wasser- und Energiemanagement in Afrika
etablieren. Es wird von der Universität Duisburg-Essen (UDE)
geleitet und koordiniert.
Der Deutschen Akademischen
Austauschdienst (DAAD) fördert es für vier Jahre mit knapp
800.000 Euro.

Besuch einer Trinkwasseraufbereitungsanlage in Ghana:
Prof. Dr. Michael Eisinger (ZWU-Geschäftsführer) (l.) und
Hasan Idrees (Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mechanische
Verfahrenstechnik/Wassertechnik) (M.)..Foto © KNUST/Ghana
Die Membrantechnologie spielt
eine zentrale Rolle beim nachhaltigen Wasser- und
Energiemanagement. Beispielsweise ist der Einsatz von
Membranen beim Entsalzen von Meerwasser energiesparender
verglichen mit anderen Methoden. Außerdem werden Membrane
verwendet, um Schadstoffe aus Abwässern zu filtern, und in
Brennstoffzellen eingesetzt, wandeln sie Wasserstoff
effizient in Elektrizität um.
Im Projekt, das vom Zentrum für
Wasser- und Umweltforschung (ZWU) der UDE koordiniert wird,
soll nun an Partneruniversitäten in Ägypten, Ghana und
Marokko ein Membrane Technology Knowledge Hub entstehen. Dort
werden für Studierende und Fachkräfte Online-Kurse zur
Membrantechnik im Wasser- und Energiemanagement angeboten.
Gleichzeitig sammeln die Studierenden in Unternehmen
praktische Erfahrungen. In Intensivkursen zum Unternehmertum
erfahren sie, wie sie aus ihren Ideen ein Geschäftsmodell
entwickeln und in den lokalen Markt einbringen können.
„Wir unterstützen mit dem Projekt
den Wissensaustausch, den Aufbau von Kapazitäten und den
Technologietransfer“, erklärt Leiter Dr. Stefan Panglisch,
UDE-Professor für Mechanische
Verfahrenstechnik/Wassertechnik. „Damit leisten wir einen
wichtigen Beitrag zur sozioökonomischen Entwicklung und zum
Umweltschutz in Afrika.“
Die UDE ist Teil der Ghana-NRW
Universitätsallianz. „WE-Africa, Membrane Knowledge Hub“
leiste einen wichtigen Beitrag, diese Kooperation zu
intensivieren, betonte Prof. Dr. Karen Shire, Prorektorin für
Universitätskultur, Diversität und Internationales, kürzlich
bei der Auftaktveranstaltung des Projekts. Dazu waren
Verteter:innen von Partneruniversitäten aus Ägypten, Ghana
und Budapest an den Essener Campus gekommen.
Weitere Informationen:
https://www.uni-due.de/zwu/we_africa.php
|
|
KI gestützte Vorhersagen: Frühwarnsystem für
Trinkwasserversorger |
|
Duisburg, 13. Januar 2025 - Rund 12 Prozent des Trinkwassers
in Deutschland stammen aus Seen und Talsperren. Deren Zustand
wird maßgeblich von den darin lebenden Organismen bestimmt.
Der Klimawandel, Umweltverschmutzungen und invasive Arten wie
Blaualgen gefährden jedoch die Biodiversität – und damit die
Qualität des Trinkwassers.
Im Forschungsprojekt IQ Wasser*
untersucht ein interdisziplinäres Team der Universität
Duisburg-Essen die mikrobiologische Biodiversität mithilfe
von Umwelt-DNA-Analysen. Ziel ist die Entwicklung eines
KI-gestützten Frühwarnsystems, das Veränderungen in der
Wasserqualität erkennt.

Das Team untersucht die
Wasserqualität und Biodiversität der Talsperre Kleine Kinzig
in den nächsten drei Jahren. Copyright: TZW, Michael Hügler
„Etliche Lebewesen tragen zur
Wasserqualität in Trinkwasserreservoiren bei“, erläutert Dr.
Julia Nuy aus der Umweltmetagenomik am Research Centre One
Health. „Muscheln filtern Partikel aus dem Wasser,
Bachflohkrebse zerkleinern organisches Material, und
bestimmte Bakterien verstoffwechseln Stickstoff oder
Kohlenstoff.“ Dabei gilt: Je höher die Artenvielfalt, desto
stabiler bleiben ökologische Dienstleistungen wie etwa das
Filtern des Wassers.
Die Rolle der Biodiversität und
insbesondere die mikrobiologische Vielfalt wird bei der
Bewertung der Wasserqualität bislang jedoch kaum
berücksichtigt. Mikroorganismen wie Bakterien übernehmen
dabei wesentliche Funktionen im Ökosystem, bergen aber auch
Risiken, wie etwa Cyanobakterien (Blaualgen), die sich bei
steigenden Temperaturen ausbreiten.
In den nächsten drei Jahren nimmt
das interdisziplinäre Team vier Mal pro Jahr Proben in der
Wahnbachtalsperre und in der Talsperre Kleine Kinzig. „Nach
der Filterung extrahieren wir die DNA und sequenzieren sie
vollständig“, erläutert Dr. Julia Nuy, die das Teilvorhaben
Mikrobielle Ökologie und Biodiversität leitet.
„Damit arbeiten wir
genom-aufgelöst und können aus kleinen Fragmenten nahezu
vollständige Genome rekonstruieren, das gibt präzise
Einblicke in die mikrobielle Vielfalt und die
Dienstleistungen eines Ökosystems“, erklärt Dr. Julia Nuy.
„Anhand der Genome können wir beispielsweise erkennen, ob
Bakterien Stickstoff oder Kohlenstoff verstoffwechseln – eine
zentrale Funktion für das Ökosystem“.
Ein weiterer Fokus liegt auf dem
Pathogenitätspotenzial: „Wir untersuchen, wie sich
Antibiotikaresistenzen zeitlich entwickeln, ob bestimmte
Resistenzgene nur in spezifischen Bakterien vorkommen oder in
einer breiten Vielfalt von Mikroorganismen. Zudem analysieren
wir, ob aktuelle Trends beim Antibiotikaeinsatz in den
untersuchten Bakterien nachweisbar sind“, so Nuy.
Die gewonnenen Daten fließen in
KI-Modelle ein, die Umweltveränderungen und ihre Auswirkungen
auf die Biodiversität vorhersagen. „Unser Ziel ist es, ein
Frühwarnsystem für Trinkwasserversorger zu schaffen“, betont
Nuy. „So können potenzielle Gefahren wie Algenblüten oder
antibiotikaresistente Keime frühzeitig erkannt und gezielte
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.“
* IQ Wasser wird vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung mit etwa zwei
Millionen Euro gefördert und vom TZW: DVGW-Technologiezentrum
Wasser koordiniert. Weitere Partner sind das
Fraunhofer-Institut IOSB, das Museum für Naturkunde Berlin
sowie bbe Moldaenke GmbH und Ident Me GmbH.
|
|
Zukunftsweisende Dämmstoffe |
|
Entwicklung nachhaltiger,
zirkulärer Lösungen in der Gebäudetechnik
Oberhausen/Duisburg, 8. Januar 2025 - Im Rahmen des neuen
Projekts »CircularInFoam« entwickeln Forschende des
Fraunhofer CCPE nachhaltige, zirkuläre Dämmstoffe auf Basis
von Rezyklaten und Biopolymeren. Angesichts der
Herausforderungen im Gebäudesektor, der für 35 % des
Endenergieverbrauchs in Deutschland verantwortlich ist, zielt
das Projekt darauf ab, Wärmeverluste zu reduzieren und die
Klimaneutralität bis 2045 zu unterstützen. Vorarbeiten werden
bereits auf der BAU 2025 in München präsentiert.

PLA-Partikelschaum als nachhaltiger Dämmstoff in der
Gebäudetechnik © Fraunhofer ICT
Der Gebäudesektor in Deutschland ist nicht nur für rund 35 %
des Endenergieverbrauchs, sondern auch für 30 % der
CO2-Emissionen verantwortlich. Um die Klimaneutralität bis
2045 zu erreichen, ist es unerlässlich, Wärmeverluste durch
die Gebäudehülle zu reduzieren. Neben zahlreichen anderen
Maßnahmen, wie dem Austausch von Heizungsanlagen, Fenstern
und Türen, müssen Undichtigkeiten beseitigt und das Mauerwerk
verstärkt gedämmt werden.
Jährlich werden rund 11,5 Mio. m³ Polystyrol-Dämmstoffe in
Deutschland eingesetzt, und die Nachfrage steigt.
Polystyrol-Schaumdämmstoffe machen einen Marktanteil von etwa
30 % aus. Benötigte Brandklassen können aber nur mit
halogenhaltigen Flammschutzmitteln erreicht werden, die
aufgrund ihrer Herstellung und Nutzung kritisch zu betrachten
sind.
Im Rahmen der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie sollen bis 2030
16 % und bis 2035 bis zu 22 % Energieeinsparungen im
Vergleich zu 2020 erzielt werden. Dies kann nur mit
nachhaltigen Dämmmaterialien erreicht werden. Nachhaltige
Polymere und halogenfreie Flammschutzmittel Daher haben die
Fraunhofer Institute LBF, ICT und IBP im Rahmen des
Fraunhofer CCPE das Projekt »CircularInFoam« neu gestartet.
Ziel ist die Entwicklung von thermoplastischen Schäumen für
den Einsatz als nachhaltige Dämmstoffe, die auf Rezyklaten
und Biopolymeren basieren. Hierbei steht der Einsatz
nachhaltiger Polymere und halogenfreier Flammschutzmittel im
Fokus. Angesichts strengerer regulatorischer Anforderungen
optimiert das Projektteam die Flammschutzeigenschaften des
neuen Dämmstoffs weiter.
Das Projekt berücksichtigt nicht nur technische, sondern auch
gesellschaftliche und regulatorische Anforderungen und bietet
das Potenzial, nachhaltige Dämmstoffe weiter voranzubringen.
Die Vorgehensweise gliedert sich in sechs Arbeitspakete, die
von der Auswahl geeigneter Flammschutzmittel über die
Prozessentwicklung bis zur Analyse und bauphysikalischen
Bewertung der hergestellten Schäume reichen. Interessierte
Industrieunternehmen sind eingeladen, sich zu melden, um als
Partner eingebunden zu werden und die Marktakzeptanz zu
sichern.
Die Ergebnisse werden abschließend aufbereitet und in einem
Leitfaden veröffentlicht. Die Fraunhofer Institute ICT und
das IBP präsentieren den aktuellen Stand der ins Projekt
einfließenden Komponenten nachhaltige Dämmstoffe und
halogenfreier Flammschutz auf der BAU 2025, München, 13. bis
17. Januar 2025, Stand 528, Halle C2.
|
|
GOVSATCOM Hub stärkt Raumfahrtstandort
Nordrhein-Westfalen |
|
Düseldorf/Duisburg, 27. Dezember 2024 -
Die Entscheidung der EU-Kommission, einen GOVSATCOM Hub des
EU- Programms IRIS² (Infrastructure for Resilience,
Interconnectivity and Security by Satellites) am Standort
Köln anzusiedeln, markiert einen Meilenstein für die
Raumfahrt in Nordrhein-Westfalen. Mit dem Hub wird nicht nur
ein zentraler Baustein für Europas sichere
Satellitenkommunikation geschaffen, sondern auch die
strategische Bedeutung des Raumfahrtstandortes Köln weiter
ausgebaut.

Der GOVSATCOM Hub dient als hochsicherer Netzwerkknoten, über
den satellitengestützte Kommunikationsdienste für
sicherheitskritische Anwendungen bereitgestellt und gesteuert
werden. Er ermöglicht beispielsweise Behörden,
Katastrophenschutz und anderen öffentlichen Institutionen
eine resiliente und störungsfreie Kommunikation – auch in
Krisensituationen. Ministerpräsident Hendrik Wüst: „Dass die
Entscheidung für das GOVSATCOM Hub auf Köln gefallen ist,
unterstreicht ein weiteres Mal die herausragende Bedeutung
Nordrhein-Westfalens als zentraler Standort für Luft- und
Raumfahrt in Europa.
In diesem Jahr haben wir bereits das einzigartige Trainings-
und Technologiezentrum LUNA in Köln eröffnet. Jetzt folgt die
Beteiligung am IRIS²-Programm zur Satellitenkommunikation der
Europäischen Union. Beides zeigt: Der Weg in den Weltraum
führt über Nordrhein-Westfalen. Mit dieser Investition in das
GOVSATCOM Hub schaffen wir eine sichere
Kommunikationsinfrastruktur und legen den Grundstein für
einen zusätzlichen Innovationsstandort, von dem die gesamte
Region nachhaltig profitiert.
Insbesondere Köln wird als Knotenpunkt für Weltraumforschung
gestärkt und leistet einen wesentlichen Beitrag zur
Weiterentwicklung technologischer Innovationen.“ Wirtschafts-
und Klimaschutzministerin Mona Neubaur: „Der Standort Köln
entwickelt sich Schritt für Schritt zum führenden
Kompetenzzentrum für Raumfahrt und Zukunftstechnologien in
Europa. Hier finden Spitzenforscherinnen und -forscher
attraktive Bedingungen und eine strategische günstige Lage,
die eine intensive internationale Zusammenarbeit über
Forschungsbereiche hinweg ermöglicht.
Der GOVSATCOM Hub wird als Schnittstelle für sichere und
schnelle Kommunikationssysteme einen wichtigen Beitrag zu
mehr Resilienz und Souveränität in Europa leisten und die
Grundlagen für neue Technologie-Anwendungen schaffen. Das
zeigt: Wir haben in Nordrhein-Westfalen das Wissen und die
Fähigkeiten, mit wegweisenden Innovationen Zukunft zu
gestalten. Gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort werden wir
die Entwicklung der Weltraumforschung in Köln weiter nach
Kräften unterstützen.“
Der Standort Köln, Heimat des Deutschen Zentrums für Luft-
und Raumfahrt (DLR) sowie zahlreicher internationaler Partner
wie der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), bietet mit
seiner einzigartigen Infrastruktur ideale Voraussetzungen für
die Integration des GOVSATCOM Hubs. Zuletzt hat die
Landesregierung den Standort mit der Förderung der LUNA-Halle
zur Simulation von Mondmissionen vorangetrieben.
Der GOVSATCOM Hub wird nicht nur die bestehende Infrastruktur
erweitern, sondern auch als Katalysator für weitere
Ansiedlungen in der Raumfahrt- und Hightech-Branche dienen.
Die Landesregierung hat aktiv dazu beigetragen, den GOVSATCOM
Hub nach Nordrhein-Westfalen zu holen. Mit der Zusage, die
Ausgaben für die Errichtung eines Gebäudes am Standort bis zu
einer Höhe von maximal 50 Millionen Euro zu übernehmen, hat
das Land entscheidend zum Erfolg der Bewerbung beigetragen.
Die laufenden Betriebskosten werden von der EU-Kommission
getragen. Die Landesregierung wird weiterhin eng mit dem
Bund, der EU und den beteiligten Partnern zusammenarbeiten,
um den GOVSATCOM Hub erfolgreich in die bestehenden
Strukturen einzubinden und die langfristige Entwicklung des
Raumfahrtstandorts Köln zu sichern.
|
|









 •
2024 •
2023
•2021/2022
•
2020
•
2019
Sitemap Redaktion Harald Jeschke
•
2024 •
2023
•2021/2022
•
2020
•
2019
Sitemap Redaktion Harald Jeschke