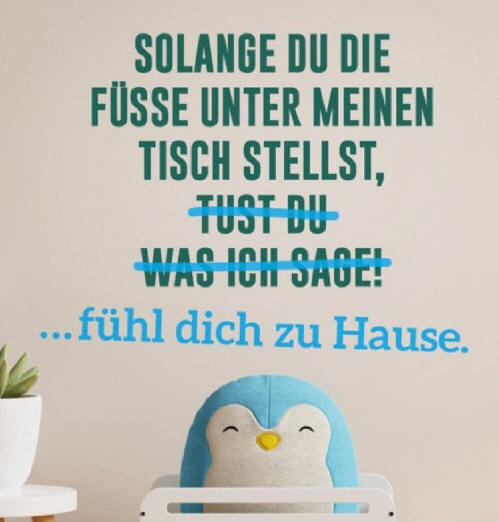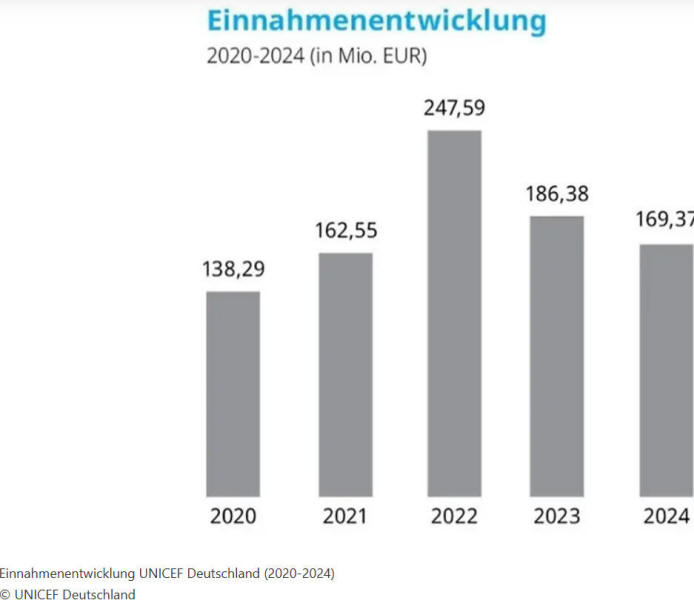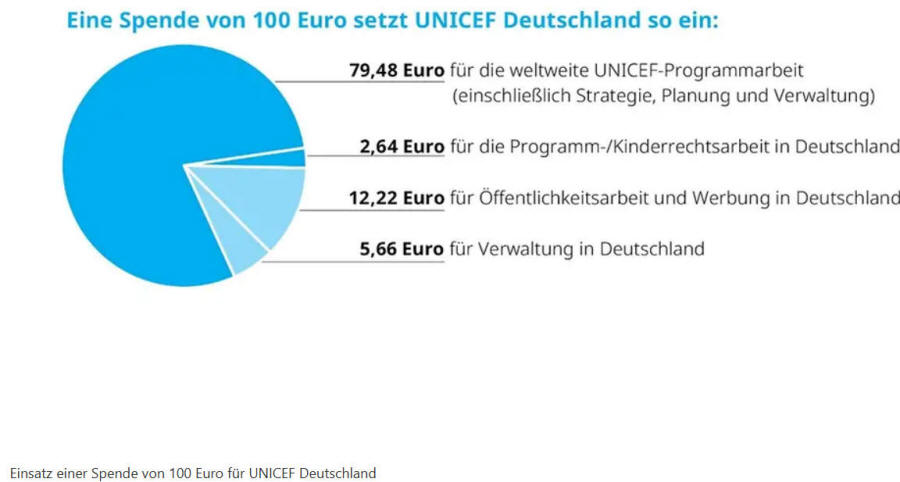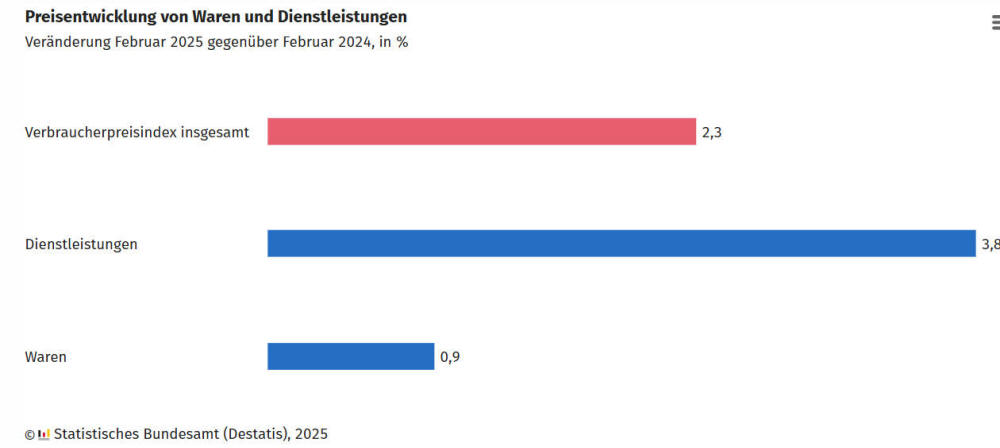|
Am 11. Dezember 1946 in New York:
Kinderhilfswerk Unicef wird ins Leben gerufen!
Am 24. Juli 1957
wurde in Duisburg aus Dankbarkeit und der Einsicht, dass
auch in vielen anderen Teilen der Welt Kinder in großer Not
leben, die Arbeitsgruppe Duisburg ins Leben gerufen. Redaktion Harald Jeschke
• Archiv:
2024 2023
2022
2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015
|
|
|
|
Internationaler Tag der
Kinderrechte am 20. November:
UNICEF-Aktionen in
Deutschland und weltweit
|
|
Berlin/Köln/Duisburg, 13. November 2025 - Am 20.11. ist
Internationaler Tag der Kinderrechte. Zu diesem besonderen
Tag hat UNICEF in Deutschland und weltweit zahlreiche
Aktionen geplant. Alle nationalen Aktivitäten stehen in
diesem Jahr unter dem Motto „Jedes Kind zählt!“.

©
UNICEF/UNI824930/Etges
Denn: Jedes Kind und jede*r
Jugendliche auf der Welt hat dieselben Rechte – unabhängig
von Geschlecht, Herkunft oder sozialem Status. Die Realität
sieht für Millionen Kinder jedoch ganz anders aus. Um die
Bedeutung der universell geltenden Kinderrechte zu
unterstreichen, erstrahlen am 20.11. markante Gebäude in
Blau – der Farbe der Kinderrechte. Außerdem engagieren sich
über eine Viertelmillion Schüler*innen im Zuge der
bundesweiten Mitmach-Aktion „I AM. Ich bin einmalig. Ich bin
vieles. Ich bin gut.“.
„Kinderrechte werden täglich
verletzt – überall auf der Welt. Der Internationale Tag der
Kinderrechte ist deshalb ein wichtiger Anlass, um genauer
hinzuschauen und gemeinsam aktiv zu werden“, sagt Christian
Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland: „Die
Folgen der Klimakrise für Kinder, bewaffnete Konflikte,
extreme Armut und Ernährungskrisen verstärken sich
gegenseitig und verschärfen sich zu einer globalen
Krisenlage für Kinder. Zusätzlich spitzt sich die weltweite
Lage für Kinder durch Kürzungen bei internationalen
Hilfsgeldern zu. Das darf uns nicht kalt lassen: Es ist an
der Zeit, mit starkem, nachhaltigem Engagement die Welt zu
einem besseren Ort für jedes Kind zu machen, überall.“
Am 20.11. werden die Kinderrechte ins Licht gerückt
Von Berlin bis Sydney: Am 20. November werden im Rahmen der
internationalen Beleuchtungsaktion von UNICEF zahlreiche
Gebäude blau erstrahlen, um mehr Aufmerksamkeit für die
Rechte, Bedürfnisse und Wünsche der jungen Generation zu
schaffen. Auch in Deutschland werden über 60 markante
Bauwerke, darunter der Kulturpalast in Dresden oder die
Bundeskunsthalle in Bonn, am Abend des 20.11. Farbe für
Kinderrechte bekennen.
Darüber hinaus werden
verschiedene Events und kreative Aktionen zum Thema
Kinderrechte in zahlreichen Städten und Gemeinden den 20.11.
mit Leben füllen. Die über 7.000 UNICEF-Engagierten werden
im ganzen Land aktiv sein, sie führen Ortsgespräche mit
Entscheider*innen aus Politik und Wirtschaft und machen auf
die Kinderrechte aufmerksam.
Mitmachaktion „I AM. Ich
bin einmalig. Ich bin vieles. Ich bin gut.“
Rund um den
Internationalen Tag der Kinderrechte machen sich
Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland für die
Kinderrechte stark. Bei der UNICEF-Mitmachaktion „I AM. Ich
bin einmalig. Ich bin vieles. Ich bin gut.“ setzen Kinder
und Jugendliche mit Hilfe digitaler und analoger
Aktionsmaterialien ein kreatives Zeichen für Kinderrechte,
Selbstvertrauen und Zukunftsmut. Unterstützung erhalten sie
dabei durch die Musikerin und offizielle Aktionspatin Senta.
Die Sängerin widmet der Aktion ihren Song „Ich bin
stark” – ein Lied für Kinder, das Mut macht, sie begleitet
und stärkt. Im Zuge der Mitmachaktion werden zum
Internationalen Tag der Kinderrechte 2.600 Schulen mit rund
300.000 Kindern und Jugendlichen aus ganz Deutschland aktiv.
Neuer globaler Report zur Situation der Kinder in der
Welt
Am 20.11. veröffentlicht UNICEF auch den neuen
globalen Bericht „Zur Situation der Kinder in der Welt”. Er
beleuchtet in diesem Jahr das Thema „Kinder in Armut“ und
zeigt auf, warum Armut weiterhin besteht und was unternommen
werden kann, um sie zu beenden. UNICEF veröffentlicht in dem
Bericht aktuelle Zahlen zur Situation von Kindern in Armut
und zur Verbreitung der sogenannten multidimensionalen Armut
von Kindern.
Das bedeutet, dass Kinder
schwerwiegende Entbehrungen in einem oder mehreren der
Bereiche Wohnen, Ernährung, Hygiene, Wasser, Bildung oder
Gesundheitsversorgung hinnehmen müssen. Im neuen Bericht
nimmt UNICEF zudem die Auswirkungen aktueller Konflikte, des
Klimawandels, der Kürzungen der internationalen Hilfen sowie
der COVID-19-Pandemie auf die Armut von Kindern in den
Blick.
|
|
UNICEF-Bericht zur Lage der
Kinder in Deutschland 2025:
Weiter zu viele Kinder
ohne Perspektive
|
|
Berlin/Köln/Duisburg, 12. November 2025 - Der neue
UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder 2025 in
Deutschland zeigt, dass weiterhin viel zu viele Kinder
mit Blick auf ihre Chancen für ein gutes
Aufwachsen und Zukunftsperspektiven zu stark ins
Hintertreffen geraten.

© UNICEF/UNI824927/Etges
Mehr als einer
Million Kinder fehlen wesentliche Voraussetzungen
für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für späteren
beruflichen Erfolg.
Sie haben beispielsweise
keinen Platz, um Hausaufgaben zu machen, können sich kein
zweites Paar Schuhe oder vollwertige Mahlzeiten leisten
und nehmen kaum an Freizeitaktivitäten Gleichaltriger
teil. Nach wie vor entscheidet in Deutschland die familiäre
Situation sehr stark über die Möglichkeit zur
gesellschaftlichen Teilhabe der Kinder.
Der
Bericht macht auch deutlich, dass viele Kinder und
Jugendliche in Deutschland große Belastungen spüren. Das
zeigt sich zum Beispiel an der starken Zunahme von
körperlichen und psychischen Beschwerden, über
die mittlerweile 40 Prozent der Jugendlichen berichten.
„In Deutschland bewegt sich zu wenig für Kinder", sagt
Georg Graf Waldersee, Vorsitzender von UNICEF
Deutschland. „Eine gute Kindheit darf nicht nur ein hehres
Bekenntnis bleiben. Die neue Bundesregierung steht in der
Verantwortung, deutlich mehr für Kinder zu tun. Wer den
gesellschaftlichen Zusammenhalt und Deutschlands Zukunft
sichern will, muss jetzt gezielt in Kinder
investieren – insbesondere in diejenigen, die von Armut,
Ausgrenzung oder fehlenden Chancen betroffen sind.”
Wichtige Ergebnisse des Berichts:
Die ungleichen materiellen und sozialen Voraussetzungen in
den Familien wirken sich auf alle Lebensbereiche der Kinder
aus.
- Der Abstand zwischen bestens unterstützten und
besonders benachteiligten Kindern wächst.
- Immer mehr
Kinder können beispielsweise nicht gut lesen (25 Prozent, 5
Prozentpunkte mehr als in 2018).
- 41 Prozent der
Achtklässlerinnen und Achtklässler verfügen lediglich über
rudimentäre digitale Kompetenzen (2013: 29 %). Dabei sind
Kinder aus finanziell schlechter gestellten
Elternhäusern deutlich überrepräsentiert.
Hinzu
kommt, dass insbesondere diese benachteiligten Kinder und
Jugendlichen sich von ihrem Umfeld, also Eltern und
Lehrkräften, vergleichsweise selten gut
unterstützt fühlen. Jährlich verlassen über 62.000 die
Schule ohne Abschluss.
Eine beträchtliche Zahl von
Kindern in Deutschland ist von den konkreten Folgen von
Armut betroffen.
- So wurden über eine Million
Kinder als depriviert eingestuft, mussten also auf die
Erfüllung grundlegender Bedürfnisse wie den Ersatz
abgetragener Kleidung, eine beheizte Wohnung oder warme
Mahlzeiten verzichten.
- 44 Prozent der
armutsgefährdeten Kinder leben in überbelegten Wohnungen.
- Mindestens 130.000 Kinder sind wohnungslos
und in kommunalen Unterkünften untergebracht.
Der
seit 2006 erscheinende UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in
Deutschland untersucht anhand von sechs Dimensionen des
kindlichen Wohlbefindens umfassend die
Situation der aktuell 14 Millionen Kinder und Jugendlichen
unter 18 Jahren und gibt Handlungsempfehlungen für Politik
und Gesellschaft. Den diesjährigen Bericht hat das
renommierte Deutsche Jugendinstitut (DJI) für UNICEF
Deutschland mit insgesamt 27 wissenschaftlichen Expert*innen
erstellt. Erstmals wurden auch 23 Jugendliche an der
Schwerpunktsetzung und Ausgestaltung des UNICEF-Berichts
beteiligt.
Kinderarmut wirkt sich auf alle
Lebensbereiche aus
„Der Bericht macht deutlich, wie sich
Armut auf wirklich alle Lebensbereiche von
Kindern nachteilig auswirkt“, so Prof. Dr. Sabine
Walper, die den Bericht als Vorstandsvorsitzende und
Direktorin des Deutschen Jugendinstituts begleitet hat. „Das
zeigt sich in den Bildungschancen, der Gesundheit,
der gesellschaftlichen Teilhabe und selbst in den sozialen
Beziehungen. Umso wichtiger ist es, Strukturen so zu
reformieren, dass alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft
faire Chancen auf ein gutes Aufwachsen haben.“
Cristian, einer der am Bericht beteiligten Jugendlichen,
sagt: „Ich finde, niemand sollte ständig aufs Geld schauen
müssen, nur um zu entscheiden, ob man etwas essen kann, an
etwas teilnehmen darf oder zu einer Sportveranstaltung kann.
Warum mir das wichtig ist? Ich habe in meiner Kindheit
selbst damit zu kämpfen gehabt. Aus eigener Erfahrung weiß
ich, welche Auswirkungen Armut hat – und wie sehr einen das
wirklich mitnehmen kann.”
Kinderarmut seit
Jahren auf vergleichsweise hohem Niveau
Im internationalen Vergleich ist der Anteil der Kinder, bei
denen grundlegende Bedürfnisse aus finanziellen Gründen
nicht gestillt werden können, in Deutschland deutlich höher
als in einigen anderen europäischen Ländern. Dazu gehören
wirtschaftlich starke Länder wie Finnland oder Norwegen,
aber auch wirtschaftlich schwächere, wie Slowenien oder
Portugal.
Bei der Bekämpfung von Kinderarmut
stagniert die Entwicklung in Deutschland seit Jahren. Die
relative Armut von Kindern bewegt sich konstant um die 15
Prozent, 2023 waren es 14 Prozent. 1,9 Millionen Kinder
leben heute von dem Bürgergeld ihrer Familie. Hinzu kommen
Kinder, die mit Asylbewerberleistungen auskommen müssen.
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
Immer mehr
Kinder und Jugendliche leiden regelmäßig an gesundheitlichen
Beschwerden. Im Jahr 2022 gaben 40 Prozent der 11-bis
15-Jährigen an, dass sie mehrfach pro Woche oder sogar
täglich Beschwerden wie Kopfschmerzen,
Bauchschmerzen oder Schlafprobleme haben. Bei
der früheren Erhebung im Jahr 2014 waren es nur 24 Prozent.
Ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen in
Deutschland schätzt die eigene psychische Gesundheit und
Lebenszufriedenheit als nicht gut ein. Auch hier sind die
Werte alarmierend: Sie liegen bei 51 bis 67 von 100 Punkten
– variierend nach Geschlecht und familiärem Wohlstand. Den
niedrigsten Durchschnittswert haben finanziell
benachteiligte Mädchen mit einem Wert von 51 – das
liegt damit nur knapp über dem Schwellenwert von 50, der als
Anzeichen einer Depression interpretiert wird.
Beziehungen in Familie und Schule für große Zahl von Kindern
nicht ausreichend unterstützend
Der UNICEF-Bericht unterstreicht die zentrale Rolle, die
unterstützende Eltern und das weitere Umfeld für das
Aufwachsen von Kindern haben. Die Mehrheit der Kinder und
Jugendlichen fühlt sich zwar durch ihre Familien
unterstützt, doch fällt Deutschland auch hier im
internationalen Vergleich ab.
Nur 54 Prozent der
15-jährigen Mädchen in Deutschland berichten von einer hohen
familiären Unterstützung; in der Schweiz liegt der Anteil
bei 69 Prozent. Auch von ihren Lehrkräften fühlen sich die
Jugendlichen eher wenig unterstützt: Nur 26 Prozent der
15-jährigen Mädchen in Deutschland erleben die
Unterstützung als hoch, in Norwegen zum Beispiel sind
es dagegen 53 Prozent.
Empfehlungen von UNICEF
Deutschland
Es besteht großer Handlungsbedarf,
damit möglichst alle Kinder und Jugendlichen gute
Startbedingungen und Perspektiven für ihr weiteres Leben
haben. UNICEF Deutschland hat ergänzend zum Bericht konkrete
Handlungsempfehlungen für Bund, Länder und Gemeinden
veröffentlicht.
Insbesondere empfiehlt UNICEF,
gezielte Investitionen in besonders benachteiligte
Kinder zu priorisieren und familiäre
Ressourcen zu stärken, zum Beispiel durch den Ausbau des
„Startchancenprogramms“ an Schulen, die Entwicklung
vergleichbarer Ansätze für Kitas sowie ein Maßnahmenpaket
zur Reduzierung von Kinderarmut.
|
|
25 Jahre gewaltfreie
Erziehung im Bürgerlichen Gesetzbuch
Jeder Sechste hält
„Anschreien“ in der Erziehung für angebracht
|
|
Neue
repräsentative Studie gibt Einblick in Einstellungen zu
emotionalen Strafen in der Erziehung | Mehrheit lehnt diese
Strafen ab
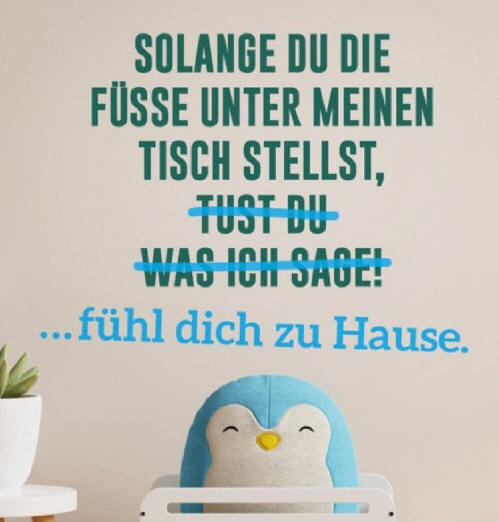
UNICEF Deutschland
Berlin/Köln/Ulm, 29. Oktober 2025
- Am 8. November 2000 trat in Deutschland das Recht jedes
Kindes auf gewaltfreie Erziehung in Kraft. Ein
Vierteljahrhundert später zeigt sich im Hinblick auf
Einstellungen zu emotionalen Strafen ein widersprüchliches
Bild: Zwar werden diese Strafen grundsätzlich mehrheitlich
abgelehnt, in ihren einzelnen Ausprägungen stoßen sie jedoch
nach wie vor auf Zustimmung. Dies zeigt eine aktuelle,
repräsentative Befragung von der Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am
Universitätsklinikum Ulm und UNICEF Deutschland.
Laut
der neuen Studie lehnen fast drei Viertel der Befragten
emotionale Strafen in der Erziehung grundsätzlich ab.
Einzelne Formen emotionaler Bestrafung stoßen jedoch auf
Zustimmung: So halten 16,1 Prozent der Befragten das
Anschreien für eine angemessene Erziehungsmaßnahme, 9,2
Prozent das Einsperren ins Zimmer und 8,6 Prozent das
Nicht-mehr-Sprechen mit dem Kind. Jeweils rund fünf Prozent
der Befragten halten emotionale Strafen wie Isolation von
Familie oder Freunden, Auslassen einer Mahlzeit, Entzug von
Aufmerksamkeit und Zuneigung sowie Schuldzuweisungen oder
Bloßstellungen für angemessen.
Auch unter den
angewandten Formen emotionaler Gewalt wurde das Anschreien
am häufigsten genannt: In einer kleineren Stichprobe von
Befragten, die angaben, bereits Kinder erzogen zu haben, gab
fast jede vierte Person an, diese Form selbst bereits
ausgeübt zu haben. Häufig angewendet wurden zudem das
Einsperren ins Zimmer (10,6 Prozent) und die
Kommunikationsverweigerung gegenüber dem Kind (9,4 Prozent).
Knapp zwei Drittel der Befragten mit Erziehungserfahrung
gaben an, keine emotionalen Strafen angewandt zu haben.
Diskrepanz zwischen Einstellungen und Handeln –
weitere Anstrengungen notwendig
Die Verankerung
des Rechts auf gewaltfreie Erziehung war ein
gesellschaftlicher Wendepunkt, dessen Wirkung bis heute
spürbar ist. Seitdem ist die Akzeptanz körperlicher Strafen
deutlich gesunken und das Bewusstsein für die Rechte von
Kindern hat spürbar zugenommen. Dennoch bleibt viel zu tun,
um Kinder wirksam vor Gewalt in der Erziehung zu schützen.
Aus Sicht von UNICEF Deutschland und dem Kinder- und
Jugendpsychiater und Psychotherapeut Prof. Dr. Jörg M.
Fegert ist es daher entscheidend, das Recht auf gewaltfreie
Erziehung in allen gesellschaftlichen Bereichen weiter zu
stärken.
„Im Hinblick auf emotionale Gewalt bleibt
die Lücke zwischen Wissen und Handeln groß. Zwar wissen
viele Menschen, dass emotionale Strafen in der Erziehung
nicht mehr angemessen sind – wenden sie jedoch trotzdem an.
Auf der Handlungsebene besteht also noch erheblicher Bedarf
an Aufklärung, Prävention und Unterstützung“, so Prof. Dr.
Jörg M. Fegert. „Besonders wichtig ist es, Menschen zu
erreichen, die selbst emotionale Gewalt in ihrer Kindheit
erlebt haben. Bei ihnen ist das Risiko erhöht, entsprechende
Muster weiterzugeben.“
Auch Christian Schneider,
Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, betont: „Gewalt
hinterlässt Spuren – oft ein Leben lang. Körperliche und
emotionale Gewalt gefährden nicht nur die Gesundheit von
Kindern, sondern auch ihre Bildungschancen und ihre
seelische Gesundheit im Erwachsenenalter. Gerade in einer
sich verändernden Welt muss der Schutz vor Gewalt in der
Kindheit endlich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ernst
genommen und deutlich verstärkt werden.“
Weitere
Ergebnisse der Befragung
Nur rund die Hälfte der
Befragten gibt an, keine emotionalen Strafen in ihrer
eigenen Erziehung erlebt zu haben. Wer in der Kindheit
selbst emotionale Strafen erlebt hat, stimmt solchen
Erziehungsmethoden deutlich häufiger zu. Rund die Hälfte der
Befragten mit eigener Erfahrung stimmen emotionalen Strafen
zu (49,3 Prozent), gegenüber nur zwei Prozent ohne
entsprechende Erfahrungen.
Während zwei Drittel der
Befragten mit eigener Erfahrung emotionaler Strafen angibt,
diese Erziehungsmethoden auch bei den eigenen Kindern
angewendet zu haben, liegt dieser Anteil bei denen ohne
solche Erfahrungen lediglich bei 5,4 Prozent.
Maßnahmen zum nachhaltigen Schutz von Kindern vor
Gewalt
Folgende Ansätze sind dringend notwendig,
um Kinder nachhaltig vor Gewalt zu schützen:
Kinderrechte
stärken: Die Geschichte der gewaltfreien Erziehung in
Deutschland zeigt, wie gesetzliche Maßnahmen zu nachhaltiger
positiver gesellschaftlicher Veränderung führen. Eine
Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz würde die
Rechtsposition von Kindern zusätzlich stärken und so die
Rahmenbedingungen für einen wirksamen Kinderschutz und die
Teilhabe von Kindern in allen Lebensbereichen verbessern.
Den Begriff der gewaltfreien Erziehung erweitern: Die
gesetzliche Norm zum Recht auf gewaltfreie Erziehung
berücksichtigt bislang nicht die Misshandlungsform der
Vernachlässigung. Während körperliche und zunehmend auch
emotionale Gewalt gesellschaftlich weitgehend abgelehnt
werden, fehlt die gleiche Sensibilisierung für die Folgen
unterlassener Fürsorge.
Der Begriff der
gewaltfreien Erziehung sollte daher im Bürgerlichen
Gesetzbuch auf Vernachlässigung ausgeweitet und auch diese
Form der Gewalt gesetzlich geächtet werden.
Gezielte Prävention fördern: Um Kinder wirksam zu schützen,
sollte das Bewusstsein für die Folgen körperlicher und
psychischer Gewalt gestärkt und Prävention an aktuelle
Realitäten angepasst werden. Neben Aufklärungskampagnen
braucht es gezielte Strategien, die auch die digitalen
Lebenswelten junger Menschen und das Setting Familie
berücksichtigen.
Neben allgemeiner Aufklärung und
Sensibilisierung sollten zudem gezielte
Unterstützungsangebote für Risikogruppen sowie frühzeitige
Hilfen bei erkennbaren Belastungen ermöglicht werden, um
Gewalt in der Erziehung vorzubeugen (Verankerung selektiver
und indizierter Prävention zusätzlich zur Primärprävention
in § 20 SGB V).
Datenlage zu Gewalt in der Erziehung
verbessern: Die Datenlage zur Gewalt in der Erziehung in
Deutschland ist weiterhin lückenhaft. Systematische
Datenerhebungen sind entscheidend, um Ausmaß und Risiken zu
erkennen, wirksam gegenzusteuern und politischen wie
gesellschaftlichen Handlungsdruck zum besseren Schutz von
Kindern aufzubauen – gerade in Zeiten tiefgreifender
digitaler Veränderungen.
|
|
Waffenruhe ist Hoffnungsschimmer für Kinder im
Gazastreifen |
|
Statement von
Ricardo Pires, stellv. UNICEF-Sprecher, beim heutigen
Pressebriefing im Palais des Nations in Genf
Genf/Köln, 10. Oktober 2025 - „Ich beginne mit den Stimmen
zweier Kinder aus Deir al-Balah im Süden Gazas, mit denen
UNICEF gesprochen hat. Ihre Reaktion auf die gestrige
Nachricht über die Vereinbarung im Hinblick auf eine
Waffenruhe und ein Ende des Krieges im Gazastreifen sagt
mehr als jedes Wort, das ich heute sagen könnte.
Maisara ist 13 Jahre alt. ‚Ich war glücklich, als ich von
der Waffenruhe hörte. Endlich kann ich in meine Stadt im
Norden zurückkehren – denn wie alle Kinder sind wir müde vom
Krieg. Wir wollen unsere Kindheit zurück. Am meisten freut
mich, dass wir nicht länger hungern müssen‘, sagte er. ‚Ich
werde die Erde meiner Stadt umarmen, weil ich sie so sehr
vermisst habe. Zurückzukehren bedeutet, wieder zur Schule zu
gehen und ein normales Leben zu führen.‘
Rasha ist
ebenfalls 13 Jahre alt. Sie sagte: ‚Ich vermisse meine
Cousins. Wir möchten sie auf dem Friedhof im Osten des Camps
Bureij besuchen. Und wir wollen unsere Familien in
Gaza-Stadt wiedersehen. Seit die Waffenruhe verkündet wurde,
sind wir alle glücklich.‘
Dies sind nur zwei von über
einer Million Kindern, die seit mehr als zwei Jahren auf
diesen Tag warten – mehr als zwei Jahre unvorstellbaren
Leids.
Die Nachricht über die Waffenruhe ist ein
dringend benötigter, längst überfälliger Hoffnungsschimmer
für sie und ihre Familien. Jetzt gilt es, diese Hoffnung
nicht zu enttäuschen und schnell und entschlossenen zu
handeln.
Es ist entscheidend, dass alle
Konfliktparteien alles tun, um die Vereinbarung umzusetzen,
aufrechtzuerhalten und zu einem dauerhaften Frieden zu
führen. In den Stunden bis zum offiziellen Inkrafttreten der
Waffenruhe müssen Kinder geschützt werden.
Die
Waffenruhe bringt Hoffnung, dass das Töten und Verstümmeln
von Kindern endlich aufhört. Mehr als 64.000 Kinder wurden
durch Angriffe des israelischen Militärs getötet oder
verletzt. Etwa 25 Prozent von ihnen tragen womöglich
lebensverändernde Verletzungen davon.
UNICEF steht
bereit. Die Hilfe muss fließen. Israel muss so viele
Grenzübergänge wie möglich öffnen. Die Lage ist kritisch.
Die Kindersterblichkeit droht zu steigen – nicht nur bei
Neugeborenen, sondern auch bei Kleinkindern, deren
Immunsysteme stärker geschwächt sind, als je zuvor und die
über so lange Zeit keinen Zugang zu angemessener Nahrung
hatten.
Hinzu kommt, dass der bevorstehende kalte
Winter ohne ausreichenden Schutz und Kleidung tödlich sein
kann. Im vergangenen Jahr starben Neugeborene an
Unterkühlung.
UNICEF ist auf diese Situation
vorbereitet. Da es Monate dauert, um Hilfsgüter aus aller
Welt nach Gaza zu bringen, hat UNICEF bereits im Juli
angefangen, Planen und Winterkleidung zu beschaffen.
Unser Ziel ist es, jedes Kind unter zwölf Monaten mit zwei
Winterkleidungs-Kits zu erreichen und eine Million Decken
für alle Kinder in Gaza bereitzustellen.
Die Liste
geht weiter: Wir bereiten Hilfsgüter für die vielen tausend
verletzten Kinder vor, denn vieles, wie Rollstühle und
Krücken durfte lange nicht geliefert werden.
Wir
stehen bereit, die Wasserversorgung sowie die Entwässerungs-
und Abwassersysteme wieder herzustellen sowie die
Müllentsorgung zu unterstützen.
Und als oberste
Priorität muss die Vereinbarung natürlich genutzt werden, um
Mangelernährung und die Ausweitung der Hungersnot zu
verhindern. UNICEF ist in der Lage, die Ernährungslage von
50.000 Kindern unter fünf Jahren sowie 60.000 schwangeren
und stillenden Müttern zu verbessern. Wir haben dies in den
letzten Monaten bereits getan, doch wir müssen Gaza endlich
mit ausreichend Spezialnahrung und Behandlungsmöglichkeiten
erreichen können.
Ein echter Waffenstillstand muss
mehr als Worte bedeuten. Er muss aufrechterhalten und
respektiert werden – und die Rechte von Kindern müssen dabei
im Mittelpunkt stehen. Das bedeutet, alle Grenzübergänge für
humanitäre Hilfe zu öffnen und sicherzustellen, dass jedes
Kind von Norden bis Süden mit dem Lebensnotwendigsten
erreicht wird.
Humanitäre Hilfe ist jedoch nur der
Anfang. Kinder in Gaza brauchen wieder geöffnete Schulen,
Spielplätze und Zeit, um sich von dem unvorstellbaren Trauma
zu erholen. Die Waffenruhe muss Bedingungen schaffen für
sowohl dringend benötigte humanitäre Hilfe als auch für
einen langfristigen Wiederaufbau, damit Kinder wie Maisara
und Rasha ihre Kindheit zurückgewinnen können. Der Weg wird
lang sein.”
|
|
„Kinderrechte – Bausteine
für Demokratie!“
|
|
Weltkindertag 2025: Über 1.000 Kinder und Jugendliche rufen
bundesweit mit UNICEF und Deutschem Kinderhilfswerk zur
Umsetzung der Kinderrechte auf

Weltkindertag 2025: Kinder und Jugendliche bauten am Vortag
des Weltkindertags ein "Haus der Kinderrechte" mit
Forderungen und Wünschen zum diesjährigen
Weltkindertagsmotto: "Kinderrechte - Bausteine für
Demokratie!" vor dem Brandenburger Tor in Berlin. © Paula G.
Vidal
Berlin/Köln/Duisburg, 19. September 2025 - Zum
Weltkindertag am 20. September fordern das Deutsche
Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland von Politik und
Gesellschaft mit Nachdruck, die in der
UN-Kinderrechtskonvention verankerten Rechte der Kinder
vollständig umzusetzen. Dafür müssen die Interessen und
Belange von Kindern und Jugendlichen und ihre aktive
Beteiligung in politischen Entscheidungsprozessen umgesetzt
werden – in Deutschland und in der internationalen
Zusammenarbeit der Bundesregierung.
Denn die
Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht,
betreffen nicht nur Deutschland. Der bröckelnde
gesellschaftliche Zusammenhalt, eine veränderte Lebenswelt,
die sich immer mehr in digitalen Räumen vollzieht, sowie
globale Krisen schmälern die Zukunftschancen der Kinder
weltweit und nehmen ihnen die Möglichkeit, ihre Stimme zu
erheben. Auch die globalen Kürzungen in der humanitären
Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit wirken sich gravierend
auf die Lebensbedingungen von Kindern weltweit aus.
Für UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk ist
die Umsetzung der Kinderrechte, besonders das Recht auf
Mitbestimmung, grundlegend für das Wohlergehen der jungen
Generation. Auch in Deutschland muss den Kinderrechten mehr
Geltung verschafft werden. Dafür braucht es vor allem die
Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz, entschiedene
Maßnahmen gegen die Kinderarmut, und einen verstärkten
Ausbau der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen.
Diese politische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe
ist entscheidend für die Stärkung des sozialen Zusammenhalts
und den Schutz unserer Demokratie. Kinder und Jugendliche
setzten aus diesem Anlass heute zusammen mit den beiden
Kinderrechtsorganisationen vor dem Brandenburger Tor ein
unübersehbares Zeichen für Kinderrechte.
„Haus der
Kinderrechte” am Brandenburger Tor
Dabei präsentierten
Kinder und Jugendliche auf dem Pariser Platz in Berlin in
Anwesenheit von Dr. Petra Bahr, Staatssekretärin bei der
Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, ein „Haus der Kinderrechte“. Das kreative Bauwerk
besteht aus einer Auswahl bunter Kinderrechte-Bausteine aus
über 1.000 eingesendeten Forderungen und Wünschen junger
Menschen aus ganz Deutschland zum Motto des Weltkindertags
„Kinderrechte - Bausteine für Demokratie!“.
Auf
einem der eingesendeten Bausteine steht geschrieben: “Schutz
vor Gewalt, das Recht auf Bildung, das Recht auf
Beteiligung” – ein Ausdruck für einige der drängendsten
Rechte für Kinder in Deutschland und weltweit.
Das
Dach bildet eine eindrucksvolle kinderfreundliche Welt aus
Spielbausteinen. Eine dritte Klasse der Löcknitz-Grundschule
aus Berlin hatte diese mit den beiden
Kinderrechtsorganisationen in einem Workshop kreiert.
Unterstützt wurden sie dabei von einem Team von LEGOLAND
Discovery Centre Berlin, das die Aktion mit zahlreichen
LEGO-Bausteinen unterstützte und den Schülerinnen und
Schülern beim Bau zur Seite stand.
Mit dem kreativen
Bauwerk bringen die Kinder die bundesweiten Ideen und ihre
eigenen Visionen für eine kinderfreundliche Zukunft zum
Ausdruck: etwa ein großes LEGO-Haus, in dem auch geflüchtete
Kinder ein sicheres Dach und ein warmes Bett haben, einen
Park mit schönen Toiletten und vielen Bäumen, einen voll
bewachsenen LEGO-Regenwald mit geschützten Tieren und eine
Schule für alle Kinder, mit vielen Pflanzen und neuen
Büchern, in der das Lernen Spaß macht.
Die Stimmen
der jungen Generation
Während der Veranstaltung trugen
Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirats des Deutschen
Kinderhilfswerkes und des UNICEF-JuniorTeams ihre wichtigen
Botschaften vor: „Kinderrechte sind nicht verhandelbar. Ihre
Durchsetzung ist das Fundament einer nachhaltigen, gerechten
und friedlichen Welt. Eine Gesellschaft, die die Kinder und
ihre Rechte nicht schützt, hat keine Zukunft”, sagten
Matilda (17 Jahre) und Olivia (18 Jahre) aus dem JuniorTeam
von UNICEF Deutschland.
„Ich finde, Kinderrechte
müssen endlich ins Grundgesetz, damit sie wirklich ernst
genommen werden. Kinder sollen nicht nur geschützt werden,
sondern auch mitbestimmen können, weil es um ihre Zukunft
geht. Demokratie heißt, dass alle gehört werden, auch
Kinder. Deshalb ist es wichtig, dass Politik Kinderrechte
stärker beachtet“, sagte der 13-jährige Nathan aus Köln,
Mitglied im Kinder- und Jugendbeirat des Deutschen
Kinderhilfswerkes.
Dr. Petra Bahr, Staatssekretärin
im BMBFSFJ: „Kinderrechte sind das Fundament einer
lebendigen Demokratie. Jedes Kind hat ein Recht auf Schutz,
Förderung und Beteiligung. Als Bundesregierung setzen wir
uns dafür ein, dass Kinder und Jugendliche ihre Rechte nicht
nur kennen, sondern auch im Alltag erfahren und aktiv
mitgestalten können – in der Familie, in der Kita, in der
Schule und in der ganzen Gesellschaft. Denn unsere
Demokratie bleibt nur dann zukunftsfähig, wenn junge
Menschen ihre Stimme erheben und gehört werden.“
Dagmar Wöhrl, Botschafterin von UNICEF Deutschland, sagte:
„Kinder sind das verletzlichste und zugleich wichtigste
Glied in unserer Gesellschaft. Sie sind die Zukunft. Doch
leider verlieren Kinder durch Kriege, den Klimawandel,
Flucht und Hunger nicht nur ihre Sicherheit und ihre Familie
– sie verlieren vor allem ihre Kindheit und die Kraft, ihre
eigene Zukunft mitzugestalten. Deshalb dürfen wir keine Zeit
mehr verlieren: Es liegt an uns allen Kindern, hier und
weltweit, eine Zukunft zu sichern.“
Anja Siegesmund,
Vorstandsmitglied des Deutschen Kinderhilfswerkes, ergänzte:
„Es lohnt sich, wenn Kinder und Jugendliche so früh wie
möglich Beteiligung lernen und selbstwirksam werden. Ob
Spielplatz, Radweg oder Jugendparlament – sich füreinander
und miteinander einzusetzen, ist ein Wert an sich. Dieser
Wert braucht ein starkes Fundament, das die Politik endlich
schaffen muss: Kinderrechte gehören ins Grundgesetz. Und wir
brauchen eine bessere Verankerung von Demokratiebildung in
Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, in
Kindertageseinrichtungen sowie in Schulen und Schulhorten.
Hier liegt noch viel Arbeit vor uns.”
Bundesweite
Aktionen zum Mitmachen
Im Rahmen des Weltkindertags unter
dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“ finden
in ganz Deutschland zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen
statt. UNICEF Deutschland lädt Kinder und ihre Familien ein,
aktiv zu werden: Mit selbstgestalteten
Kinderrechte-Bausteinen und -Puzzlestücken sowie
Freundschaftsarmbändern für mehr Zusammenhalt, können Kinder
ihre Wünsche für eine kindgerechte Zukunft zum Ausdruck
bringen. Unter dem Hashtag #wiestarkwäredasdenn können
Familien und Einrichtungen Fotos ihrer Kreativaktionen in
sozialen Medien teilen.
Zudem feiert das Deutsche
Kinderhilfswerk den Weltkindertag den ganzen September
hindurch mit einem digitalen „Kinderrechte-Spezial“ auf
www.kindersache.de. Dabei können die Kinder in vielen
interessanten Artikeln mehr über ihre Rechte erfahren und
zudem selbst aktiv und kreativ werden. Der Fokus liegt dabei
auf partizipativen Angeboten, die die Kinder zum Mitmachen
anregen und Spaß machen. Statt Kinderrechte abstrakt zu
erklären, geht es vielmehr darum, sie erlebbar zu machen und
über sie ins Gespräch zu kommen. Wir laden alle ein, sich am
Weltkindertag für die Rechte von Kindern und Jugendlichen
starkzumachen!
Die Geschichte des Weltkindertags
Im September 1954 empfahlen die Vereinten Nationen ihren
Mitgliedstaaten die Einführung eines weltweiten Tages für
Kinder. Sie wollten damit den Einsatz für Kinderrechte
stärken, die Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen auf
der Welt fördern und die Regierungen auffordern, die
weltweite UNICEF-Arbeit zu unterstützen. Inzwischen wird der
Weltkindertag in über 145 Staaten gefeiert; seit 1989 sind
die Kinderrechte mit einer UN-Konvention für jedes Kind
verbrieft.
|
|
Weltkindertag 2025: „Kinderrechte
– Bausteine für Demokratie!“
|
|
Berlin/Duisburg,
11. September 2025 - Am Vortag des Weltkindertages 2025
setzen Kinder und Jugendliche gemeinsam mit dem Deutschen
Kinderhilfswerk (DKHW) und UNICEF Deutschland unter dem
Motto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“ vor dem
Brandenburger Tor ein unübersehbares Zeichen für die Rechte
der Kinder und mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt.

© UNICEF Deutschland
Dafür werden
Schülerinnen und Schüler der Löcknitz-Grundschule Berlin
gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen des Kinder- und
Jugendbeirates des Deutschen Kinderhilfswerkes und des
UNICEF-JuniorTeams auf dem Pariser Platz ein „Haus der
Kinderrechte“ präsentieren. Das bunte Bauwerk besteht aus
bemalten Kinderrechte-Bausteinen aus über 700 bundesweit
eingesendeten Forderungen und Wünschen junger Menschen zum
Motto des Weltkindertags „Kinderrechte - Bausteine für
Demokratie!“.
Zu der Mitmachaktion hatten die beiden
Kinderrechtsorganisationen aufgerufen. Das kreative Dach des
“Haus der Kinderrechte” besteht aus einer eindrucksvollen
kinderfreundlichen Welt aus LEGO-Spielbausteinen. Eine
dritte Klasse der Löcknitz-Grundschule aus Berlin hatte
diese in einem Kinderrechte-Workshop kreiert und sich
gefragt “Was braucht es aus unserer Sicht für eine
kinderfreundliche Zukunft?”
Unterstützt wurden sie
dabei von einem Team von UNICEF, dem Deutschen
Kinderhilfswerk und LEGOLAND Discovery Centre Berlin. Ihre
Forderungen und Wünsche richten die Kinder und Jugendlichen
vor Ort an Dr. Petra Bahr, Staatssekretärin bei der
Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und
Jugend.
|
|
„Kinder in Not und humanitäre Teams dürfen niemals
Zielscheibe von Angriffen sein“
|
|
UNICEF
Deutschland zum Welttag der humanitären Hilfe am 19.8.

© UNICEF/UN0718987/Ibarra Sánchez
Köln/Duisburg, 18.
August 2025 - Schwere Kinderrechtsverletzungen in Kriegs-
und Konfliktgebieten so hoch wie nie / Kürzungen von
weltweiten Hilfsgeldern gefährden Programme für Kinder.
Nie zuvor sind so viele Kinder in Konfliktgebieten
aufgewachsen. Gleichzeitig haben schwere
Kinderrechtsverletzungen und Angriffe auf humanitäre
Helferinnen und Helfer im vergangenen Jahr einen Höchststand
erreicht. Anlässlich des Welttages der humanitären Hilfe
ruft UNICEF Deutschland dazu auf, Kinder in Not sowie
humanitäre Teams zu schützen.
Christian Schneider,
Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, sagte:
„Kinder in
der Ukraine, deren Schulen und Spielplätze bombardiert
werden; Kinder in Gaza, die vor den Augen ihrer Eltern
verhungern; Mädchen im Sudan, die sexualisierte Gewalt
erleiden. Immer häufiger missachten Konfliktparteien eine
der wichtigsten Grundregeln des Krieges: den besonderen
Schutz von Kindern. Und immer öfter geraten humanitäre Teams
bei ihrem lebensrettenden Einsatz für Kinder ins Kreuzfeuer.
Die steigenden Bedarfe angesichts der Vielzahl großer
Krisen, die zunehmend erschwerten Einsatzbedingungen für
humanitäre Teams sowie der eingeschränkte Zugang zu Menschen
in schwerster Not setzen das humanitäre System erheblich
unter Druck. Weltweite Kürzungen bei den internationalen
Hilfsgeldern verschärfen die Lage zusätzlich – gerade in
einer Zeit, in der Kinder mehr denn je auf Unterstützung
angewiesen sind.
Der Schutz der Kinder und ihr
sicherer Zugang zu Nahrung, medizinischer Versorgung und
Lernangeboten müssen verteidigt werden. Kinder und die Hilfe
für Kinder dürfen niemals Ziel von Angriffen sein.“
Gewalt und Not prägen das Aufwachsen von Kindern im Krieg
Jedes sechste Kind lebt heute in einem Konfliktgebiet. Im
vergangenen Jahr haben die Vereinten Nationen 41.370 schwere
Kinderrechtsverletzungen verifiziert – so viele wie noch
nie.
Im Gazastreifen erleben Kinder unvorstellbare
Not. Die Schwellenwerte bei zwei von drei Indikatoren, die
auf eine Hungersnot hindeuten, wurden bereits teilweise
überschritten. Mehr als 320.000 Kinder – und somit alle
Kinder unter fünf Jahren im Gazastreifen – sind von akuter
Mangelernährung bedroht. Dutzende Kinder verhungern, weil
ihnen lebensrettende Hilfe verwehrt wird. Mehr als 500
humanitäre Helferinnen und Helfer wurden seit Oktober 2023
getötet. Gleichzeitig ist der UNICEF-Nothilfeaufruf für
Kinder nur zu einem Drittel finanziert.
Im Sudan
weitet sich die Hungersnot weiter aus, doch die Welt schaut
weg. In keinem anderen Land der Welt haben so viele Kinder
ihr Zuhause verloren. Es vergeht kaum ein Tag ohne Berichte
über getötete oder verletzte Kinder. Cholera greift um sich
– allein in Tawila im Norden Darfurs wurden bis Anfang
August 1.180 Fälle gemeldet. In der Region Darfur hat sich
die Zahl der lebensbedrohlich mangelernährten Kinder in den
ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum fast verdoppelt. Auch im Sudan sind mehr
als 60 Prozent der humanitären Finanzierungsbedarfe von
UNICEF für das laufende Jahr noch nicht gedeckt.
Seit
Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine wurden rund
2.800 Kinder und Jugendliche getötet oder verletzt. Rund 1,2
Millionen Schulkinder – etwa 35 Prozent – lernen
ausschließlich online oder im Rahmen eines Hybridkonzepts
aus Präsenz- und Online-Unterricht. Fast jedes zweite Kind
hat keinen Zugang zu einem Ort zum Spielen, weder zu Hause
noch anderswo. In der Ukraine ist der UNICEF-Nothilfeaufruf
nur zu 62 Prozent finanziert.
Unterstützung für
Kinder darf nicht nachlassen
„Humanitäre Hilfe rettet
Leben. Voraussetzung ist, dass sie gemäß den humanitären
Prinzipen geleistet wird und die Helferinnen und Helfer
sicheren und umfassenden Zugang zu Menschen in Not haben“,
so Schneider. So konnten UNICEF und seine Partner
beispielsweise im Gazastreifen trotz enormer
Herausforderungen im Herbst 2024 und Februar 2025 rund
600.000 Kinder unter zehn Jahren gegen Polio impfen, nachdem
das Virus dort festgestellt wurde.
Gemeinsam mit dem
Unternehmen für Außenwerbung und digitale Kommunikation
STRÖER startet UNICEF Deutschland rund um den Welttag der
humanitären Hilfe am 19. August eine gemeinsame Kampagne, um
für Solidarität für Kinder in humanitären Notlagen
aufzurufen.
„Angesichts anhaltender Krisen und einer
stetig wachsenden Zahl von Kindern, die Hilfe benötigen,
darf die Unterstützung gerade jetzt nicht nachlassen. Unsere
Verantwortung ist größer denn je – das gilt für die
Weltgemeinschaft wie für die Bundesregierung, aber auch für
alle Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Kinder brauchen
unsere Solidarität. Darauf möchten wir mit der Kampagne
aufmerksam machen", so Schneider.
„In einer Zeit
zunehmender Not ist es unsere Aufgabe als Gesellschaft,
Rückhalt zu zeigen, insbesondere für Kinder in Kriegs- und
Konfliktgebieten. Wir schauen nicht weg, sondern machen
sichtbar, wie bedeutend humanitäre Hilfe für Kinder in Not
ist. Dafür stellen wir gerne unsere frei zugänglichen Medien
im öffentlichen Bereich zur Verfügung", sagte Alexander
Stotz, CEO der STRÖER Media Deutschland GmbH.
|
|
UNICEF: Zahl der getöteten oder verletzten Kinder in
der Ukraine verdreifacht |
|
Nach einem Angriff
auf ein Wohnhaus in der Ukraine haben Jugendliche für ihren
17-jährigen getöteten Freund Blumen und Plüschtiere zum
Gedenken hingelegt.

© UNICEF/UNI784748/Filippov
Kiew/ Genf/Köln/Duisburg, 4. Juli 2025 - 222 Kinder und
Jugendliche in der Ukraine wurden laut neuen von den
Vereinten Nationen verifizierten Daten im Zeitraum vom 1.
März bis 31. Mai getötet oder verletzt. Das sind drei Mal so
viele wie in den drei Monaten davor: Vom 1. Dezember 2024
bis 28. Februar 2025 sind laut UN-
Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine 73 Kinder
getötet oder verletzt worden.
Besonders tödlich und
zerstörerisch ist der anhaltende Einsatz von Explosivwaffen
in Wohngebieten. Allein im April dieses Jahres wurden 97
Kinder getötet oder verstümmelt, die höchste von den
Vereinten Nationen verifizierte Zahl von minderjährigen
Opfern in einem einzelnen Monat seit Juni 2022.
„Für
die Kinder in der Ukraine gibt es keine Atempause vom
Krieg“, sagte die UNICEF-Regionaldirektorin für Europa und
Zentralasien, Regina De Dominicis. „Die Situation der Kinder
ist extrem kritisch, da die intensiven Angriffe weiterhin
nicht nur Leben vernichten, sondern auch darüber hinaus
jeden Aspekt von Kindheit zerstören.“
Die Zerstörung
und Beschädigung von Krankenhäusern, Schulen, Wasser- und
Stromnetzen und sicheren Spielorten hat Auswirkungen auf die
Kinder – jetzt und auf lange Sicht. Gleichzeitig führen die
heftigen Kämpfe in den Gebieten im Nordosten und Osten des
Landes dazu, dass weiterhin eine große Zahl von Menschen aus
ihren Häusern fliehen muss. Sie brauchen dringend humanitäre
Hilfe, zum Beispiel Bargeld, Wasser und Lebensmittel sowie
psychosoziale Hilfe für Kinder.
Neue Gefahren für
Kinder durch moderne Kriegsführung
Es entstehen auch neue
Bedrohungen für Kinder, da die moderne Kriegsführung
Online-Risiken mit tödlichen Offline-Auswirkungen verbindet.
Besonders besorgniserregend ist aus Sicht von UNICEF, dass
Kinder und Jugendliche durch Online-Beeinflussung dazu
gebracht werden, Aktivitäten in der Ukraine auszuüben, zum
Beispiel Angriffe auf militärische Objekte, Sabotage oder
Informationsbeschaffung. Das gefährdet ihre Sicherheit und
ihr Wohlergehen.
Wie die
UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine
berichtet, wurden bei solchen Handlungen mindestens zwei
Jungen getötet und ein weiterer Junge verletzt. Darüber
hinaus wurden Berichten zufolge 91 Jungen und zwölf Mädchen
inhaftiert, wobei 42 Kinder wegen ihrer Beteiligung an dem
Konflikt verurteilt wurden, was nach Angaben der
ukrainischen Strafverfolgungsbehörden zur Inhaftierung von
mindestens sieben Kindern führte.
Der Einsatz von
Kindern durch Konfliktparteien muss aufhören. Die Behörden
werden dringend aufgefordert, Kinder als Opfer zu behandeln
und rasch Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu unterstützen und
zu schützen, unter anderem durch die Gewährleistung des
Zugangs zu kinderfreundlichen Justizdiensten.
UNICEF
arbeitet mit der ukrainischen Regierung zusammen, um das
kinderfreundliche Justizsystem zu stärken, das Kinder stärkt
und schützt. Das heißt, den Zugang zu umfassenden
rechtlichen Unterstützungsdiensten sicherzustellen,
Alternativen zur Inhaftierung zu fördern und den Schwerpunkt
auf wiederherstellende Gerechtigkeit und Rehabilitation zu
legen, die auf die individuellen Bedürfnisse und das beste
Interesse jedes Kindes zugeschnitten sind.
UNICEF
fordert zudem erneut die Einhaltung des humanitären
Völkerrechts und der Menschenrechte sowie die Beendigung und
Verhinderung schwerwiegender Verstöße gegen die Rechte der
Kinder.
Kinder brauchen einen nachhaltigen und
dauerhaften Frieden. Ihre Rechte und ihr Wohlergehen müssen
geschützt und vorrangig behandelt werden.
UNICEF ruft
weiterhin zu Spenden für die Kinder in der Ukraine auf.
Weitere Informationen und Spendenmöglichkeit:
www.unicef.de/ukraine.
|
|
Steigende Not, knappe Budgets: Spenden für Kinder
werden immer wichtiger |
|
UNICEF
Deutschland legt Geschäftsbericht für 2024 vor

© UNICEF/UNI403549/Karimi
Köln/Berlin, 3. Juli 2025 -
Die aktuelle Vielzahl komplexer Krisen und gewaltsamer
Konflikte hat gravierende Folgen für das Überleben, die
Entwicklung und die Zukunftschancen von Kindern weltweit,
insbesondere in Krisengebieten wie dem Sudan, der Ukraine
und dem Gazastreifen. Jedes sechste Kind weltweit wächst in
einer Konfliktregion auf. Die Folgen der Klimakrise treffen
die ärmsten Familien am härtesten. Gleichzeitig müssen immer
mehr Kinder ihr Zuhause verlassen.
Ausgerechnet in
dieser kritischen Zeit für Kinder weltweit kürzen wichtige
staatliche Geber teils drastisch ihre Budgets für humanitäre
Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. UNICEF befürchtet,
dass dadurch schon kurzfristig und auf längere Sicht viele
akut mangelernährte Kinder keine lebensrettende Hilfe
erhalten und weniger Kinder geimpft oder mit sauberem
Trinkwasser versorgt werden können.
Die gute
Nachricht ist: Die Hilfsbereitschaft bleibt in Deutschland
hoch, wie der heute von UNICEF Deutschland veröffentlichte
Geschäftsbericht zeigt.
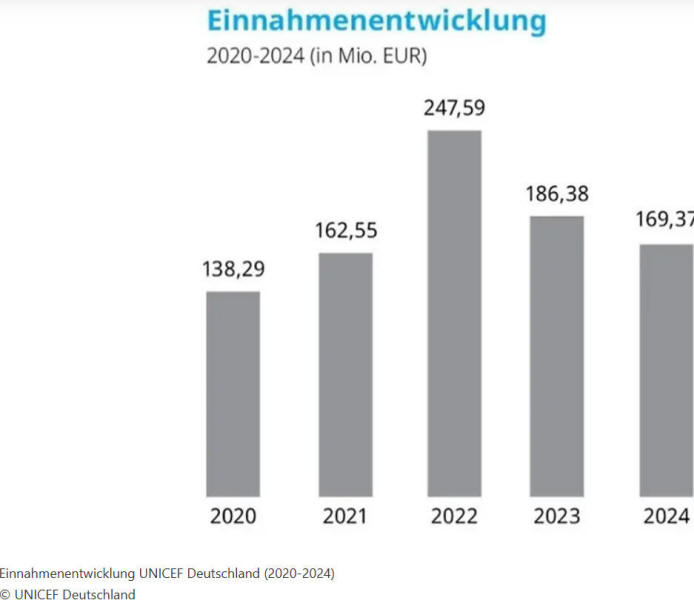
"Im vergangenen Jahr konnten wir erneut ein starkes
Spendenergebnis von mehr als 169 Millionen Euro verzeichnen.
Das zeigt: Die Spendenbereitschaft ist ungebrochen und
bleibt auf einem erfreulich hohen Niveau“, sagte Georg Graf
Waldersee, Vorsitzender von UNICEF Deutschland.
„Angesichts der umfassenden internationalen Kürzungen
öffentlicher Mittel für humanitäre Hilfe und
Entwicklungszusammenarbeit rechnen wir damit, dass das
Engagement von Privatpersonen und Unternehmen in den
kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Dass so
viele Menschen die Arbeit von UNICEF unterstützen, werten
wir auch als klares Signal an die Bundesregierung: Das
Engagement für Kinder in Not ist vielen Menschen ein
wichtiges Anliegen.“
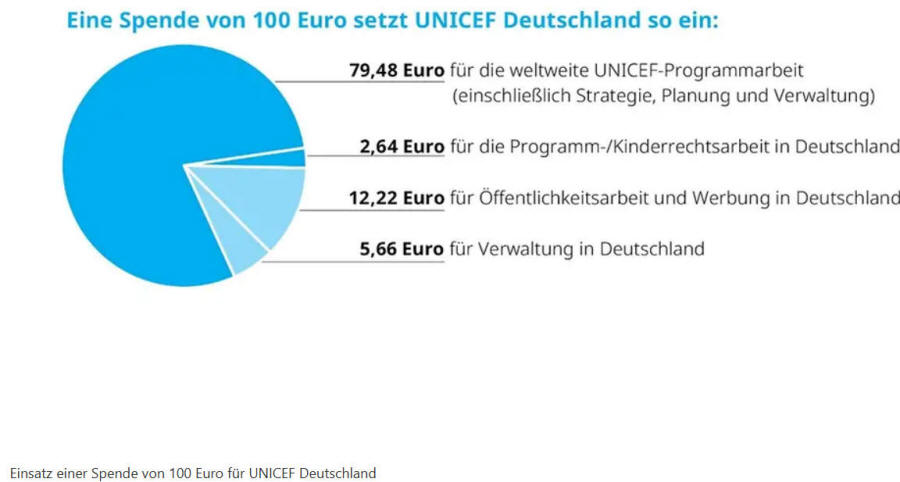
Das Deutsche Komitee für UNICEF e.V. ist mit
Gesamteinnahmen von rund 169,4 Millionen Euro eine der
wichtigsten Stützen der weltweiten Arbeit des
UN-Kinderhilfswerks UNICEF. Nur in den USA und in Japan kam
mehr private Unterstützung zusammen. Die Einnahmen setzen
sich aus rund 159,6 Millionen Euro Spenden und rund 9,8
Millionen Euro betrieblichen Erträgen (einschließlich
Einnahmen aus dem Grußkartenverkauf) zusammen.
Der
UNICEF-Geschäftsbericht 2024 wurde heute in Berlin von der
Mitgliederversammlung des Deutschen Komitee für UNICEF e.V.
entgegengenommen. Bei der Sitzung gab es auch wichtige
personelle Neuigkeiten: Dr. Emily Haber, ehemalige
Botschafterin und Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, und
Dr. Jörg Dräger, Geschäftsführender Stiftungsrat der
Kühne-Stiftung, wurden neu in den Vorstand von UNICEF
Deutschland gewählt. Die Mitgliederversammlung, auch Komitee
genannt, ist das oberste Gremium von UNICEF Deutschland. Sie
bestimmt die Grundsätze der Arbeit, wählt und entlastet den
Vorstand und stellt den Jahresabschluss fest. Alle
Mitglieder von Komitee und Vorstand arbeiten ehrenamtlich.
Rund 487.000 aktive Spender*innen
Zu dem guten
Spendenergebnis für UNICEF im Jahr 2024 haben rund 487.000
aktive Spender*innen beigetragen. Besonders wertvoll sind
die Dauerspenden ohne eine enge Zweckbindung von rund
309.000 Privatpersonen und Unternehmen, mit denen UNICEF
verlässlich planen und flexibel helfen kann, wo es für
Kinder am nötigsten ist. Auch mehr als 55.000
Grußkartenkäufer*innen haben UNICEF Deutschland unterstützt.
Die Einnahmen lagen 2024 unter denen des Vorjahrs (2023:
186,4 Millionen Euro), zugleich ist es das dritthöchste
Ergebnis seit der Gründung des Deutschen Komitees für UNICEF
im Jahr 1953. 2023 hatte das Erdbeben in Syrien und der
Türkei zu vielen Nothilfe-Spenden geführt, im Jahr zuvor
reagierten die UNICEF-Unterstützer*innen auf die Ausweitung
des Kriegs in der Ukraine mit einer außergewöhnlichen Welle
der Solidarität und dem bisher stärksten Spendenergebnis.
Trotz der 2024 geringeren Berichterstattung über die
humanitäre Lage in Krisenregionen haben zahlreiche Menschen
in Deutschland die Spendenaufrufe von UNICEF großzügig
unterstützt: Allein für die UNICEF-Nothilfe in der Ukraine
kamen 9,9 Millionen Euro zusammen, für die Kinder im
zerstörten Gazastreifen rund 8,7 und für den Einsatz im
Sudan gut 7,5 Millionen Euro.
Weltweite Hilfe für
Kinder und Familien
UNICEF hilft Kindern und Familien in
akuten Notlagen sowie durch langfriste Programme. Für diese
weltweite Programmarbeit konnte UNICEF Deutschland in 2024
insgesamt rund 129,4 Millionen Euro zur Verfügung stellen.
Auch dank dieser Unterstützung konnte UNICEF 2024 Millionen
von Kindern mit Trinkwasser, Nahrungshilfe, Bildungs- und
Gesundheitsangeboten, psychosozialer Hilfe und Programmen
für einen besseren Kinderschutz erreichen.
Zum
Beispiel wurden 600.000 Kinder in Gaza während Feuerpausen
gegen Polio geimpft und über 430.000 schwer mangelernährte
Kinder im Sudan mit lebensrettender therapeutischer Nahrung
versorgt.
Fast eine halbe Million Kinder und
Jugendliche in der Ukraine wurden mit Bildungsangeboten
erreicht: „UNICEF ist in der Ukraine sehr engagiert. Ich
kann mit eigenen Augen in meiner Stadt sehen, dass UNICEF
hier alles ist. Wir sind sehr dankbar dafür“, sagte der
16-jährige Nazarii aus Saporischschja dem UNICEF-Team in der
Ukraine.
Engagement in Deutschland: Für Kinder - und mit
ihnen
Auch in Deutschland setzt sich UNICEF für die
Verwirklichung der Rechte von Kindern ein: mit
Informationsarbeit und gezielter politischer
Interessenvertretung, mit kreativen Mitmachaktionen und
Programminitiativen. Unterstützt wird dieser Einsatz von
vielen Partnern und von rund 7.000 ehrenamtlich für UNICEF
Engagierten in ganz Deutschland. In mehr als 200 Gruppen
zeigen sie in ihren Städten und Gemeinden Flagge und bringen
dabei alle Generationen zusammen: Arbeits- und
Hochschulgruppen sowie JuniorTeams sind gemeinsam aktiv für
UNICEF.
Transparente Mittelverwendung
UNICEF
Deutschland trägt das Spendensiegel des Deutschen
Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) und wurde mehrfach
für vorbildliche Unternehmensführung und Transparenz
ausgezeichnet. Ein detaillierter Finanzbericht ergänzt den
Geschäftsbericht 2024.
2024 hat UNICEF Deutschland
fast 80 Prozent (79,5 Prozent) der Einnahmen für die
weltweite Programmarbeit sowie 2,6 Prozent für die Programm-
und Kinderrechtsarbeit in Deutschland verwendet. Die Kosten
für Verwaltung (5,7 Prozent) sowie Öffentlichkeitsarbeit und
Werbung in Deutschland (12,2 Prozent) betrugen 2024 – gemäß
den Kriterien des DZI – insgesamt 17,9 Prozent.
Der
UNICEF-Geschäftsbericht 2024 und der ausführliche
Finanzbericht stehen zur Verfügung unter
www.unicef.de/gb2024. Auf der Transparenz-Seite finden
Unterstützer*innen weitere umfassende Informationen – zum
Beispiel darüber, wie UNICEF arbeitet und die Spenden
einsetzt.
|
|
UNICEF Deutschland zum
Weltflüchtlingstag 2025
|
|
Geflüchtete Kinder in Deutschland brauchen schnellen
Zugang zu Bildung

© UNICEF/UNI647081/Vidal
2025
Berlin, 20. Juni 2025 - Nach
Schätzungen der Vereinten Nationen war Ende 2024 eine
Rekordzahl von weltweit 50 Millionen Kindern infolge von
Konflikten, Gewalt und anderen Krisen aus ihrer Heimat
vertrieben. Die Mehrheit der geflüchteten Kinder sucht
Schutz in der eigenen Region. Rund 84.000 Kinder haben im
vergangenen Jahr in Deutschland Asyl beantragt.
Zum
heutigen Weltflüchtlingstag mahnt UNICEF Deutschland:
Geflüchtete Kinder im schulpflichtigen Alter stoßen noch
immer auf erhebliche Hürden beim Zugang zur Schule. Die
nationale Umsetzung der EU-Asylrechtsreform bietet die
Möglichkeit, entscheidende Weichen für bessere
Bildungschancen zu stellen.
Christian Schneider,
Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, sagte: „Geflüchtete
Kinder in Deutschland müssen so schnell wie möglich in die
Schule gehen können– unabhängig von ihrer Herkunft oder
ihrem Aufenthaltsstatus. Das gibt ihnen nach dem Verlust
ihrer Heimat und der schweren Erfahrung von Krieg und Flucht
Halt und die Chance, ihr Potential zu entfalten.
Doch trotz wachsender Bemühungen um mehr
Bildungsgerechtigkeit warten viele Kinder monatelang darauf,
am Unterricht in regulären Schulklassen teilnehmen zu können
– manche von ihnen sogar mehr als ein Jahr. Für Kinder, die
durch oft jahrelange Flucht und die Situation in ihrem
Herkunftsland bereits große Lernlücken haben, steigt dadurch
das Risiko, langfristig abgehängt zu werden.
Umso
wichtiger ist es, die geplanten EU-Regelungen für einen
schnelleren Schulzugang konsequent umzusetzen. Bildung
stellt die Weichen – für die Zukunft jedes Kindes in unserem
Land und damit auch für unsere Gesellschaft.“
Gemäß
der neuen EU-Asylrechtsreform sollen überbrückende
Bildungsangebote für Kinder spätestens vier Wochen nach
Ankunft beginnen und der Übergang in die Regelschule
spätestens nach zwei Monaten erfolgen.
In seinen
heute veröffentlichten Empfehlungen „Ein Schulplatz für
jedes Kind“ ruft UNICEF Deutschland Bund, Länder und
Kommunen auf:
- die Vorgaben der EU-Asylrechtsreform
für den Zugang zu Schulbildung umfassend umzusetzen;
-
Kinder und ihre Familien schneller aus Aufnahmeeinrichtungen
in die Kommunen zu verteilen;
- geflüchtete Kinder und
Familien möglichst dezentral unterzubringen;
dafür zu
sorgen, dass die Schulpflicht für geflüchtete Kinder in ganz
Deutschland ab Einreise gilt;
- die Qualität bei
Übergangsangeboten zu sichern bzw. zu verbessern;
-
Kooperationen und Netzwerke von Schulen und anderen
wichtigen Partnern zu stärken;
- Schulen finanziell zu
unterstützen, um den Zugang von geflüchteten Kindern zu
Regelklassen und ihre Teilhabe zu fördern;
- und die
Datenlage zur Situation geflüchteter Kinder zu verbessern.
|
|
Tag der gewaltfreien Erziehung 2025: Akzeptanz
körperlicher Bestrafung auf historischem Tiefpunkt
|
|
Ablehnung von
Körperstrafen laut aktueller Befragung von UNICEF
Deutschland und der Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am
Universitätsklinikum Ulm so hoch wie nie – rund zwei Drittel
sind gegen sie

Kampagne #NiemalsGewalt | © UNICEF 2025
Berlin/Köln/Ulm/Duisburg, 30. April 2025 - Knapp 25 Jahre
nach der gesetzlichen Verankerung der gewaltfreien Erziehung
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist die gesellschaftliche
Akzeptanz körperlicher Bestrafung so gering wie nie zuvor.
Dies zeigt eine aktuelle, repräsentative Befragung der
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und
Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm in Kooperation
mit UNICEF Deutschland anlässlich des Tages der gewaltfreien
Erziehung am 30. April.
So ist der Anteil der
Menschen, die Gewalt anwenden bzw. als angebracht ansehen,
seit der Jahrtausendwende insgesamt gesunken. Gaben in einer
Befragung aus dem Jahr 2005 noch rund drei Viertel der
Befragten an, einen „Klaps auf den Hintern“ als
Erziehungsmethode verwendet zu haben, hielten 2016 noch 44,7
Prozent, 2020 noch 42,7 Prozent und 2025 30,9 Prozent diese
Strafe für angemessen – immerhin noch fast jede/r Dritte.
Im Jahr 2005 berichteten 53,7 Prozent der Befragten,
schon einmal eine „leichte Ohrfeige“ als Erziehungsmethode
eingesetzt zu haben, zwischen 2016 und 2020 stagnierten die
Zahlen hingegen bei 17,0 bzw. 17,6 Prozent. 2025 hielten
dies nur 14,5 Prozent der Befragten für angebracht.
Einführung der gewaltfreien Erziehung keine
Symbolpolitik – weitere Anstrengungen notwendig
Trotz der bislang erzielten Fortschritte bleibt einiges zu
tun. Laut UNICEF Deutschland und dem Kinder- und
Jugendpsychiater sowie Psychotherapeut Prof. Dr. Jörg M.
Fegert ist es unerlässlich, die Anstrengungen zum Schutz von
Kindern vor Gewalt weiter zu intensivieren. Denn noch immer
hält ein Teil der Bevölkerung körperliche oder emotionale
Strafen für angemessen. Insbesondere psychische Gewalt und
emotionale Bestrafung in der Erziehung erfahren nach wie vor
nicht die notwendige Aufmerksamkeit – trotz ihrer
nachgewiesenen negativen Auswirkungen auf die kindliche
Entwicklung.
„Die gesetzliche Verankerung der
gewaltfreien Erziehung im BGB war keine Symbolpolitik,
sondern ein bedeutender Meilenstein – mit konkreten
Auswirkungen auf die Einstellungen und das Handeln vieler
Eltern“, sagte Prof. Dr. Jörg M. Fegert. „Doch auch wenn der
Trend positiv ist, dürfen wir uns nicht ausruhen. Hinzu
kommt, dass die Misshandlungsform der Vernachlässigung –
also Gewalt durch Unterlassung – nach wie vor weitgehend
unbeachtet bleibt. Auch die Ächtung dieser Form der Gewalt
muss endlich gesetzlich verankert werden.“
„Das
Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung im Jahr 2000
war ein wegweisendes Signal: Gewalt als Mittel der Erziehung
ist niemals zu rechtfertigen und jedes Kind hat das Recht
auf Schutz vor jeglicher Form von Gewalt“, sagte Christian
Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland. „Es ist
eine dauerhafte gesellschaftliche Verantwortung, Kinder vor
psychischer und physischer Gewalt zu bewahren. Diese Aufgabe
hat auch heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt.“
„Seit Einführung des Gesetzes erfuhr die Ablehnung der
Gewalt in der Erziehung zunehmend mehr Akzeptanz,
insbesondere in der jüngeren Generation“, sagte Dr.
Christine Bergmann, ehemalige Bundesministerin für Familie,
Frauen, Senioren und Jugend. „Doch noch immer werden
grundlegende Kinderrechte nicht ausreichend beachtet. Ein
Neustart ist nötig: Um zu erreichen, dass bei allen
Angelegenheiten, die Kinder und Jugendliche betreffen,
zuerst an diese gedacht wird, bedarf es der Verankerung der
Kinderrechte im Grundgesetz.“
Weitere Ergebnisse der
Befragung
Die Zustimmung zu der Aussage „Ein Klaps auf
den Hintern hat noch keinem Kind geschadet“ lag 2016 bei
53,7 Prozent, 2020 bei 52,4 Prozent und sank 2025 auf 36,9
Prozent.
Die Zustimmung zu der Aussage „Eine Ohrfeige hat
noch keinem Kind geschadet“ liegt 2025 nun ebenfalls tiefer
bei 17,1 Prozent, während sie vom Jahr 2016 mit 23,2 Prozent
bis in das Jahr 2020 mit 23,1 Prozent stagnierte.
Die
Zustimmung zu der Aussage „Eine Tracht Prügel hat noch
keinem Kind geschadet“ sank 2025 auf einen Tiefpunkt mit 5,4
Prozent, während im Jahr 2020 sogar ein Anstieg der
Zustimmung zu verzeichnen war. 2016 lag die Zustimmung bei
5,9 Prozent und 2020 bei 7,2 Prozent.
Die grundsätzliche
allgemeine Zustimmung zu Körperstrafen in der Erziehung von
Kindern ist bei Männern größer als bei Frauen. Allerdings
sind auch hier starke Rückgänge im Vergleich zu 2020 zu
beobachten. 2025 stimmten noch 40,8 Prozent der Männer im
Vergleich zu 33,6 Prozent der Frauen der Aussage „Ein Klaps
auf den Hintern hat noch keinem Kind geschadet“ zu.
Gerade in der jüngeren Generation scheinen Zustimmungen zu
körperlichen Bestrafungen zunehmend zu schwinden.
Notwendige Maßnahmen zum nachhaltigen Schutz von Kindern vor
Gewalt
Nachfolgende Ansätze sind entscheidend, um Kinder
nachhaltig vor Gewalt zu schützen:
Kinderrechte stärken:
Die Geschichte der gewaltfreien Erziehung in Deutschland
zeigt, wie gesetzliche Maßnahmen zu nachhaltiger positiver
gesellschaftlicher Veränderung führen. Eine Aufnahme der
Kinderrechte ins Grundgesetz würde die Rechtsposition von
Kindern zusätzlich stärken und so die Rahmenbedingungen für
einen wirksamen Kinderschutz und die Teilhabe von Kindern in
allen Lebensbereichen verbessern.
Den Begriff der
gewaltfreien Erziehung erweitern: Die gesetzliche Norm zum
Recht auf gewaltfreie Erziehung berücksichtigt bislang nicht
die Misshandlungsform der Vernachlässigung. Während die
Ablehnung körperlicher Gewalt und auch zunehmend der
emotionalen Gewalt im gesellschaftlichen Bewusstsein
verankert ist, fehlt es weiterhin an einer breiten
Sensibilisierung für die Folgen unterlassener Fürsorge. Der
Begriff der gewaltfreien Erziehung sollte daher im
Bürgerlichen Gesetzbuch ausdrücklich auf diese Form der
Gewalt durch Vernachlässigung ausgeweitet werden.
Datenlage zu Gewalt in der Erziehung verbessern: Die
Datenlage zur Gewalt in der Erziehung in Deutschland ist
weiterhin lückenhaft. Eine systematische Datenerhebung ist
das Fundament für wirksame Prävention und gezielte
Intervention. Nur durch fundierte Daten lassen sich das
Ausmaß und die Risikofaktoren von Gewalt gegen Kinder
erkennen. Darauf aufbauend lassen sich Lösungen erarbeiten
sowie politischer und gesellschaftlicher Handlungsdruck
erzeugen.
|
Sudan: Zahl der Kinder in Not laut UNICEF
seit
Kriegsbeginn verdoppelt |
|
Amna isst therapeutische Fertignahrung
zur Behandlung ihrer Mangelernährung. In Teilen des Sudan
herrscht eine Hungersnot.

© UNICEF/UNI707418/Rajab
15 Millionen Kinder
im Sudan brauchen humanitäre Hilfe
Größte humanitäre
Krise mit meisten vertriebenen Kindern der Welt
Sudan ist
einziges Land mit einer offiziell festgestellten Hungersnot
Schwere Kinderrechtsverletzungen um 1000 Prozent gestiegen
Einschränkungen bei Zugang und Finanzierung verschärfen die
Herausforderungen
Port Sudan/ New York/Köln/Duisburg,
15. April 2025 - Zwei Jahre nach Ausbruch des Konflikts im
Sudan hat sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die
humanitäre Hilfe benötigen, von 7,8 Millionen (Anfang 2023)
auf heute über 15 Millionen verdoppelt. Ohne eine massive
Ausweitung der Unterstützung könnte die bereits jetzt größte
humanitäre Krise der Welt zu einer noch größeren Katastrophe
eskalieren, warnt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF.
Die
Gewalt gegen Kinder hat ein erschütterndes Ausmaß
angenommen. Allein in der vergangenen Woche wurden Berichten
zufolge mindestens 23 Kinder und neun humanitäre
Helfer*innen in Nord-Darfur getötet. Vertreibung, Hunger und
Krankheiten nehmen zu. Der Zugang von humanitären
Helferinnen und Helfern zu Familien wird eingeschränkt,
gleichzeitig sinkt die finanzielle Unterstützung. Sorgen
macht UNICEF auch die bevorstehende Regenzeit von Mai bis
Oktober, die erfahrungsgemäß oft zu verheerenden
Überschwemmungen und einem Anstieg von Mangelernährung und
Krankheiten führt.
„Zwei Jahre Gewalt und Vertreibung
haben das Leben von Millionen von Kindern im Sudan zerstört.
Der Bedarf übersteigt weiterhin die humanitären Mittel“,
sagte UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell. „In der
bevorstehenden Regenzeit werden Kinder, die bereits an
Mangelernährung und Krankheiten leiden, schwerer zu
erreichen sein. Ich fordere die internationale Gemeinschaft
dringend auf, dieses entscheidende Zeitfenster zu nutzen und
sich stärker für die Kinder des Sudan einzusetzen.“
Fatuma (13) wurde bereits sechs Mal vertrieben
Der Sudan
erlebt die weltweit größte humanitäre Krise und die größte
Kindervertreibungskrise. Die Hälfte der über 30 Millionen
Menschen, die in diesem Jahr humanitäre Hilfe benötigen,
sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Der Konflikt
hat fast 15 Millionen Menschen innerhalb des Sudan und in
die Nachbarländer vertrieben, über die Hälfte von ihnen
Kinder.
Eine von ihnen ist Fatuma, 13 Jahre. Als der
Krieg vor zwei Jahren ausbrach, musste sie mitten in einer
Schulprüfung alles stehen und liegen lassen. Seitdem musste
Fatuma bereits sechs Mal fliehen. „Was ich am meisten
vermisse, ist die Schule und das Lernen. Ich habe immer
davon geträumt, Ärztin zu werden. Ich wollte mich bilden,
meine Träume verfolgen und meine Eltern stolz machen.“
Rund 90 Prozent der Kinder im Sudan gehen nicht zur
Schule. In Gebieten, in denen die Kämpfe zurückgehen,
gefährden Blindgänger und der eingeschränkte Zugang zu
lebenswichtigen Dienstleistungen das Leben von Kindern
erheblich. Hungersnöte breiten sich aus, die Impfraten
sinken.
Die Zahl schwerer
Kinderrechtsverletzungen* ist innerhalb von zwei Jahren um
1000 Prozent gestiegen.
Während solche
Menschenrechtsverletzungen an Kindern vorher auf Regionen
wie Darfur, Blauer Nil und Südkordofan beschränkt waren, hat
der anhaltende Konflikt im ganzen Land dazu geführt, dass in
mehr als der Hälfte der 18 sudanesischen Bundesstaaten
schwere Kinderrechtsverletzungen festgestellt wurden.
Zu den am häufigsten festgestellten schweren
Rechtsverletzungen im Sudan zählen Tötungen und
Verstümmelungen, Entführungen von Kindern sowie Angriffe auf
Schulen und Krankenhäuser. Darfur, Khartum, Jezira und
Südkordofan meldeten in den letzten zwei Jahren die meisten
schweren Kinderrechtsverletzungen.
In mindestens fünf
Gebieten ist bereits eine Hungersnot ausgebrochen. Fünf
zusätzliche Gebiete stehen am Rande einer Hungersnot, 17
weitere sind gefährdet. Mit der nahenden Regenzeit sind
außerdem sieben dieser Orte auch von Überschwemmungen
bedroht – sechs in Darfur und einer in Nordkordofan.
Zwischen 2022 und 2024 erfolgten rund 60 Prozent der
jährlichen Einweisungen wegen schwerer akuter
Mangelernährung (SAM) während der Regenzeit. Sollte sich
dieser Trend fortsetzen, könnten zwischen Mai und Oktober
dieses Jahres bis zu 462.000 Kinder an lebensbedrohlicher
Mangelernährung leiden.
Auch Krankheitsausbrüche
werden voraussichtlich zunehmen. Allein im Jahr 2024 wurden
49.000 Cholera-Fälle und mehr als 11.000 Dengue-Fieber-Fälle
gemeldet – 60 Prozent davon betrafen Mütter und Kinder.
Diese Ausbrüche werden durch die Regenzeit verschlimmert,
weil dadurch Wasserverschmutzung, schlechte sanitäre
Versorgung sowie Vertreibung zunehmen.
Der Zugang
humanitärer Akteure zu Kindern verschlechtert sich aufgrund
der Intensität des Konflikts und aufgrund von
Einschränkungen und bürokratischen Hindernissen durch
Regierungsbehörden oder andere bewaffnete Gruppen. Im Jahr
2024 verzögerten sich über 60 Prozent der Hilfslieferungen
von UNICEF aufgrund der äußerst instabilen Sicherheitslage.
Obwohl keine Hilfslieferungen abgesagt oder abgebrochen
wurden, haben diese wiederholten Verzögerungen die
rechtzeitige Bereitstellung von Hilfe und den Zugang zu
Kindern in Not erschwert.
Die Finanzierung der
Hilfsprogramme ist auf einem gefährlich niedrigen Niveau.
Dadurch sind wichtige Gesundheits-, Ernährungs-, Bildungs-
und Schutzprogramme für Kinder und Familien – und damit
Menschenleben – in Gefahr. UNICEF benötigt rund eine
Milliarde US-Dollar für seine Nothilfe im Sudan im Jahr
2025.
Der Bedarf beläuft sich auf lediglich 76
US-Dollar pro Person für das gesamte Jahr – nur 0,26
US-Dollar pro Tag –, um lebenswichtige Unterstützung für die
Menschen zu leisten. Bislang stehen UNICEF 266,6 Millionen
US-Dollar für diese Hilfsmaßnahmen zur Verfügung. Der
Großteil davon wurde bereits 2024 übertragen, nur 12
Millionen US-Dollar gingen 2025 ein.
UNICEF leistet
umfangreiche Hilfe für Kinder und Familien im Sudan. Im Jahr
2024 haben UNICEF und Partner psychosoziale Beratung,
Bildungs- und Schutzangebote für 2,7 Millionen Kinder und
ihren Bezugspersonen im Sudan geleistet. Über 9,8 Millionen
Kinder und Familien wurden mit sauberem Trinkwasser
versorgt.
UNICEF und Partnerorganisationen haben
insgesamt 6,7 Millionen Kinder auf Zeichen von
Mangelernährung untersucht und 422.000 von ihnen mit
lebensrettender Therapie behandelt. UNICEF legt weiterhin
den Fokus auf lebensrettende Hilfe in Konfliktgebieten und
unterstützt Vertriebene und Aufnahmegemeinschaften in
sichereren Gebieten mit lebenswichtigen Dienstleistungen.
„Der Sudan ist heute die größte humanitäre Krise der
Welt, doch die Weltöffentlichkeit schenkt ihm keine
Beachtung“, sagte Russell. „Wir dürfen die Kinder im Sudan
nicht im Stich lassen. Wir verfügen über das Fachwissen und
die Entschlossenheit, unsere Unterstützung auszuweiten, aber
wir benötigen Zugang und nachhaltige Finanzierung. Vor allem
brauchen die Kinder im Sudan ein Ende dieses schrecklichen
Konflikts.“
* Zu den schweren
Kinderrechtsverletzungen (Six grave Violations) zählen die
Vereinten Nationen: Tötung und Verstümmelung, Entführung,
Rekrutierung und Einsatz von Kindersoldat*innen,
Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt, Angriffe
auf Schulen und Krankenhäuser und die Verweigerung
humanitärer Hilfe.
UNICEF ruft dringend zu Spenden
für Kinder im Sudan auf:
www.unicef.de/sudan.
|
|
Jede halbe Stunde wird ein Kind im Osten der
Demokratischen Republik Kongo vergewaltigt |
|
Statement von UNICEF-Sprecher James Elder
aus Goma / Gerne vermitteln wir Interviews

© UNICEF/UNI776494/Benekire | UNICEF-Sprecher James Elder
während seines Besuchs in Goma, North-Kivu, Demokratische
Republik Kongo, in dieser Woche.
Goma/Berlin/Duisburg, den 11. April 2025 - „Der Konflikt im
Osten der Demokratischen Republik Kongo ist von schwerer
Gewalt gegen Kinder geprägt. Laut ersten Berichten wurden in
nur zwei Monaten Tausende von Kindern vergewaltigt oder
Opfer sexualisierter Gewalt. Ganze Gemeinden werden aufgrund
der Gewalt auseinandergerissen.
Das Ausmaß
sexualisierter Gewalt gegen Kinder hat einen beispiellosen
Höhepunkt erreicht. Laut Berichten von
Kinderschutzorganisationen wurden allein im Januar und
Februar dieses Jahres von rund 10.000 gemeldeten Fällen von
Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt zwischen 35 und 45
Prozent an Kindern verübt. Das bedeutet, dass während der
intensivsten Kampfphase jede halbe Stunde ein Kind
vergewaltigt wurde.
Es handelt sich dabei nicht um
vereinzelte Vorfälle, sondern um eine systemische Krise. Wir
begegnen Überlebenden, die noch im Kleinkindalter sind.
Sexualisierte Gewalt wird als Kriegswaffe eingesetzt – eine
gezielte Taktik des Terrors. Sie zerstört Familien und ganze
Gemeinschaften.
Die Tatsache, dass dies
wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs ist – verborgen
unter Schichten aus Angst, Stigmatisierung und Unsicherheit
– sollte uns zutiefst erschüttern. Sie muss uns zu
sofortigem und gemeinsamem Handeln bewegen.
Benötigt
werden verstärkte Präventionsprogramme, auf die Bedürfnisse
der Überlebenden ausgerichtete Hilfsangebote und sichere
Möglichkeiten, Missbrauch ohne Angst zu melden. Überlebende
müssen wissen, dass die Welt ihnen zur Seite steht und sich
nicht abwendet. Zudem müssen die Täter zur Rechenschaft
gezogen werden.
Wie bei allen Präventionsmaßnahmen
ist eine ausreichende Finanzierung entscheidend. Auch Kinder
in der Demokratischen Republik Kongo sind von den
Auswirkungen der globalen Finanzierungskrise nicht verschont
geblieben. In einem der Krankenhäuser, die ich diese Woche
besuchte, hatten 127 Frauen und Mädchen, die Opfer von
Vergewaltigung wurden, keinen Zugang zu PEP-Kits
(Postexpositionsprophylaxe). Dies ist eine direkte Folge der
drastischen Kürzungen von Hilfsgeldern. Diese Mädchen und
Frauen erleiden unvorstellbare Qualen und erhalten nicht
einmal mehr die grundlegende medizinische Versorgung, die
sie benötigen.
So drohen sich die Erfahrungen, die
mir ein mutiges 13-jähriges Mädchen schilderte, immer weiter
zu wiederholen - von ihrer Vergewaltigung; davon, dass sie
nicht verstand, wie sie schwanger sein konnte; davon, dass
sie einen Kaiserschnitt haben musste, weil ihr Körper für
eine normale Geburt zu klein war. In ihren eigenen Worten:
´Ich bin ein Kind, ich weiß nicht, wie ich eine Mutter sein
soll.`
Wenn UNICEF die Finanzierungslücke, die durch
die Einstellung wichtiger humanitärer Hilfsmaßnahmen
entstanden ist, nicht schließen kann, werden 250.000 Kinder
keinen Zugang zu lebenswichtigen Angeboten zur Bekämpfung
von geschlechtsspezifischer Gewalt und zum Schutz in
bewaffneten Konflikten haben. Uns bleiben nur noch zwölf
Wochen.
Die Finanzierungskrise betrifft nicht nur die
Unterstützung von Kindern, die schwere
Kinderrechtsverletzungen überlebt haben. Wie schlimm wird es
noch werden? Ohne ausreichende Mittel sprechen die Zahlen
für sich: Allein im Jahr 2026 werden nach unseren Prognosen
100.000 Kinder in der Demokratischen Republik Kongo nicht
gegen Masern geimpft werden können. Fast zwei Millionen
werden nicht auf Mangelernährung untersucht, und beinahe
eine halbe Million wird keinen Zugang zu ausreichend
sauberem Wasser haben. Diese erschreckenden Zahlen ließen
sich noch weiter fortsetzen.
Doch es geht hier nicht
nur um Zahlen. Hinter jeder Zahl steht ein Kind –
verängstigt, hungrig, verletzlich – sowie seine Familie und
seine Gemeinde, die alles dafür tun, um es zu schützen. Die
Kosten von Untätigkeit sind nicht abstrakt. Sie zeigen sich
in vermeidbarem Leid und verlorenen Zukunftsperspektiven.
Humanitäre Hilfe hat über viele Jahre hinweg dazu
beigetragen, die Gesundheitssysteme in der Demokratischen
Republik Kongo zu stärken. Hart erkämpften Fortschritte –
bei der Senkung der Kinder- und Müttersterblichkeit, der
Prävention und Behandlung von Mangelernährung, der
Impfquote, dem Zugang zu Bildung und der
Geburtenregistrierung – stehen nun auf dem Spiel und drohen
zunichtegemacht zu werden.
In einer zunehmend
vernetzten Welt bleiben solche Auswirkungen nicht auf
nationale Grenzen beschränkt. Die Demokratische Republik
Kongo war bereits das Epizentrum mehrerer
Krankheitsausbrüche mit globalen Folgen, darunter Ebola,
Cholera und Mpox.
Lassen Sie mich mit dem schließen, was
mir Hoffnung gibt: die Kinder und jungen Menschen, die
sozialen Hilfskräfte und das Gesundheitspersonal vor Ort.
Ich bin Dutzenden klugen Menschen begegnet, die
unermüdlich und freiwillig dazu beitragen, Gemeinden für
Impfungen zu mobilisieren oder digitale Fake News zu
entlarven, selbst wenn die Plattformen Bemühungen, die
Wahrheit zu schützen, immer wieder einschränken.
Das
Gesundheitspersonal, das bei den Überlebenden und den
Mpox-Patienten blieb, selbst als sich das Chaos ausbreitete,
die Gefängnisse sich leerten und die Polizei verschwand.
Die qualifizierten und empathischen sozialen Fachkräfte,
die tief in ihren Gemeinden verwurzelt und das Rückgrat der
UNICEF-Hilfe sind. Tag für Tag unterstützen sie die
Überlebenden und tragen zu ihrer Sicherheit sowie Würde und
Gerechtigkeit bei. Mit unerschütterlicher Fürsorge helfen
sie den Überlebenden von Vergewaltigung im Kindesalter und
helfen ihnen, ihr Trauma zu bewältigen.
Die
Überlebenden von Vergewaltigungen – vor allem Kinder –
schweigen nicht. Sie sagten mir deutlich: ‚Wenn wir über
Vergewaltigungen schweigen, gibt es keine Gerechtigkeit, und
wir können nicht heilen.‘
Was sie alle brauchen – das
Gesundheitspersonal, die sozialen Fachkräfte und die Kinder
– ist eines: eine Chance.
Das ist der Funke. Doch damit
aus einer Chance echter Wandel entsteht, muss sie mit
Frieden und ausreichender Finanzierung einhergehen.“
|
|
Verantwortung für Kinder – in Deutschland und
weltweit |
|
Statement von Georg Graf Waldersee,
Vorsitzender von UNICEF Deutschland, zur
Koalitionsvereinbarung von CDU, CSU und SPD
Köln/Berlin/Duisburg, 10. April 2025 - Als Organisation mit
dem internationalen Mandat, die Lebenssituation von Kindern
weltweit zu verbessern und auf die Verwirklichung der
Kinderrechte hinzuwirken, begrüßt UNICEF wichtige Vorhaben,
die Union und SPD im Koalitionsvertrag für die künftige
Bundesregierung vereinbart haben.
Dazu der
Vorsitzende von UNICEF Deutschland, Georg Graf Waldersee:
„Wenn die Koalition ‘Verantwortung für Deutschland‘ als
Überschrift für ihre politischen Vorhaben der kommenden vier
Jahre wählt, muss die künftige Bundesregierung aus Sicht von
UNICEF vor allem auch Verantwortung für Kinder übernehmen -
in Deutschland und weltweit. Investitionen in Kinder sind
die beste Investition in die Zukunft unseres Landes.
Wir begrüßen das klare Bekenntnis zu einer regelbasierten
internationalen Ordnung und zur Stärkung der multilateralen
Zusammenarbeit, zu Menschenrechten und Völkerrecht. Es ist
ein wichtiges Signal der neuen Bundesregierung, sich
weiterhin kraftvoll weltweit für die Bekämpfung von Armut,
Hunger und Ungleichheit zu engagieren und für die Erreichung
der internationalen Nachhaltigkeitsziele sowie des Pariser
Klimaschutzabkommens einzusetzen. Damit erkennt die
Koalition die zentrale Rolle Deutschlands bei der
Bewältigung der dramatischen globalen Umbrüche und der
komplexen Krisenlagen an, unter denen Kinder besonders
leiden.
Wir verstehen, dass die künftige
Bundesregierung ihre internationale Zusammenarbeit stärker
an den Interessen Deutschlands und verbesserter Effizienz
ausrichten will. Zugleich gehen wir davon aus, dass eine
Reduzierung der öffentlichen Gelder nicht zu Lasten der
dringenden Aufgaben für Kinder weltweit geschieht.
Deutschland hat über sein verlässliches Engagement und seine
Investitionen in einer kritischen Zeit eine Führungsrolle in
der internationalen Zusammenarbeit übernommen. Mit seinen
Leistungen insbesondere für Menschen in Krisenregionen und
seinem nachhaltigen Einsatz für verbesserte
Lebensbedingungen trägt unser Land zu Stabilität und
Resilienz in vielen Weltregionen bei – in einer Zeit, da
sich traditionell zuverlässige Geber zurückziehen.
Einsparungen gefährden Deutschlands starkes internationales
Profil und somit auch die Ziele der Koalition. Sie wären zu
kurz gedacht.
Wichtige Signale für Kinder in
Deutschland
Mit Blick auf die Kinder in Deutschland
begrüßen wir, dass die neue Bundesregierung Familien ins
Zentrum ihrer Politik stellen, Kinderarmut bekämpfen, den
Kinderschutz auch im Internet ausbauen und die mentale
Gesundheit von Kindern mit einer eigenen Strategie
verbessern möchte. Bei allen Maßnahmen ist es besonders
wichtig, diejenigen Kinder gezielt zu adressieren, die
besondere Unterstützung benötigen, so zum Beispiel Kinder in
einkommensschwachen Haushalten oder Kinder, die mit ihren
Familien nach Deutschland geflüchtet sind.
Vor diesem
Hintergrund begrüßen wir sehr die geplante Ausweitung des
Startchancen-Programms, für die sich UNICEF schon im
vergangenen Jahr auf Grundlage einer beim Institut der
deutschen Wirtschaft in Auftrag gegebenen Studie
ausgesprochen hatte, und der Sprachförderung für Kinder ab
dem Kindergartenalter. Investitionen in Kinder sind die
wirkungsvollste Investition in die Zukunft unserer
Gesellschaft.
Mit der geplanten Neuordnung des
Bildungs- und Familienministeriums stehen der neuen
Bundesregierung Möglichkeiten offen, Kitas und Schulen auch
als die Kinderstuben einer demokratischen Gesellschaft zu
stärken. Der von der neuen Koalition vorgesehen Pakt
zwischen Bund, Ländern und Kommunen sollte dieses Ziel und
die Interessen von Kindern und Jugendlichen fest im Blick
behalten.
UNICEF Deutschland steht bereit, die neue
Bundesregierung als Partner mit seiner langjährigen
Expertise bei Fragen der internationalen Zusammenarbeit und
der Umsetzung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland zu unterstützen.“
|
|
Erdbeben in Myanmar: Kinder in großer Not |
|
Updatew 3. April:
Erdbeben in Myanmar: Erster humanitärer Flug mit 80 Tonnen
Hilfsgütern von UNICEF erreicht Rangun.
Die von der EU
unterstützte Lieferung umfasst lebensrettende Hilfsgüter für
betroffene Kinder und Familien

© UNICEF/UNI773050/Zar Mon
Bangkok/Rangun/Köln/Duisburg, 3. April 2025 - Am heutigen
Donnerstag sind 80 Tonnen Hilfsgüter per Flugzeug in Myanmar
eingetroffen, um Kinder und Familien in den am stärksten
betroffenen Regionen des Landes zu unterstützen. Es war der
erste humanitäre Flug einer Hilfsorganisation nach den
verheerenden Erdbeben vom 28. März.
Die Hilfsgüter –
darunter medizinische Ausrüstung, Zelte und Spielmaterialien
zur psychosozialen Hilfe für Kinder – aus dem
UNICEF-Logistikzentrum in Kopenhagen wurden mit
Unterstützung der Europäischen Union zur Verfügung gestellt.
Sie werden in die betroffenen Gebiete gebracht und dort an
Kinder und Familien verteilt, die dringend auf Unterstützung
angewiesen sind.
„Die Zerstörung in Myanmar ist für
Kinder und Familien schlichtweg katastrophal“, sagte June
Kunugi, UNICEF-Regionaldirektorin für Ostasien und den
Pazifik. „Wir danken der EU, dass sie diese Lieferung
lebensrettender Hilfsgüter ermöglicht hat. Wir werden die
Hilfe so schnell wie möglich an die am stärksten betroffenen
Kinder und Familien verteilen und dabei strenge
Kontrollmechanismen anwenden.“
Bereits kurz nach dem
Erdbeben hat UNICEF lebensrettende Hilfsgüter aus seinen
Warenlagern in Rangun und Mandalay in besonders stark
betroffene Gebiete gebracht, darunter medizinische
Ausrüstung, lebenswichtige Medikamente wie Antibiotika,
Schmerzmittel und Rehydratationssalze,
Wasserreinigungstabletten sowie Seife, Damenbinden und
Desinfektionsmittel. Darüber hinaus liefert UNICEF Wasser
per Tanklaster, um Familien mit dringend benötigtem sauberem
Trinkwasser zu versorgen und die Gefahr von Krankheiten
einzudämmen.
Für die kommenden Tagen sind weitere
Flüge mit Hilfsgütern geplant, weil die humanitären Bedarfe
weiterhin steigen. Das Erdbeben der Stärke 7,7 hat Millionen
von Kindern in Gefahr gebracht. UNICEF-Teams sind unter
extrem schwierigen Bedingungen im Einsatz, um lebensrettende
Hilfe gemäß den humanitären Prinzipien der Menschlichkeit,
Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit zu leisten.
Statement von
Julia Rees, stellv. UNICEF-Leiterin in Myanmar, beim
heutigen Pressebriefing im Palais des Nations in Genf

© UNICEF/UNI771831/Maung Nyan
Rangun/Genf/Köln/Duisburg, 1. April 2025 - „Das
verheerendste Erdbeben, das Myanmar seit Jahrzehnten
getroffen hat, trifft vor allem Kinder mit voller Härte.
Gerade bin ich von einigen der am schwersten betroffenen
Gebieten zurückgekehrt. Was ich dort gesehen habe, war
erschütternd.
Ganze Gemeinden wurden dem Erdboden
gleichgemacht. Kinder und ihre Familien schlafen im Freien,
ohne ein Zuhause, in das sie zurückkehren können. Ich
begegnete Kindern, die nach dem Zusammensturz ihrer Häuser
oder dem Tod ihrer Angehörigen unter Schock standen. Einige
wurden von ihren Eltern getrennt. Andere werden noch immer
vermisst.
Die Zerstörung ist überwältigend. Häuser,
Schulen, Krankenhäuser und die zivile Infrastruktur –
darunter Brücken und Stromleitungen – wurden schwer
beschädigt oder völlig zerstört. Zahlreiche Gemeinden sind
weiterhin ohne Strom und Mobilfunkverbindungen. Ganze
Ortschaften sind von Wasser, Nahrungsmitteln, Medikamenten
und Geld abgeschnitten, es fehlt an Unterkünften. Die Krise
ist noch lange nicht vorüber.
Die Nachbeben hören
nicht auf. Die Such- und Rettungsmaßnahmen laufen weiter,
und immer noch werden Leichen aus den Trümmern geborgen.
Gestern war ich in einem Krankenhaus, wo ein Rettungsteam in
den letzten zwei Tagen 20 Leichen barg. An dem Morgen fanden
sie drei weitere Leichen und konnten eine Person lebend
retten. Kinder, deren Eltern weiterhin vermisst werden,
warten verzweifelt auf eine Wiedervereinigung. Gleichzeitig
suchen Eltern verzweifelt nach ihren Kindern.
Das
psychische Trauma ist gewaltig. Für Kinder, die bereits
unter Konflikten und Vertreibung litten, hat diese
Katastrophe eine neue Dimension von Angst und Verlust
hinzugefügt.
Gemeinsam mit Partnern liefert UNICEF
aus Beständen in unseren Warenlagern Hygienepakete,
medizinische Ausrüstung und therapeutische Nahrung. Unsere
Teams leisten unter extrem schwierigen Bedingungen Hilfe –
ohne Strom, fließendes Wasser und sanitäre Einrichtungen –
und schlafen meist im Freien, ebenso wie die betroffenen
Familien, die wir unterstützen.
Wir mobilisieren
zusätzlich 80 Tonnen lebenswichtiger Hilfsgüter aus unseren
globalen Lagern. Aber das reicht nicht aus – nicht für das
Ausmaß der Katastrophe, mit der wir konfrontiert sind.
Die Bedürfnisse sind riesig und steigen stündlich. Das
Zeitfenster für lebensrettende Maßnahmen schließt sich. In
den betroffenen Gebieten ringen Familien mit dramatischen
Engpässen im Hinblick auf sauberes Wasser, Nahrung und die
medizinische Versorgung.
Bereits vor dem Erdbeben
waren mehr als 6,5 Millionen Kinder in Myanmar auf
humanitäre Hilfe angewiesen. Einer von drei vertriebenen
Menschen im Land ist ein Kind. Das Erdbeben hat nun eine
weitere Krise ausgelöst und viele vulnerable Familien an den
Rand des Überlebens gebracht.
Wir rufen die
internationale Gemeinschaft dazu auf, dringend zu helfen.
Wir benötigen mehr finanzielle Mittel, um unsere Hilfe
auszuweiten. Bisher sind weniger als zehn Prozent des
UNICEF-Nothilfeaufrufs 2025 für die humanitäre Hilfe für
Kinder in Myanmar gedeckt. Ohne zusätzliche Ressourcen
können wir nicht alle Kinder in Not erreichen.
Schwer
verletzte Kinder brauchen dringend medizinische Hilfe. Viele
sind traumatisiert, weil sie geliebte Menschen verloren
haben oder selbst aus den Trümmern geborgen wurden. Je
länger wir warten, desto gravierender sind die Auswirkungen
auf das Leben und die Zukunft der Kinder.“
|
|
UNICEF-Befragung: Jugendliche
blicken pessimistisch
auf die Zukunft Deutschlands und
der Welt
|
|
Themen wie
Kinderarmut, Schulen, mentale Gesundheit, Sicherheit und
Zukunftschancen von Kindern weltweit haben für Jugendliche
hohe Priorität

©
UNICEF/Sachse-Grimm
Köln/Duisburg, 27. März 2025 -
Die große Mehrheit der deutschen Jugendlichen (14 bis 17
Jahre) blickt pessimistisch auf die Zukunft Deutschlands und
der Welt. Ihre persönliche Zukunft schätzen die jungen
Menschen hingegen eher positiv ein. Fast 80 Prozent der
Jugendlichen denken, dass sich Politiker*innen nicht genug
für die junge Generation einsetzen. Zudem haben die 14- bis
17-Jährigen wenig Zutrauen, dass die nächste Bundesregierung
die aus ihrer Sicht besonders wichtigen Probleme löst. Das
zeigt eine neue repräsentative Online-Befragung von UNICEF
Deutschland.
„Es muss uns wachrütteln, dass mehr
als zwei Drittel der Jugendlichen die Zukunft Deutschlands
und der Welt so düster sehen und die Mehrheit der Politik
bei vielen Herausforderungen keine guten Lösungen zutraut“,
sagt Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF
Deutschland.
„Die künftige Bundesregierung hat jetzt
die Chance, die junge Generation zu überzeugen, indem sie
für die aus ihrer Sicht drängenden Probleme konkrete Politik
gestaltet. Wenn Kinderarmut messbar zurückgedrängt wird,
marode Schulen saniert und Zukunftschancen für Kinder
weltweit gefördert werden, dann sehen die Jugendlichen, dass
ihre Stimme und ihre Zukunft zählen.“
Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahre durften bei der Bundestagswahl im
Februar noch nicht wählen, aber sie werden am längsten mit
den Folgen der heutigen Politik leben müssen. Um der Meinung
der Jugendlichen in der aktuellen Debatte Gehör zu
verschaffen, hat UNICEF Deutschland das Sinus-Institut mit
einer repräsentativen Online-Befragung beauftragt.
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
Jugendliche pessimistisch mit Blick auf die Zukunft
Deutschlands und der Welt
Insgesamt blickt die
große Mehrheit der Jugendlichen im Alter von 14-17 Jahren
eher pessimistisch oder sogar sehr pessimistisch auf die
Zukunft Deutschlands (67 Prozent) und der Welt (72 Prozent).
Trotzdem sind 83 Prozent mit Blick auf ihre persönliche
Zukunft eher oder sogar sehr optimistisch.
Abbildung 1: Wie optimistisch oder pessimistisch siehst du
… (siehe Anhang)
Quelle: Online-Befragung von SINUS
im Auftrag von UNICEF Deutschland unter Jugendlichen im
Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Befragungszeitraum:
3.3.-10.3.2025. N=508. Alle Angaben in %.
Auch Yana,
18 Jahre, Mitglied des UNICEF-JuniorBeirats, macht sich
Sorgen um die Weltlage: „Ich sehe der Zukunft der Welt etwas
pessimistisch entgegen, weil gerade so viel den Bach runter
geht, und das belastet mich schon. Man kann da viel helfen,
aber ich habe das Gefühl, die Politiker möchten gar nicht
helfen. Das ist schon sehr traurig.“
Zutrauen in
nächste Bundesregierung gering
Mehr als drei Viertel
der 14- bis 17-jährigen Jugendlichen (79 Prozent) sind der
Ansicht, dass Politiker*innen sich nicht genug für die
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Die
Jugendlichen sind zudem sehr skeptisch, ob die neue
Bundesregierung Lösungen für die großen Herausforderungen
findet, die sie als wichtig einstufen.
So ist es 93
Prozent der Jugendlichen eher wichtig oder sehr wichtig,
dass die nächste Bundesregierung Kinderarmut bekämpft. Aber
rund zwei Drittel (62 Prozent) sind nicht zuversichtlich,
dass hierfür Lösungen gefunden werden.
87 Prozent
der Jugendlichen ist es wichtig, dass mehr Geld für Schulen
bereitgestellt wird. Auch damit rechnen 62 Prozent jedoch
nicht. Ähnlich hoch (85 Prozent) ist der Wunsch nach mehr
Angeboten für mentale Gesundheit von Jugendlichen und die
Skepsis (64 Prozent) in Bezug auf die Umsetzung.
Kindern weltweit gute Zukunftsperspektiven zu ermöglichen,
sehen 86 Prozent ebenfalls als wichtige oder sehr wichtige
Aufgabe der Bundesregierung. Wiederum gehen zwei Drittel (64
Prozent) nicht davon aus, dass die neue Regierung dieser
Herausforderung gerecht werden wird.
Abbildung 2:
Wie wichtig ausgewählte Themen für Jugendliche sind und wie
zuversichtlich sie sind, dass die neue Bundesregierung gute
Lösungen findet (siehe Anhang)
Quelle:
Online-Befragung von SINUS im Auftrag von UNICEF Deutschland
unter Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.
Befragungszeitraum: 3.3.-10.3.2025. N=508. Alle Angaben in
%.
Positiver schätzen die Jugendlichen die Chancen
ein, dass die künftige Bundesregierung die ihnen ebenfalls
wichtigen Themen “Sicherheit Deutschlands und Europas
stärken” sowie “Wirtschaftliche Lage in Deutschland
verbessern” erfolgreich angehen wird. Hierbei trauen 56
Prozent beziehungsweise 49 Prozent der Jugendlichen der
Politik gute Lösungen zu. Das kann daran liegen, dass die
Themen Sicherheit und Wirtschaft in politischen Diskussionen
und der medialen Berichterstattung großen Raum eingenommen
haben und dadurch bei den Jugendlichen der Eindruck
entstanden ist, dass sich die Politikerinnen und Politiker
dieser Themen wirklich annehmen.
Jugendliche
überzeugen durch gute Politik und mehr Mitsprache
79
Prozent der Jugendlichen stimmen eher nicht oder überhaupt
nicht der Aussage zu, dass sich Politikerinnen und Politiker
genug für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen
einsetzen. Gleichzeitig finden 77 Prozent der Befragten,
dass Kinder und Jugendliche nicht genug Möglichkeiten haben,
sich bei politischen Entscheidungen, die sie und ihre
Zukunft betreffen, einzubringen.
Dieser Ansicht ist
auch Defne, 16 Jahre, Mitglied des UNICEF-JuniorBeirats:
„Eigentlich bin ich sehr zufrieden. Ich habe nur das Gefühl,
dass sehr viel über uns Jugendliche hinweg entschieden wird,
ohne dass wir wirklich mitsprechen können, obwohl wir ja die
Zukunft von morgen sind. Daher würde ich mir wünschen, dass
wir mehr Mitspracherecht hätten.“
Mehr
Beteiligungsmöglichkeiten würden sowohl Jugendlichen
vermitteln, dass ihre Meinung ernst genommen wird, als auch
Politikerinnen und Politikern wichtige Einblicke geben,
welche Probleme die junge Generation umtreiben und welche
Erwartungen sie haben.
Für die neue
Legislaturperiode hat UNICEF Deutschland in dem Papier „Eine
Politik für jedes Kind, eine Politik mit Zukunft“ konkrete
Empfehlungen für die internationale und nationale Politik
veröffentlicht. Umfassende Investitionen in benachteiligte
Kinder in Deutschland und weltweit sowie die Beteiligung der
jungen Generation an politischen Entscheidungen sind danach
zentrale Hebel, um die Zukunftsfähigkeit voranzutreiben –
und die junge Generation einschließlich der künftigen
Erstwählenden davon zu überzeugen, dass die Bundesregierung
auch sie im Blick hat.
Über die Jugend-Befragung von
UNICEF Deutschland
Die Online-Befragung wurde vom 3. bis
10. März 2025 durch das Sinus-Institut im Auftrag von UNICEF
Deutschland durchgeführt. Befragt wurden 508 Jugendliche im
Alter von 14 bis 17 Jahren. Zusätzlich hat UNICEF
Deutschland in Interviews zwei jugendliche Mitglieder des
UNICEF-JuniorBeirats um ihre Meinung gebeten.
|
|
Tödliche Wasserknappheit – Kinder in Konflikten in
ständiger Gefahr |
|
UNICEF zum
Weltwassertag: Überleben von Kindern in Gaza, der
Demokratischen Republik Kongo, dem Sudan und der Ukraine
durch prekäre Wassersituation bedroht

Ein Junge trägt einen Wasserkanister zwischen den Trümmern
der Häuser in Rafah im Gazastreifen | © UNICEF/UNI724700/El
Baba
Köln/Duisburg, 21. März 2025 - Noch immer haben
über zwei Milliarden Menschen weltweit keinen gesicherten
Zugang zu sauberem Trinkwasser. Neben den Folgen des
Klimawandels und regionaler Wasserknappheit gefährdet
insbesondere ein weiterer Umstand den sicheren
Trinkwasserzugang für Kinder: das Aufwachsen in
Konfliktgebieten. Bewaffnete Auseinandersetzungen erhöhen
den Mangel an sauberem Trinkwasser, sanitären Anlagen und
Hygiene drastisch, was die Verbreitung teils
lebensbedrohlicher Erkrankungen begünstigt.
UNICEF
Deutschland mahnt anlässlich des morgigen Weltwassertags
(22. März) eindringlich, dass für Kinder in Konfliktgebieten
wie Gaza, Sudan, Ukraine oder Demokratische Republik Kongo
der Zugang zu sauberem Trinkwasser sichergestellt sein muss.
In Konflikten oder Kriegen ist die Versorgung mit Wasser
und sanitären Einrichtungen oftmals zusammengebrochen:
Aufbereitungsanlagen wurden zerstört, Brunnen sind
verunreinigt oder Familien von der Wasserversorgung
abgeschnitten.
„Kinder müssen unsauberes Wasser
trinken, um zu überleben, doch das bringt wiederum ihr Leben
in Gefahr“, sagte Christian Schneider, Geschäftsführer von
UNICEF Deutschland. „In lang anhaltenden Konflikten ist für
Kinder unter fünf Jahren das Risiko, an einer
Durchfallerkrankung zu sterben, durchschnittlich 20-fach
höher als durch beispielsweise Bomben oder Granaten.“
Häufig potenzieren sich Hunger und Wassermangel
zusätzlich: Durch Unterversorgung geschwächte Kinder sind
anfälliger für Durchfallerkrankungen wie Cholera, was
wiederum die Aufnahme von Nährstoffen erschwert und zu
Mangelernährung führt. Aber auch andere Viruserkrankungen
wie beispielsweise Polio oder Masern können sich verstärkt
ausbreiten. Deswegen führt UNICEF in Gaza und dem Sudan
breitangelegte Polio-Impfkampagnen durch.
Wassersituation in den Konfliktgebieten:
Demokratische
Republik Kongo: Die eskalierende Gewalt in den östlichen
Provinzen Nord- und Süd-Kivu hat seit Jahresbeginn über eine
Million Menschen in die Flucht getrieben, fast die Hälfte
davon Kinder. Viele Kinder leben unter prekären Bedingungen,
es herrschen schlechte hygienische Zustände, Hunger und
Wassermangel.
Familien sind gezwungen, Wasser aus
dem nahegelegenen Kivu-See oder unhygienischen
Wasserreservoirs zu holen. Krankheiten wie Cholera, Masern
und Mpox breiten sich verstärkt aus; allein Cholera hat um
25 Prozent der durchschnittlichen Fälle pro Woche
zugenommen.
Die UNICEF-Teams vor Ort arbeiten unter
Hochdruck daran, die Kinder zu versorgen und zu schützen.
Angriffe auf humanitäres Personal, geschlossene Flughäfen
für Hilfsgüterlieferungen und immer wieder aufflammende
Kämpfe erschweren die Arbeit. Dennoch ist es gelungen, in
Goma drei Gesundheitseinrichtungen mit Wasserlieferungen zu
versorgen sowie 77.000 Liter Treibstoff zu liefern, um fünf
von sechs Wasserpumpwerken wieder in Betrieb zu nehmen.
Entlang des Kivu-Sees wurden 53 Punkte zur Wasserreinigung
mit Chlor eingerichtet. Insgesamt kommen die Maßnahmen, die
UNICEF mit Partnern umsetzt, über 800.000 Menschen zugute.
Gaza: Die stark beschädigte Wasser- und
Infrastruktur sowie die nur eingeschränkt mögliche
humanitäre Hilfe hat die Kinder im Gazastreifen von der
dringend benötigten Grundversorgung abgeschnitten. Die
Wasserproduktion liegt bei weniger als 25 Prozent der
Kapazität, was Krankheiten und verheerende hygienische
Umstände weiter befeuert.
Seit dem Inkrafttreten der
Waffenruhe hatte UNICEF seine bestehenden Hilfsprogramme
massiv ausgeweitet und Reparaturen der kritischen
Infrastruktur unterstützt. Gemeinsam mit Partnern konnte
UNICEF unter anderem Trinkwasser und Wasser für den
täglichen Gebrauch für über 1,5 Millionen Menschen, davon
über 600.000 Kinder, sicherstellen.
Allein im Januar
halfen über 456.000 Liter Treibstoff dabei, Wassertransporte
sowie eine sichere Wasserproduktion durch Entsalzungsanlagen
und Brunnen zu ermöglichen. Auch wurde die breitangelegte
Impfkampagne gegen Polio fortgesetzt, die insgesamt rund
600.000 Kinder erreichen soll. Die in dieser Woche wieder
aufgenommen Angriffe verschärfen die Situation für Kinder
nun erneut.
Sudan: Die humanitäre Situation im
Sudan ist verheerend - über 30 Millionen Menschen, die
Hälfte davon Kinder, sind auf Hilfe angewiesen. Infolge des
Konfliktes ist die Infrastruktur in den Bereichen Wasser,
Abwasser und Hygiene stark zerstört worden, starke
Regenfälle und Überschwemmungen tragen zusätzlich zu einer
Verunreinigung von Wasserquellen bei.
Ein Drittel
der Bevölkerung hat daher keinen Zugang zu sicherem
Trinkwasser. Dadurch konnten sich im Sudan Krankheiten wie
Cholera, aber auch Malaria oder Masern wieder stark
ausbreiten – eine tödliche Gefahr für mehr als drei
Millionen mangelernährte Kinder.
Der anhaltende Konflikt
und direkte Angriffe auf humanitäre Hilfskräfte verschärfen
die kritische Lage. Trotz der immensen Herausforderungen hat
UNICEF im vergangenen Jahr 9,8 Millionen Menschen mit
sauberem Trinkwasser versorgt und über neun Millionen gegen
Cholera geimpft. 2025 will UNICEF neun Millionen Menschen
mit sicherem und ausreichend Wasser versorgen sowie 1,8
Millionen mit essenziellen Hygieneprodukten erreichen.
Ukraine: Über drei Jahre Krieg prägen das Leben der
Kinder in der Ukraine. Aktuelle Gutachten zeigen massive
Schäden an der Wasserinfrastruktur; immer wieder ist die
Strom- und Wasserversorgung unterbrochen. Die Hilfe von
UNICEF für die Kinder in der Ukraine bleibt auch im vierten
Kriegsjahr umfangreich: 4,3 Millionen Menschen sollen 2025
Zugang zu ausreichend Trinkwasser und Wasser für den
täglichen Bedarf erhalten.
Um die Wasserversorgung zu
verbessern, reparieren Teams beispielsweise Wasserleitungen
in Schulen und Krankenhäusern, liefern Generatoren,
Chemikalien zur Wasserreinigung oder Wasserflaschen in
frontnahe Gebiete. Im Januar konnten damit rund 630.000
Menschen, davon über 100.000 Kinder, in acht Regionen
erreicht werden. Gemeinsam mit lokalen Hilfsorganisationen
konnte UNICEF fast 20.000 Kinder und Betreuungspersonen in
den schwer zugänglichen Frontgebieten bei Dnipro, Donezk und
Saporischschja mit essenziellen Hygienematerialien
versorgen.
UNICEF ruft alle Konfliktparteien dazu
auf, Angriffe auf kritische Infrastruktur wie
Wasserversorgung oder Gesundheitseinrichtungen und Schulen
zu unterlassen, den Zugang zu sauberem Trinkwasser
sicherzustellen und sicheren Zugang für humanitäre Hilfe zu
gewährleisten.
Große globale Fortschritte beim Zugang
zu Trinkwasser
In den letzten 20 Jahren wurden große
Fortschritte gemacht: Rund 2,1 Milliarden Menschen (rund ein
Viertel der Weltbevölkerung) haben Zugang zu sauberem
Trinkwasser erhalten.
Dennoch fehlt laut Schätzungen
von UNICEF und WHO weiterhin 2,2 Milliarden Menschen der
zuverlässige Zugang zu sauberem Trinkwasser. Menschen, die
in fragilen Kontexten leben, sind dabei mit doppelt so hoher
Wahrscheinlichkeit betroffen wie Menschen in anderen
Regionen.
Für Kinder ist die Gefahr durch
verschmutztes Wasser besonders hoch: Jeden Tag sterben über
1.000 Kinder unter fünf Jahren an Krankheiten, die durch
verschmutztes Wasser oder mangelnde Sanitäranlagen und
Hygiene verursacht und übertragen werden, wie zum Beispiel
die Durchfallerkrankung Cholera.
UNICEF unterstützt
in über 100 Ländern mit langfristigen Programmen die Wasser-
und Sanitärversorgung und verhilft dadurch jährlich 35
Millionen Menschen zu Trinkwasser. In Notsituationen ist
UNICEF in 85 Prozent der Krisenländer für die Koordinierung
der Wasser-, Sanitär- und Hygiene-Hilfen zuständig und
spielt dadurch eine entscheidende Rolle, um Menschen in Not
mit Trinkwasser zu versorgen und den Ausbruch von
Krankheiten zu verhindern.
UNICEF ruft weiterhin für
Kinder im Sudan, in Gaza und in der Ukraine sowie der
Demokratischen Republik zu Spenden auf. Weitere
Informationen:
www.unicef.de
|
|
UNICEF/WHO: Europäische Region meldet höchste Zahl
von Masernfällen seit mehr als 25 Jahren |
|
Europäische Region verzeichnet 127.350
Masernfälle für das Jahr 2024 – doppelt so viele wie für
2023 und die höchste Zahl seit 1997

© UNICEF/UN0760563/Babajanyan VII Photo
Genf/
Kopenhagen/ Köln/Duisburg, 13. März 2025 - Im Jahr 2024
wurden in der Europäischen Region 127.350 Masernfälle
gemeldet - doppelt so viele wie im Jahr 2023 und die höchste
Infektionsrate seit 1997, so eine Analyse der WHO und
UNICEF.
Mehr als 40 Prozent der gemeldeten Fälle in
der Europäischen Region, die 53 Länder in Europa und
Zentralasien umfasst, betrafen Kinder unter fünf Jahren. In
mehr als der Hälfte der gemeldeten Fälle war ein
Krankenhausaufenthalt erforderlich. Basierend auf den
vorläufigen Daten, die zum 6. März vorlagen, wurden
insgesamt 38 Todesfälle gemeldet.
Die Zahl der
Masernfälle in der Europäischen Region ist seit 1997, als
rund 216.000 Fälle gemeldet wurden, generell rückläufig und
erreichte 2016 mit 4.440 Fällen einen Tiefststand. Doch in
den Jahren 2018 und 2019 kam es mit 89.000 bzw. 106.000
gemeldeten Fällen zu einem Wiederanstieg.
Nach einem
Rückgang der Impfquoten während der COVID-19-Pandemie,
stiegen die Fallzahlen 2023 und 2024 wieder deutlich an. In
vielen Ländern sind die Impfquoten noch nicht wieder auf das
Niveau von vor der Pandemie zurückgekehrt, was die Gefahr
von Ausbrüchen erhöht.
„Masern sind zurück – und das
ist ein Weckruf. Ohne hohe Impfraten gibt es keine
Sicherheit für die Gesundheit. Nun, da wir an unserer neuen
Gesundheitsstrategie für Europa und Zentralasien arbeiten,
können wir es uns nicht leisten, an Boden zu verlieren.
Jedes Land muss seine Anstrengungen verstärken, um
unzureichend geimpfte Bevölkerungsgruppen zu erreichen“,
warnte Dr. Hans Henri P. Kluge, WHO-Regionaldirektor für
Europa. „Das Masernvirus ruht nie – und wir dürfen das auch
nicht.“
Die Europäische Region verzeichnete im Jahr
2024 ein Drittel aller weltweiten Masernfälle. Allein 2023
verpassten 500.000 Kinder in der Region ihre erste
Masernimpfung (MCV1), die im Rahmen von Routineimpfungen
verabreicht werden müsste.
„Die Zahl der Masernfälle
in Europa und Zentralasien ist in den letzten beiden Jahren
drastisch gestiegen – das ist ein Hinweis auf Impflücken“,
sagte Regina De Dominicis, UNICEF Regionaldirektorin für
Europa und Zentralasien. „Um Kinder vor dieser tödlichen und
verheerenden Krankheit zu schützen, benötigen wir dringend
ein Handeln der Regierungen, einschließlich nachhaltiger
Investitionen in Gesundheitspersonal.“
Masern
zählen zu den ansteckendsten Viruserkrankungen beim
Menschen. Neben Krankenhausaufenthalten und Todesfällen
durch Komplikationen wie Lungenentzündung, Enzephalitis,
Durchfall und Dehydrierung können Masern langfristige,
schwerwiegende gesundheitliche Folgen wie Erblindung
verursachen. Ebenso können sie das Immunsystem schädigen,
indem sie sein Gedächtnis zur Bekämpfung von Infektionen
“löschen”, wodurch Überlebende anfälliger für andere
Erkrankungen werden. Die Impfung bleibt der beste Schutz
gegen das Virus.
In Bosnien und Herzegowina,
Montenegro, Nordmazedonien und Rumänien wurden 2023 weniger
als 80 Prozent der impfberechtigten Kinder mit MCV1 geimpft
– deutlich unter der zur Aufrechterhaltung der
Herdenimmunität erforderlichen Durchimpfungsrate von 95
Prozent.
Sowohl in Bosnien und Herzegowina als auch
in Montenegro lagen die Durchimpfungsquoten für MCV1 in den
letzten fünf oder mehr Jahren unter 70 beziehungsweise 50
Prozent. Rumänien meldete in der Region 2024 die höchsten
Fallzahlen mit 30.692, gefolgt von Kasachstan mit 28.147
Fällen.
Masern bleiben eine ernsthafte globale
Bedrohung. Weltweit wurden 2024 rund 359.521 Masernfälle
gemeldet. Das Virus verbreitet sich regelmäßig über Grenzen
und Kontinente hinweg. Ausbrüche der hochansteckenden
Krankheit treten überall dort auf, wo das Virus auf
ungeimpfte oder unzureichend geimpfte Menschen trifft,
insbesondere Kinder.
UNICEF und WHO arbeiten
gemeinsam mit Regierungen und der Unterstützung von Partnern
wie der Europäischen Union oder der Impfallianz Gavi daran,
Masernausbrüche zu verhindern und zu bekämpfen. Dazu
beziehen sie Gemeinschaften mit ein, schulen
Gesundheitspersonal, stärken Impfprogramme sowie
Überwachungssysteme und initiieren Nachholimpfkampagnen.
UNICEF und WHO fordern Regierungen in Ländern mit
aktiven Ausbrüchen dringend dazu auf, die Fallermittlung und
Kontaktverfolgung zu intensivieren und Notfallimpfkampagnen
durchzuführen. Es ist unerlässlich, dass Länder die Ursachen
der Ausbrüche analysieren, Schwachstellen in ihren
Gesundheitssystemen adressieren und epidemiologische Daten
gezielt dazu nutzen, Impflücken zu identifizieren und zu
schließen. Im Fokus sollte dabei stehen, zögernde Eltern und
marginalisierte Gemeinschaften zu erreichen sowie ungleichen
Impfzugang zu beseitigen.
Länder, in denen keine
aktuellen Masernausbrüche bestehen, sollten Vorbereitungen
treffen, indem sie Immunitätslücken identifizieren und
beheben, das öffentliche Vertrauen in Impfungen ausbauen und
Gesundheitssysteme nachhaltig stärken.
|
|
Weltfrauentag: Gemischte Bilanz zur
Gleichberechtigung von Mädchen weltweit |
|
New
York/Köln/Duisburg, 7. März 2025 - Auch 30 Jahre nach
der “Pekinger Erklärung" zur Gleichstellung der Geschlechter
werden trotz großer Fortschritte Millionen von Mädchen
weltweit noch immer in vielen Bereichen eklatant
benachteiligt und sind beispielweise Gewalt und Kinderehen
ausgesetzt. Darauf verweist ein neuer Bericht von UNICEF,
Plan International und UN Women zum morgigen Weltfrauentag.

© UNICEF/UNI702739/Dicko
Der Report “Girls
Goals: What has changed for girls? Adolescent girls´ rights
over 30 years” (Ziele für Mädchen: Was hat sich für Mädchen
geändert? Die Rechte jugendlicher Mädchen in den letzten 30
Jahren) nennt zugleich bedeutende Errungenschaften und hebt
die wichtige Rolle hervor, die Mädchen für die Entwicklung
von Ländern spielen.
Das Jahr 1995 war ein
Meilenstein auf dem Weg zur Gleichberechtigung der
Geschlechter. Auf der vierten Weltfrauenkonferenz in Peking
verabschiedeten 189 Regierungen die “Pekinger Erklärung”, um
die Gleichstellung von Frauen und Mädchen zu erreichen. Die
Vereinbarung hob zwölf Schlüsselbereiche hervor, in denen
dringendes Handeln erforderlich war und gab Ländern
gleichzeitig einen konkreten Weg vor, wie sie Veränderungen
erreichen konnten.
30 Jahre später macht der
Bericht von UNICEF, Plan International und UN Women
deutlich, dass die Entwicklungen ungleichmäßig
fortgeschritten sind und trotz aller Erfolge deutliche
Unterschiede bestehen bleiben. Unzureichend sind die
Fortschritte beispielsweise nach wie vor in Bereichen wie
Bildung, lebensrettenden Gesundheitsdiensten oder dem Schutz
vor weiblicher Genitalverstümmelung.
“Mädchen
sind eine starke Kraft für globalen Wandel. Mit der
richtigen Unterstützung zur richtigen Zeit können sie dabei
helfen, die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen
und unsere Welt neu zu gestalten”, sagte Catherine Russell,
UNICEF-Exekutivdirektorin. “Investitionen in kritische
Bereiche wie Bildung, Kompetenzentwicklung, Schutz und
essenzielle Gesundheits- und Ernährungsdienstleistungen
können das Potenzial jugendlicher Mädchen weltweit
freisetzen und Gemeinden und Länder voranbringen.”
Zentrale Ergebnisse des Berichtes sind:
•
Obwohl die Anzahl der Mädchen, die nicht zur Schule gehen,
in den letzten 20 Jahren um 39 Prozent zurückging, ist 122
Millionen Mädchen weltweit der Schulbesuch verwehrt.
Jugendliche Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren sind in
Südasien dreimal wahrscheinlicher als Jungen nicht in der
Schule, einer Anstellung oder Ausbildung.
•
Ungefähr eins von vier jugendlichen Mädchen weltweit, das
verheiratet oder verpartnert ist, hat Gewalt durch seinen
Partner erfahren. 50 Millionen der heute lebenden Mädchen
waren sexualisierter Gewalt ausgesetzt.
•
Minderjährige Mädchen werden heute seltener verheiratet als
noch vor 25 Jahren. Dennoch heiratet weltweit eins von fünf
Mädchen in seiner Kindheit. Die größten Fortschritte im
Kampf gegen Kinderehen hat Südasien gemacht, während in
Lateinamerika und der Karibik keine Verbesserung in den
letzten 25 Jahren beobachtet werden konnte.
•
Weltweit hat sich die Zahl jugendlicher Mädchen, die ein
Kind zur Welt brachten, in den letzten 30 Jahren beinahe
halbiert. Trotzdem wird erwartet, dass 2025 etwa zwölf
Millionen Teenager zwischen 15 und 19 Jahren Mütter werden.
Auch schätzungsweise 325.000 jüngere Jugendliche (zehn bis
14 Jahre), für die eine Schwangerschaft noch risikoreicher
ist, werden dieses Jahr ein Kind gebären.
UNICEF,
Plan International und UN Women fordern weitere
Anstrengungen, um Mädchen und junge Frauen weltweit zu
fördern, mit Fokus auf den Bereichen, in denen die
Fortschritte stagnieren und die Lücken in der Gleichstellung
am größten sind.
Weitere Informationen zur Situation
von Mädchen weltweit finden Sie hier: Weltmädchentag 2024:
Elf Fakten zum internationalen Mädchentag | UNICEF
|
|
Motto zum Weltkindertag 2025: Kinderrechte –
Bausteine für Demokratie |
|

© Paula G. Vidal
Köln/Berlin/Duisburg, 12.
Februar 2025 - Der Weltkindertag am 20. September 2025 steht
in diesem Jahr unter dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für
Demokratie!“. UNICEF Deutschland und das Deutsche
Kinderhilfswerk unterstreichen damit, wie wichtig die
Umsetzung der Kinderrechte für unser aller Zukunft und als
Fundament der Demokratie ist.
Kinder und
Jugendliche, die ihre Rechte kennen und leben, verstehen
besser, wie Demokratie funktioniert und wie sie sich aktiv
einbringen können. Die beiden Kinderrechtsorganisationen
fordern im Wahljahr 2025 dazu auf, die Rechte der jungen
Generation stärker als bisher bei politischen Entscheidungen
miteinzubeziehen – für ein zukunftsfähiges und
kinderfreundlicheres Land.
„Das Motto des
Weltkindertages 2025 unterstreicht die fundamentale
Bedeutung der Kinderrechte für unser Zusammenleben“, sagt
Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland.
„Um unsere 14,3 Millionen Demokratinnen und Demokraten von
Morgen zu stärken, braucht es eine Politik, die Kinder, ihre
Chancen und die Verwirklichung ihrer Rechte gezielt fördert.
Mit umfassenden Investitionen in Bildung, der Förderung
benachteiligter junger Menschen vom Kita-Alter an und der
Beteiligung der jungen Generation an politischen
Entscheidungen können wir die Zukunftsfähigkeit des Landes
vorantreiben und zugleich unsere demokratische Gesellschaft
stärken.”
„Es braucht dringend konsequente
politische Initiativen und Entscheidungen für eine Politik,
die alle Generationen in den Blick nimmt. Denn bisher werden
die Belange der Kinder und Jugendlichen in Deutschland an zu
vielen Stellen systematisch ausgeblendet. Wir sehen
tagtäglich, dass unsere Demokratie an vielen Stellen
herausgefordert wird wie lange nicht.
Deshalb ist es
dringend an der Zeit, unsere Demokratie zusammen mit der
jungen Generation mit Leben zu füllen, ihre Voraussetzungen
zu bewahren und sie offensiv gegen Bedrohungen zu
verteidigen. Dafür braucht es auch die konsequente Umsetzung
der Kinderrechte in allen Bereichen unserer Gesellschaft“,
betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen
Kinderhilfswerkes.
Zum Weltkindertag am 20.
September 2025 ist eine gemeinsame bundesweite
Mitmach-Aktion von UNICEF Deutschland und dem Deutschen
Kinderhilfswerk geplant. Dabei werden die Kinderrechte als
Bausteine für Demokratie im Fokus stehen. Hinzu kommen
zahlreiche Initiativen mit lokalen Demonstrationen,
Aktionen, Festen und anderen Veranstaltungen. Dabei werden
sich Menschen aus ganz Deutschland für Kinder, deren Rechte
und Bedürfnisse stark machen.
Alle Informationen zum
Weltkindertag gibt es unter
www.unicef.de/weltkindertag und
www.dkhw.de/weltkindertag.
Im September 1954 empfahlen die Vereinten Nationen
ihren Mitgliedstaaten die Einführung eines weltweiten Tages
für Kinder. Sie wollten damit den Einsatz für Kinderrechte
stärken, die Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen auf
der Welt fördern und die Regierungen auffordern, die
weltweite UNICEF-Arbeit zu unterstützen.
Inzwischen
wird der Weltkindertag in über 145 Staaten gefeiert; seit
1989 sind die Kinderrechte mit einer UN-Konvention für jedes
Kind verbrieft.
|
|
Welttag gegen weibliche Genitalverstümmelung:
Mit
starken Allianzen für ein Ende der Praxis
|
|
Gemeinsames
Statement von UNFPA-Exekutivdirektorin Dr. Natalia Kanem,
UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell und
WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Halima, 20, wuchs in Süd-Kordofan auf, wo
Genitalverstümmelung (FGM) und Kinderheirat weit verbreitet
sind. Nachdem sie vor dem Konflikt in Khartum geflohen ist,
lebt sie jetzt in Kosti - und ist entschlossen, den
schädlichen Praktiken ein Ende zu setzen. Ein
UNICEF-Workshop hat ihr Engagement für Veränderungen
gestärkt. | © UNICEF/UNI511471/Awad
New York/Genf/
Köln/Duisburg, 6. Februar 2025 - „Die weibliche
Genitalverstümmelung ist eine Menschenrechtsverletzung, die
tiefgreifende und lebenslange physische, emotionale und
psychologische Narben bei Mädchen und Frauen hinterlässt.
Diese schädliche Praxis betrifft heute mehr als 230
Millionen Mädchen und Frauen. Schätzungen zufolge könnten
bis 2030 weitere 27 Millionen Mädchen dieser Verletzung
ihrer Rechte und Würde ausgesetzt sein, wenn wir nicht jetzt
gegensteuern.
Am heutigen Welttag der Nulltoleranz
gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung und im Einklang
mit dem diesjährigen Thema „Das Tempo erhöhen: Stärkung von
Allianzen und Aufbau von Bewegungen zur Beendigung der
weiblichen Genitalverstümmelung“, bekräftigen UNFPA, UNICEF
und die WHO ihr gemeinsames Engagement, zusammen mit Ländern
und Gemeinschaften diese schädliche Praxis ein für alle Mal
zu beenden.
Es gibt Hoffnung. Viele Länder
verzeichnen einen Rückgang der Verbreitung weiblicher
Genitalverstümmelung. Wir sehen Fortschritte in Ländern wie
Kenia und Uganda, wo gemeinschaftliches Engagement und
lokale Initiativen beweisen, dass durch die Stärkung von
Allianzen und den Aufbau von Bewegungen der Wandel
beschleunigt werden kann.
Seit 2008 haben 7 Millionen
Frauen Zugang zu Präventionsmaßnahmen bekommen
Seit
dem Start des gemeinsamen UNFPA-UNICEF-Programms zur
Eliminierung der weiblichen Genitalverstümmelung im Jahr
2008 und in Zusammenarbeit mit der WHO haben fast sieben
Millionen Mädchen und Frauen Zugang zu Präventions- und
Schutzmaßnahmen erhalten. Darüber hinaus haben 48 Millionen
Menschen öffentlich erklärt, die Praxis aufzugeben, und 220
Millionen Menschen wurden durch Kampagnen in Massenmedien
über das Thema aufgeklärt. In den letzten zwei Jahren haben
sich fast 12.000 lokale Organisationen und 112.000
Aktivist*innen in Gemeinden engagiert, um in dieser
entscheidenden Phase Veränderungen herbeizuführen.
Doch die Fragilität der erzielten Fortschritte wird immer
deutlicher. In Gambia etwa gibt es weiterhin Versuche, das
Verbot der weiblichen Genitalverstümmelung aufzuheben –
trotz der Ablehnung eines ersten Vorschlags durch das
Parlament im vergangenen Jahr. Solche Bemühungen könnten die
Rechte, die Gesundheit und die Würde zukünftiger
Generationen von Mädchen und Frauen massiv untergraben und
die jahrzehntelange Arbeit zur Veränderung von Einstellungen
und zur Mobilisierung von Gemeinschaften gefährden.
Von den 31 Ländern, in denen nationale Daten zur Verbreitung
dieser Praxis erhoben werden, sind nur sieben auf dem
richtigen Weg, das nachhaltige Entwicklungsziel (SDG) der
vollständigen Abschaffung der weiblichen
Genitalverstümmelung bis spätestens 2030 zu erreichen. Die
derzeitige Fortschrittsrate muss dringend beschleunigt
werden, um dieses Ziel zu erfüllen.
Dazu bedarf es
starker Allianzen zwischen Führungspersönlichkeiten, lokalen
Organisationen und verschiedenen Sektoren – einschließlich
Gesundheit, Bildung und sozialer Sicherung. Zudem sind eine
nachhaltige Interessenvertretung und eine verstärkte soziale
Bewegung erforderlich, bei der die betroffenen Mädchen und
Überlebenden im Mittelpunkt stehen.
Es erfordert
zudem eine stärkere Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen,
um sicherzustellen, dass Verpflichtungen zu den
Menschenrechten eingehalten und politische Strategien
umgesetzt werden, die Mädchen vor diesem Eingriff schützen
und Überlebenden Unterstützung bieten. Darüber hinaus sind
mehr Investitionen erforderlich, um bewährte Maßnahmen
auszuweiten. Wir sind unseren großzügigen Geldgebern und
Partnern für ihre Unterstützung dieser lebensverändernden
Arbeit zutiefst dankbar und rufen weitere Akteure dazu auf,
sich uns anzuschließen.
Wir alle tragen Verantwortung
dafür, dass jedes Mädchen geschützt wird und frei von
Schaden leben kann. Lassen Sie uns das Tempo erhöhen und mit
Dringlichkeit handeln. Die Zeit, weibliche
Genitalverstümmelung zu beenden, ist jetzt.“
Das
gemeinsame UNFPA-UNICEF-Programm zur Eliminierung der
weiblichen Genitalverstümmelung setzt sich für die
Abschaffung dieser Praxis durch gezielte Maßnahmen in 17
Ländern, in denen sie verbreitet ist, ein. Das Programm
schafft Möglichkeiten für Mädchen und Frauen, ihre Rechte in
Bezug auf Gesundheit, Bildung, Einkommen und Gleichstellung
wahrzunehmen, um die Machtungleichgewichte zu überwinden,
die dieser schädlichen Praxis zugrunde liegen.
Weitere Informationen:
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/maedchenbeschneidung-stoppen
|
|
Paddington™ übernimmt UNICEF-SchirmBÄRschaft
|
|

Christian Schneider, Geschäftsführer
UNICEF Deutschland, gemeinsam mit dem frischgebackenen
SchirmBÄRen Paddington™ © UNICEF/UNI727226/Sachse-Grimm
Köln/Duisburg, 5. Februar 2025 - UNICEF Deutschland ernennt
Paddington zum offiziellen SchirmBÄRen. Rund um den Start
seines neuen Kinofilms „Paddington in Peru“ würdigt das
Kinderhilfswerk der UN damit den wertvollen Beitrag, den der
sympathische Bär bereits seit 2022 für die Arbeit für Kinder
weltweit leistet. Der beliebte Kinderbuchcharakter ist damit
der erste Bär in der Geschichte, der die SchirmBÄRschaft von
UNICEF Deutschland übernimmt.
„Mit seiner
freundlichen Art und seinen fantasievollen Geschichten
bringt Paddington nicht nur Kinderaugen auf der ganzen Welt
zum Strahlen, sondern unterstützt UNICEF auch tatkräftig
dabei, Hilfe für Kinder in Not zu leisten“, sagt Christian
Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland. „Wir sind
froh, dass Paddington die offizielle Rolle als SchirmBÄR
übernimmt. Heute mehr denn je brauchen wir bekannte
Persönlichkeiten, die den Blick auf die Situation der Kinder
lenken und uns helfen, für jedes Kind gute Startchancen zu
schaffen.“
Gestartet in Großbritannien, dem
Mutterland der Paddington-Geschichten, unterstützt
Paddington seit 2022 auch UNICEF Deutschland beim Sammeln
von Spenden zur Finanzierung der Hilfe für Kinder weltweit.
Mit „Paddingtons Postkarten“ erhalten Kinder, Enkel oder
Patenkinder von Spender*innen ein Jahr lang jeden Monat Post
von Paddington, in der er von fernen Ländern und spannenden
Kulturen berichtet. Erstmals trat Paddington 1958 als Figur
des Kinderbuchs „Ein Bär mit Namen Paddington“, geschrieben
vom britischen Autor Michael Bond, in Erscheinung.
Der sympathische Bär, der ursprünglich aus Peru kommt,
wurde darin nach dem gleichnamigen Bahnhof in London
benannt. Seither erlebte Paddington viele spannende
Abenteuer auf der ganzen Welt. Seine neusten Erlebnisse sind
seit dem 30. Januar 2025 in seinem aktuellen Kinofilm
„Paddington in Peru” – entwickelt, produziert und vertrieben
von STUDIOCANAL – deutschlandweit zu bestaunen.
|
|
Waffenruhe im Gazastreifen: „Ausmaß der humanitären
Bedarfe enorm“ |
|
Statement der UNICEF-Exekutivdirektorin
Catherine Russell zur angekündigten Waffenruhe im
Gazastreifen
New York/Köln/Duisburg, 16. Januar 2025
- „Wir begrüßen die Ankündigung einer Einigung auf eine
Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien im Gazastreifen.
Eine Waffenruhe ist längst überfällig, sowohl für Kinder und
ihre Familien in Gaza, die seit mehr als einem Jahr unter
Bombardierungen und Not leiden als auch für die Geiseln in
Gaza und ihre Familien in Israel, die so sehr leiden.
Der Krieg hat einen verheerenden Tribut von Kindern im
Gazastreifen gefordert: laut Berichten wurden mindestens
14.500 Kinder getötet und Tausende verletzt. Schätzungsweise
17.000 Kinder sind unbegleitet oder wurden von ihren Eltern
getrennt, fast eine Million vertrieben.
Das Ausmaß
der humanitären Bedarfe ist enorm. UNICEF und seine Partner
stehen bereit, unsere Hilfe zu verstärken. Wichtig dafür
ist, dass humanitäre Organisationen die so dringend
benötigte Hilfe im Gazastreifen sicher leisten können. Dafür
braucht es ungehinderten Zugang, um Kinder und Familien mit
sauberem Wasser, Nahrungsmitteln, Gesundheitsversorgung,
psychologischer Unterstützung und Bargeldhilfen zu erreichen
sowie die Wiederaufnahme kommerzieller Lkw-Lieferungen.
Angesichts des Zusammenbruchs der lebenswichtigen
Grundversorgung im Gazastreifen müssen wir dringend alles
dafür tun, um Leben zu retten und Kindern zu helfen.
Weniger als die Hälfte der 36 Krankenhäuser in Gaza sind
funktionsfähig. Dadurch sind insbesondere Kinder durch
Infektionskrankheiten gefährdet. Die Wasserproduktion liegt
bei weniger als 25 Prozent der Kapazität. Nahezu alle 2,1
Millionen Menschen im Gazastreifen leiden unter
Ernährungsunsicherheit. 95 Prozent der Schulgebäude in Gaza
wurden beschädigt oder zerstört.
Es ist wichtig, dass
die Parteien die Waffenruhe vollständig einhalten und den
erforderlichen Umfang an Hilfsgütern über alle verlässlichen
Zugangspunkte in den Gazastreifen zulassen. Auch das
Sicherheitsumfeld muss dringend verbessert werden, damit
UNICEF unter anderem mangelernährte Kinder behandeln,
Impfungen für 420.000 Kinder unter fünf Jahren nachholen und
dazu beitragen kann, Krankheitsausbrüche wie Polio, Masern
und Cholera zu vermeiden.
UNICEF fordert alle Akteure
dringend auf, eine dauerhafte politische Lösung zu finden,
die den Rechten und dem Wohlergehen dieser und künftiger
Generationen von Kindern Priorität einräumt.
Der
Krieg in Gaza hat Kinder bereits so viel gekostet. Wir
müssen jetzt handeln und uns gemeinsam für eine bessere
Zukunft für alle Kinder einsetzen.“
|
Syrien: „Bildung ist Schlüssel für Neuanfang“
|
|
Kinder brauchen weiter Hilfe und die Chance auf eine
bessere Zukunft
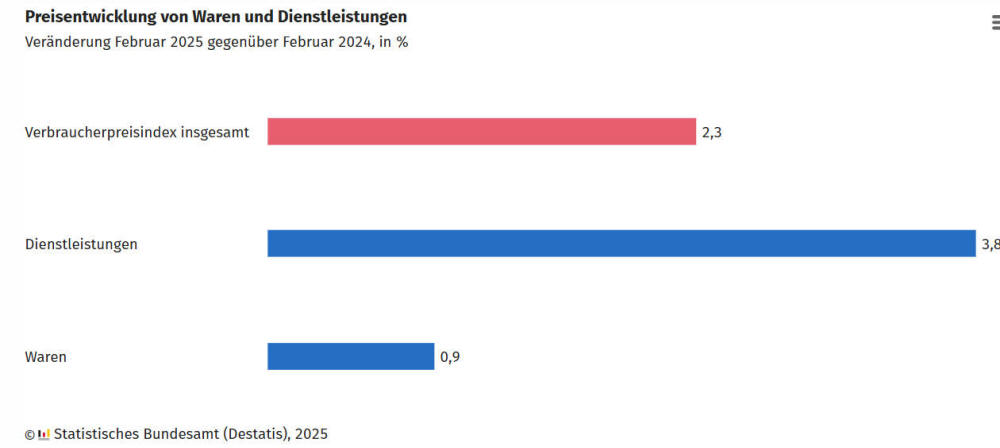
© UNICEF/UNI704243/Yacoubian
Köln/Berlin/Duisburg, 15. Januar 2024 - Fast 14
Jahre Krieg in Syrien haben zu einer schweren Bildungskrise
für Kinder geführt. Schätzungsweise 2,4 Millionen Kinder
besuchen keine Schule. Einer weiteren Million Kindern droht
der Schulabbruch. Rund 7,5 Millionen Kinder benötigen
humanitäre Hilfe. UNICEF Deutschland ruft dazu auf, alles
daran zu setzen, Kinder in Syrien zu unterstützen und ihnen
Perspektiven durch Bildung und psychosoziale Unterstützung
zu ermöglichen.
„Nach Jahren extremer Not und
unvorstellbarer Gewalt stehen Menschen in Syrien an einem
Wendepunkt. Umso wichtiger ist es, Kinder und junge Menschen
mit den nötigen Fähigkeiten auszustatten, um zum Aufbau
Syriens beizutragen und eine stabile und friedliche Zukunft
ihrer Gesellschaft mitzugestalten. Bildung ist der Schlüssel
für diesen Neuanfang“, sagte Christian Schneider,
Geschäftsführer von UNICEF Deutschland. „Kinder in Syrien
brauchen zudem dringend weiter psychosoziale Hilfe, um die
vielen Jahre der Gewalt, Not und Flucht zu verarbeiten. Wie
die Zukunft Syriens aussieht, hängt davon ab, was wir heute
tun, um Kinder und junge Menschen in Syrien zu
unterstützen.“
Mehr als 3.700 Schulen in Syrien
wurden zerstört oder beschädigt. Zahlreiche Lehrkräfte sind
geflohen. Viele Familien können angesichts der anhaltenden
schwierigen wirtschaftlichen Lage die Kosten für den
Schulbesuch nicht aufbringen. Unzählige Kinder sind von den
jahrelangen Gewalt- und Fluchterfahrungen traumatisiert.
Wenn Kinder nicht zur Schule gehen, steigt das Risiko
von Kinderarbeit und Kinderheirat. Umso wichtiger ist es,
Schulen als zentrale Orte für Kinder wieder aufzubauen. Der
Bildung für Kinder Vorrang einzuräumen, und das Lehrpersonal
sowie das Bildungssystem zu stärken, sind eine wesentliche
Voraussetzung für die Förderung des sozialen Zusammenhalts,
der Toleranz und des Friedens.
UNICEF ist seit den
1970er-Jahren für Kinder in Syrien im Einsatz. Im ersten
Halbjahr 2024 erhielten beispielsweise 600.000 Kinder Zugang
zu Bildungsangeboten. In diesem Jahr plant UNICEF mehr als
2,6 Millionen Kinder mit Bildungsangeboten zu erreichen und
rund 20.000 Lehrerinnen und Lehrer zu schulen. Mehr als
250.000 Kinder sollen mit psychosozialer Hilfe erreicht
werden.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist seit vielen Jahren
eine der wichtigsten Partner der UNICEF-Hilfe für Kinder in
Syrien. Dazu gehört UNICEFs „No Lost Generation“-Programm,
um den Zugang von Kindern zu Bildung zu verbessern.
Insgesamt benötigt UNICEF rund 488 Millionen US-Dollar für
die Hilfe für Kinder in Syrien, u.a. in den Bereichen
Bildung, Gesundheit, psychosoziale Hilfe, Ernährung und
Wasser- und Sanitärversorgung.
UNICEF Deutschland
ruft zu Spenden für Kinder in Syrien auf:
www.unicef.de/syrien.
|
|
UNICEF: 2024 war eines der schlimmsten Jahre für
Kinder in Konfliktsituationen
|
|
Kinder dürfen nicht „Kollateralschaden der
ungebremsten Kriege der Welt“ werden

Ali (11), läuft über die Trümmer seines zerstörten Hauses in
Gaza-Stadt. / © UNICEF/UNI501989/Al-Qattaa
New York/Köln/Duisburg, 28. Dezember 2024 - Die Auswirkungen
bewaffneter Konflikte auf Kinder weltweit haben im Jahr 2024
ein verheerendes und womöglich beispielloses Ausmaß
erreicht. Dies geht aus einer UNICEF-Analyse der neuesten
verfügbaren Daten und globalen Trends hervor.
Schätzungen zufolge leben mehr Kinder als je zuvor entweder
in Konfliktgebieten oder sind aufgrund von Konflikten und
Gewalt gewaltsam vertrieben worden. Die Rechte einer
Rekordzahl von Kindern, die von Konflikten betroffen sind,
werden verletzt, unter anderem, weil sie getötet und
verletzt werden, die Schule abbrechen müssen, es an
lebenswichtigen Impfungen fehlt oder sie an schwerer
Mangelernährung leiden. Diese Zahl wird voraussichtlich noch
weiter steigen.
"Konflikte sind für etwa 80 Prozent
des gesamten humanitären Bedarfs weltweit verantwortlich und
beeinträchtigen den Zugang zu lebensnotwendigen
Grundleistungen wie sauberem Wasser, Nahrungsmitteln und
medizinischer Versorgung.
Über 473 Millionen Kinder –
mehr als jedes sechste Kind weltweit – leben heute in
Konfliktgebieten. Die Zahl der Konflikte ist laut Global
Peace Index die höchste seit dem Zweiten Weltkrieg. Der
Anteil der Kinder weltweit, die in Konfliktgebieten leben,
hat sich verdoppelt – von etwa zehn Prozent in den 1990er
Jahren auf heute fast 19 Prozent.
Bis Ende 2023
wurden 47,2 Millionen Kinder aufgrund von Konflikten und
Gewalt vertrieben. Die Trends für 2024 weisen auf einen
weiteren Anstieg von Vertreibungen hin, weil sich
verschiedene Konflikte weiter zuspitzen, unter anderem in
Haiti, im Libanon, in Myanmar, in Palästina und im Sudan.
Kinder und Jugendliche sind überproportional von Flucht und
Vertreibung betroffen: Sie machen rund 30 Prozent der
Weltbevölkerung aus, im Durchschnitt sind aber rund 40
Prozent der geflüchteten Menschen und 49 Prozent der im
eigenen Land vertriebenen Menschen Minderjährige. In
Ländern, die von Konflikten betroffen sind, ist im
Durchschnitt mehr als ein Drittel der Bevölkerung arm (34,8
Prozent), verglichen mit etwas mehr als zehn Prozent in
Ländern, die nicht von Konflikten betroffen sind.
„In
fast jeder Hinsicht war 2024 eines der schlimmsten Jahre für
Kinder in Konfliktsituationen in der 78-jährigen Geschichte
von UNICEF – sowohl was die Zahl der betroffenen Kinder als
auch die Auswirkungen auf ihr Leben betrifft“, sagte
Catherine Russell, Exekutivdirektorin von UNICEF. „Ein Kind,
das in einem Konfliktgebiet aufwächst, geht mit größerer
Wahrscheinlichkeit nicht zur Schule, ist mangelernährt und
wird aus seinem Zuhause vertrieben – und das häufig mehrfach
– in Vergleich zu einem Kind, das an einem friedlichen Ort
lebt. Das darf nicht zur neuen Normalität werden. Wir dürfen
nicht zulassen, dass eine Generation von Kindern zum
Kollateralschaden der ungebremsten Kriege in der Welt wird.“
Rekordwert von schweren Kinderrechtsverletzungen wie
Tötung und Verstümmelung
Laut den neuesten
verfügbaren Daten aus dem Jahr 2023 verifizierten die
Vereinten Nationen einen Rekord von 32.990 schweren
Kinderrechtsverletzungen gegen 22.557 Kinder und Jugendliche
– die höchste Zahl seit Beginn des vom UN-Sicherheitsrates
eingesetzten Überwachungsmechanismus. Auch wenn für 2024
noch nicht alle Zahlen vorliegen, rechnet UNICEF angesichts
der aktuellen Entwicklungen mit einem weiteren Anstieg. So
wurden beispielsweise in Gaza Tausende von Kindern getötet
und verletzt, und die Vereinten Nationen verifizierten in
der Ukraine in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 mehr
Opfer unter Kindern als im gesamten Jahr 2023.
Die Situation für Frauen und Mädchen ist besonders
besorgniserregend, da es in Konfliktgebieten zahlreiche
Berichte über Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt gibt. In
Haiti ist der Anteil der gemeldeten Fälle sexualisierter
Gewalt gegen Kinder in diesem Jahr um 1.000 Prozent
gestiegen. In bewaffneten Konflikten sind auch Kinder mit
Behinderungen in der Regel unverhältnismäßig stark Gewalt
und der Verletzung ihrer Rechte ausgesetzt.
In
Konfliktgebieten ist Bildung stark beeinträchtigt.
Schätzungen zufolge gehen mehr als 52 Millionen Kinder in
von Konflikten betroffenen Ländern nicht zur Schule. Kinder
im Gazastreifen und ein erheblicher Teil der Kinder im Sudan
haben mehr als ein Jahr lang keine Schule besucht, während
in Ländern wie der Ukraine, der Demokratischen Republik
Kongo und Syrien Schulen beschädigt, zerstört oder
zweckentfremdet wurden. Dadurch können Millionen von Kindern
nicht lernen. Die Zerstörung der Bildungsinfrastruktur und
fehlende Sicherheit in der Nähe von Schulen haben die
ohnehin schon katastrophale Bildungssituation in diesen
Regionen noch verschlimmert.
Mangelernährung von
Kindern in Konfliktgebieten hat ein alarmierendes Ausmaß
erreicht. Konflikte und bewaffnete Gewalt sind nach wie vor
die Hauptursachen für Hunger in zahlreichen Krisengebieten,
da Nahrungsmittelsysteme gestört, Menschen vertrieben und
der Zugang zu humanitärer Hilfe behindert wird. So wurde
beispielsweise in Nord-Darfur im Sudan die erste Hungersnot
seit 2017 festgestellt. Im Jahr 2024 leiden schätzungsweise
mehr als eine halbe Million Menschen in fünf von Konflikten
betroffenen Ländern unter Hunger (eingestuft als „IPC-Phase
5“, der schlimmsten Form der Ernährungsunsicherheit).
Konflikte haben verheerende Auswirkungen auf den Zugang
von Kindern zu lebenswichtiger Gesundheitsversorgung. Etwa
40 Prozent der nicht oder unzureichend geimpften Kinder
leben in Ländern, die entweder teilweise oder vollständig
von Konflikten betroffen sind. Diese Kinder sind oft am
anfälligsten für Krankheitsausbrüche wie Masern und Polio,
weil sie durch fehlende Sicherheit, mangelnden Zugang zu
Ernährung und Gesundheitsdiensten besonders vulnerabel sind.
Auch die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von
Kindern sind enorm. Das Erleben von Gewalt, Zerstörung und
der Verlust von Angehörigen kann sich bei Kindern unter
anderem in Reaktionen wie Depressionen, Albträumen und
Schlafstörungen, aggressivem oder zurückgezogenem Verhalten,
Traurigkeit und Angst äußern.
2024 ist das bisher
tödlichste Jahr für humanitäre Helfer*innen, in dem weltweit
281 Mitarbeitende von Hilfsorganisationen ums Leben kamen
und damit alle bisherigen Rekorde übertroffen wurden.
„Kinder in Kriegsgebieten sind mit einem täglichen
Überlebenskampf konfrontiert, der sie ihrer Kindheit
beraubt“, sagte Russell. „Ihre Schulen werden bombardiert,
ihre Häuser zerstört und ihre Familien auseinandergerissen.
Sie verlieren nicht nur ihre Sicherheit und den Zugang zu
überlebensnotwendigen Dingen, sondern auch die Möglichkeit
zu spielen, zu lernen und einfach nur Kinder zu sein. Die
Welt lässt diese Kinder im Stich. Mit Blick auf 2025 müssen
wir mehr tun, um das Blatt zu wenden und das Leben von
Kindern zu retten und zu verbessern.“
UNICEF fordert
alle Konfliktparteien und diejenigen, die Einfluss auf sie
haben, auf, entschlossen zu handeln, um das Leid der Kinder
zu beenden, die Wahrung ihrer Rechte sicherzustellen und
ihren Verpflichtungen gemäß dem humanitären Völkerrecht
nachzukommen.
UNICEF ruft zu Spenden für Kinder im
Krieg auf:
https://www.unicef.de/spenden/kinder-im-krieg
|
|
Gesichter des Schocks, des Schmerzes und tiefer
Trauer 25 Jahre UNICEF
|
|
Foto des Jahres: Unabhängige Jury zeichnet erstmals
zwei Gewinnerbilder aus

© Avishag Shaar-Yashuv, Israel (l.); Samar Abu Elouf, Palästina
(r.)
Berlin/Köln/Duisburg, 19. Dezember 2024 - Die
beiden Gewinnerbilder des UNICEF Foto des Jahres 2024 zeigen
die Hauptleidtragenden der grausamen Gewalt in Israel und
Palästina – die Kinder. Auf subtile und würdevolle Weise
geben die Bilder zarte Hinweise auf davongetragene Wunden
innerer und äußerer Art. Erstmals in der 25-jährigen
Geschichte des Wettbewerbs zeichnet die unabhängige Jury die
Bilder zweier Fotografinnen mit dem ersten Preis aus.
Die Fotos von Avishag Shaar-Yashuv (Israel) und
Samar Abu Elouf aus Palästina erinnern daran, dass das
Schicksal von Kindern im Krieg und die resultierenden
Erfahrungen, Verletzungen und Verluste sie für immer prägen
werden. Den zweiten Preis erhält ein Foto des französischen
Fotografen Pascal Maitre zur Viruserkrankung Mpox. Es zeigt
das mit Pusteln übersäte Gesicht eines sieben Monate alten
Jungen in einem Krankenhaus im Osten der Demokratischen
Republik Kongo.
Die französische Fotografin
Maylis Rolland bekommt den dritten Preis. Ihr Bild hält
fest, wie im Universitäts-Krankenhaus der Stadt Rennes, ein
kleiner frühgeborener Junge noch unter einer Atemmaske, das
Gesicht seiner Mutter berührt. „Die beiden UNICEF Fotos des
Jahres 2024 fordern uns auf, innezuhalten. Sie bringen uns
dazu, die Perspektive zu verändern, uns in die Situation der
Kinder einzufühlen. In ihre Trauer, ihre Angst, ihre
Fassungslosigkeit, ihren Schmerz. Empathie und Mitgefühl
machen uns stärker. Sie sind die unverzichtbaren
Voraussetzungen dafür, auch in scheinbar aussichtslosen
Situationen irgendwann nach Verständigung zu suchen,”
erklärt UNICEF-Schirmherrin Elke Büdenbender (Gattin des
Bundespräsidenten) in ihrer Laudatio.
„Gemeinsam
stehen wir an der Seite aller Kinder. Das ist die Botschaft
des UNICEF Foto des Jahres 2024.” „Die diesjährige Auswahl
der beiden Siegerbilder unterstreicht die Universalität des
kindlichen Leids,” sagt Peter-Matthias Gaede, Mitglied der
Jury und des Deutschen Komitees für UNICEF. „Dass wir
erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs zwei Bilder von
zwei Seiten einer Front ausgezeichnet haben, bedeutet: Nicht
über Schuldfragen urteilen wir hier, denn Kinder können
nicht schuldig sein. Und nicht über die Quantität des
Leidens in einem Krieg richten wir. Sondern alleine danach,
was er in jedem einzelnen Kind anrichten kann, wenn er das
bisherige Leben in einen Abgrund stürzt.“
„Die
beiden Siegerbilder strahlen etwas zwingend Ruhiges aus. Sie
rauben einem gleichermaßen die Worte und regen zum
Nachdenken an,” erklärte Prof. Klaus Honnef, Vorsitzender
der Jury. „Selten habe ich so furchtbare Bilder von
äußerlich nahezu unverwundeten Kindern gesehen. Das von den
Kindern Erlebte überschreitet den Horizont des
Vorstellbaren.“
Israel / Palästina: Die
verschiedenen Gesichter des Schocks, des Schmerzes und einer
tiefen Trauer Eins der diesjährigen Gewinnerbilder wurde von
der israelischen Fotografin Avishag Shaar-Yashuv aufgenommen
und stammt aus der Arbeit „Portraits of the survivors“. Es
zeigt den achtjährigen Stav. Der Junge ist einer der
Überlebenden des Überfalls der Hamas am 7. Oktober 2023 auf
die Siedlung des Moschav Netiv HaAsara. Aufgenommen wurde
das Bild am 22. Oktober 2023 in einem Hotel im Kibbuz Maale
HaHamisha.
Im Zuge ihrer Arbeit portraitierte
die israelische Fotografin Avishag Shaar-Yashuv einige
Wochen nach dem Überfall der Hamas neben Stav weitere
Kinder. Sie waren nach der Vertreibung aus ihren Häusern in
Hotels oder provisorischen Unterkünften untergebracht. Das
zweite Gewinnerbild von Samar Abu Elouf, einer
palästinensischen Fotografin, gehört zur Arbeit „Wounded
children of Gaza“. Zu sehen sind die elfjährige Dareen und
der fünfjährige Kinan. Ihre Eltern und 70 weitere
Familienmitglieder der Geschwister kamen bei einem
israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus ums Leben.
Das gemeinsame Portrait der beiden palästinensischen
Kinder entstand in einem Hospital in Katar, in das sie zur
medizinischen Versorgung aufgenommen worden waren. Neben
Dareen und Kinan begleitete Abu Elouf im Zuge ihrer Arbeit
weitere Kinder aus Gaza, die mit den Folgen physischer und
psychischer Verletzungen sowie dem Verlust ihrer Familien
und Freunde belastet sind.
Demokratische
Republik Kongo: Ein Virus auf dem Vormarsch
Der
zweite Preis geht in diesem Jahr an ein Bild aus der
Reportage „Mpox“ des französischen Fotografen Pascal Maitre.
Die Reportage dokumentiert die Entwicklungen der
Viruserkrankung Mpox innerhalb der Demokratischen Republik
Kongo. Dort werden bereits etwa 40.000 Fälle vermutet, 8.000
wurden bereits bestätigt und über 1.000 Todesopfer erfasst.
Pascal Maitre ist ins Zentrum der Infektionen gegangen und
hat die Behandlung betroffener Kinder im Kavumu-Hospital in
der Region Kivu, im Osten des Kongo, fotografisch begleitet.
Darunter der sieben Monate alte Junge Japhet, dessen Pusteln
im Gesicht mit dem antiseptischen Medikament „Gentian
Violet“ behandelt werden. Gepflegt und behütet wird Japhet
von seiner 19-jährigen Mutter Christevi.
Frankreich: Der schwere Weg ins Leben
Die französische Fotografin Maylis Rolland hat am
Universitäts-Krankenhaus der Stadt Rennes einige Zeit lang
die wunderbaren Momente eingefangen, in denen das
zerbrechliche Leben winzigster Babys mit großem Aufwand an
Geräten und zugleich intensiver menschlicher Zuwendung
stabilisiert wird. Dabei ist auch das mit dem dritten Preis
ausgezeichnete Bild.
Es zeigt den Moment, in dem
der kleine Junge Gabin, nach 25 Schwangerschaftswochen
geboren und noch unter einer Atemmaske, das Gesicht seiner
Mutter Doriane berührt. Nach einer Studie der
Weltgesundheitsorganisation werden weltweit etwa zehn
Prozent aller Kinder vor Vollendung der 37.
Schwangerschaftswoche geboren, also drei Wochen zu früh. Je
früher die Geburt, desto dramatischer wird der Eintritt ins
Leben. Sieben weitere Reportagen hob die Jury mit
ehrenvollen Erwähnungen hervor:
-
Äthiopien/Malaysia: Wenn ein Junge nicht mehr spricht –
Fotografin: Patricia Krivanek, Kanada
- Frankreich,
Nepal: Kinder, die in Handys kriechen – Fotograf: Jérôme
Gence, Frankreich
- Gaza: Es ist nicht ihr Krieg –
Fotograf: Saher Alghorra, Palästina
- Israel: Yael war
stärker als der Terror – Fotograf: Ziv Koren, Israel
-
Nigeria: Ein Tanz in das Selbstbewusstsein – Fotograf:
Vincent Boisot, Frankreich
- Sambia, Argentinien: Eine
Kindheit ohne Eltern – Fotograf: Valerio Bispuri, Italien
- Sudan: Die unbeachtete Tragödie – Fotograf: Ivor Prickett,
Irland
Eine Ausstellung mit allen prämierten Arbeiten
ist bis Ende Januar 2025 im Haus der Bundespressekonferenz
in Berlin zu sehen. Anschließend sind sie vom 30. Januar bis
27. April 2025 für die allgemeine Öffentlichkeit im
Willy-Brandt-Haus zugänglich.
UNICEF Foto des Jahres
– Wettbewerb
Mit der Auszeichnung UNICEF Foto des
Jahres prämiert UNICEF Deutschland seit dem Jahr 2000 Fotos
und Fotoreportagen, die die Persönlichkeit und
Lebensumstände von Kindern weltweit auf herausragende Weise
dokumentieren. In diesem Jahr findet der Wettbewerb zum 25.
Mal statt. Voraussetzung für die Teilnahme ist die
Nominierung durch eine*n international renommierte*n
Fotografie-Expert*in. Über die Preisvergabe entscheidet eine
unabhängige Jury.
Epson begleitet den Wettbewerb
„UNICEF Foto des Jahres“ seit vielen Jahren. Auch in diesem
Jahr wurde die Ausstellung durch Epson gedruckt.
Eine
Übersicht aller ausgezeichneten Fotoreportagen finden Sie
auf
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/foto-des-jahres.
|
|
25 Jahre: UNICEF Foto des Jahres 2024
|
|
Köln/Duisburg, den 11. Dezember 2024 - Am
Donnerstag, den 19. Dezember 2024 stellt UNICEF Deutschland
die Preisträgerinnen und Preisträger des internationalen
Fotowettbewerbs auf einer Pressekonferenz in Berlin vor. Zum
25. Mal werden mit dem UNICEF Foto des Jahres herausragende
Bilder und Reportagen internationaler Fotojournalistinnen
und -journalisten ausgezeichnet. Erstmals in der Geschichte
des UNICEF Foto des Jahres werden die Bilder zweier
Fotografinnen mit dem ersten Preis gewürdigt.

© UNICEF/Soliz
Die Gewinnerbilder
erinnern auf subtile und würdevolle Weise daran, dass das
Schicksal von Kindern im Krieg und die resultierenden
Erfahrungen, Verletzungen und Verluste sie für immer prägen
werden. Die Preisträgerinnen und Preisträger des UNICEF
Fotos des Jahres 2024 werden am Donnerstag, den 19.
Dezember, um 11 Uhr in Berlin im Haus der
Bundespressekonferenz von UNICEF-Schirmherrin Elke
Büdenbender präsentiert.
Renommierte
Fotografinnen und Fotografen aus der ganzen Welt haben auch
in diesem Jubiläumsjahr ihre Bilder eingereicht.
Eindringlich schildern die Reportagen die Herausforderungen
des Aufwachsens in einer Zeit multipler Krisen.
|
|
Syrien: „Eine Generation Kinder kennt nur Angst und
Not“ |
|
Köln/Duisburg, den
9. Dezember 2024 - Angesichts der sich rasch entwickelnden
Ereignisse in Syrien ruft UNICEF Deutschland dazu auf,
Kinder in Syrien zu schützen. Nach fast 14 Jahren Krieg
brauchen Kinder weiter Hilfe.

© UNICEF/UNI638395/Aldhaher
„Ein Kind, das
2011 in den beginnenden Krieg hinein geboren wurde, hat
heute das Teenageralter erreicht. Eine ganze Generation
syrischer Kinder kennt nichts als Angst und Not“, sagte
Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland.
„Die Kinder sehnen sich nach Frieden und einer besseren
Zukunft für sich und ihr Land. Noch bleibt unsicher, wie es
für die Kinder weitergehen wird. Gemeinsam müssen wir alles
daran setzen, sie zu schützen und so schnell wie möglich ein
stabiles Umfeld zu schaffen. Ihr Wohlergehen ist der
Schlüssel für ein künftiges Zusammenleben in Frieden.“
Fast 14 Jahre Krieg in Syrien haben schreckliche Not
über die Zivilbevölkerung gebracht. Vor allem die Kinder
leiden unter Gewalt, Vertreibung, Hunger und Armut. Rund
16,7 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe
angewiesen, darunter 7,5 Millionen Kinder. Mehr als 7,2
Millionen Menschen sind innerhalb des Landes vertrieben, 3,4
Millionen von ihnen im Nordwesten des Landes.
Nach
Angaben der Vereinten Nationen wurden fast 14.700 Kinder
seit dem Beginn des Krieges getötet oder verletzt. Dies sind
allein die verifizierten Fälle, die tatsächliche Zahl ist
vermutlich weitaus höher. UNICEF schätzt, dass in den
vergangenen zwei Wochen mindestens 35 Kinder getötet wurden.
Rund 85 Prozent der Familien kommen angesichts der
schwierigen wirtschaftlichen Lage kaum über die Runden.
Viele Eltern in Syrien wissen nicht, wie sie die Mittel
aufbringen können, um ihre Kinder zu ernähren.
Schätzungsweise 650.000 syrische Kinder leiden an
chronischer Mangelernährung.
Der Krieg hat zudem zu
einer schweren Bildungskrise geführt. Eine von drei Schulen
wird als Notunterkunft genutzt oder wurde zerstört oder
beschädigt. Mehr als 2,4 Millionen Kinder in Syrien besuchen
keine Schule.
UNICEF ruft dazu auf, humanitären
Organisationen sicheren und ungehinderten Zugang zu Kindern
in Not zu gewähren. UNICEF steht bereit, in der aktuellen
Lage die dringend benötigte humanitäre Hilfe rasch
auszuweiten.
UNICEF ist seit den 1970er-Jahren für
Kinder in Syrien im Einsatz und hat seit 2011 sehr
umfangreiche Not- und Übergangshilfe in Syrien und den
Nachbarländern geleistet. Im ersten Halbjahr 2024 hat UNICEF
beispielsweise mehr als eine Million Kinder in Syrien mit
grundlegenden Gesundheitsprogrammen erreicht. Mehr als eine
Million Kinder wurden auf schwere Mangelernährung untersucht
und mit Nahrungsmitteln, Mikronährstoffpräparaten und
Beratungsdiensten versorgt. Rund 600.000 Kinder erhielten
Zugang zu Bildungsangeboten und mehr als 14 Millionen
Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
UNICEF steht
bereit, um in der aktuell unsicheren Lage die dringend
benötigte humanitäre Hilfe auszuweiten.
UNICEF
Deutschland ruft zu Spenden für Kinder in Syrien auf:
www.unicef.de/syrien.
|
|
2050: Wie Demografie, Klima und Technologie die
Kindheit verändern
|
|
Neuer UNICEF-Bericht „Zur Lage der Kinder
in der Welt“ / Aufruf zum Handeln und bundesweite Aktionen
zum Internationalen Tag der Kinderrechte

© UNICEF/UNI552921/Elfatih
New York/Köln/Duisburg, 20. November
2024 - Die Zukunft der Kindheit hängt in der
Schwebe, wenn die Kinderrechte in einer sich rapide
verändernden Welt nicht dringend besser geschützt und
umgesetzt werden. Davor warnt UNICEF in einem am heutigen
Internationalen Tag der Kinderrechte veröffentlichten neuen
Bericht.
In der diesjährigen Ausgabe des Reports „Zur
Lage der Kinder in der Welt“ mit dem Titel „The Future of
Childhood in a Changing World“ richtet das
UN-Kinderhilfswerk UNICEF den Blick in das Jahr 2050. Anhand
von Projektionen untersucht der Report, wie sich die drei
Megatrends demografischer Wandel, Klima- und Umweltkrise
sowie technologische Entwicklungen auf Kinder auswirken
werden.
„Kinder erleben unzählige Krisen, von
Klimawandel bis hin zu Online-Gefahren, und diese werden
sich in den kommenden Jahren noch verschärfen“, sagte
UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell. „Die
Projektionen in diesem Bericht zeigen, dass die
Entscheidungen, die die Staats- und Regierungschefs heute
treffen – oder nicht treffen –, die Welt prägen, die die
Kinder erben werden. Um für 2050 eine bessere Zukunft zu
erschaffen braucht es mehr als nur Vorstellungskraft, es
braucht Taten. Jahrzehnte des Fortschritts, besonders für
Mädchen, sind in Gefahr.“
Die Klimakrise hat bereits
heute gravierende Auswirkungen; 2023 war das heißeste Jahr
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dem Bericht zufolge
werden Klima- und Umweltkrisen im Jahrzehnt 2050 bis 2059
voraussichtlich noch weiter zunehmen. Im Vergleich zu den
2000er Jahren werden, wenn sich aktuelle Trends fortsetzen,
achtmal so viele Kinder extremen Hitzewellen, dreimal so
viele Kinder extremen Flussüberschwemmungen und fast doppelt
so viele Kinder extremen Waldbränden ausgesetzt sein.
Wie sich diese Klimagefahren auf Kinder auswirken, hängt
von ihrem Alter, ihrer Gesundheit, ihrer sozioökonomischen
Lage und ihrem Zugang zu Ressourcen ab. So hat
beispielsweise ein Kind mit Zugang zu klimaresilienten
Unterkünften, Klimaanlagen, Gesundheitsversorgung, Bildung
und sauberem Wasser eine größere Chance, Klimaschocks zu
überleben, als ein Kind ohne Zugang. Der Bericht
unterstreicht die dringende Notwendigkeit gezielter
Umweltmaßnahmen, um alle Kinder zu schützen und die Risiken,
denen sie ausgesetzt sind, zu mindern.
Die
demografische Entwicklung bringt ebenfalls große
Herausforderungen mit sich. In den 2050er Jahren werden
Subsahara-Afrika und Südasien voraussichtlich die
zahlenmäßig größten Kinderpopulationen haben. Der Anteil der
Kinder und Jugendlichen wird in allen Regionen der Welt
voraussichtlich sinken, in Afrika mit 40 Prozent (rund 50
Prozent in den 2000er Jahren) aber weiterhin hoch bleiben.
In Ostasien und Westeuropa wird der Anteil der
Kinder der Projektion zufolge von zuvor 29 beziehungsweise
20 Prozent der Bevölkerung in den 2000er Jahren auf unter 17
Prozent sinken. Diese Veränderungen bedeuten für manche
Länder die Herausforderungen, sehr viele Kinder mit
Grunddiensten versorgen zu müssen, während andere die
Bedürfnisse von Kindern und einer wachsenden älteren
Bevölkerung ausbalancieren müssen.
Bahnbrechende neue
Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) bieten Kindern
sowohl Chancen als auch Gefahren. Bereits jetzt interagieren
viele Kinder mit KI, die in Apps, Spielzeugen, virtuellen
Assistenten, Spielen und Lernsoftware eingebettet ist. Aber
die digitale Kluft bleibt groß. Im Jahr 2024 waren über 95
Prozent der Menschen in Ländern mit hohem Einkommen mit dem
Internet verbunden, verglichen mit nur knapp 26 Prozent in
Ländern mit niedrigem Einkommen. Vielen jungen Menschen
fehlen die nötigen digitalen Kompetenzen, die sie für
bessere Bildung und Berufsaussichten brauchen.
Positive Trends/ Drei Zukunftsszenarien
Der Bericht
enthält jedoch auch gute Nachrichten. Wie Kindheit im Jahr
2050 wirklich aussehen wird, hängt von vielen Faktoren ab.
Im UNICEF-Bericht werden drei mögliche Zukunftsszenarien
vorgestellt. Im schlechtesten Fall, dass sich die
Entwicklung verlangsamt, steigt zum Beispiel die Gefahr von
regionalen Rivalitäten und Konflikten. Im besten Szenario
einer beschleunigten Entwicklung könnten nahezu alle Kinder
eine Grundschul- und weiterführende Bildung erhalten.
Im mittleren Szenario, wenn aktuelle Trends sich
fortsetzen, steigt die Lebenserwartung, während die
Kindersterblichkeit weiter sinkt. In den 2050er Jahren
erhalten dann fast 96 Prozent der Kinder weltweit mindestens
eine Grundschulbildung, verglichen mit 80 Prozent in den
2000er Jahren. Aber die Klimarisiken steigen stark, und ein
größerer Teil der Kinder und Jugendlichen (23 Prozent statt
elf Prozent) wird dann in Ländern mit niedrigem Einkommen
aufwachsen.
Der UNICEF-Bericht unterstreicht, wie
wichtig es ist, die in der UN-Kinderrechtskonvention
dargelegten Kinderrechte in allen Strategien, Richtlinien
und Maßnahmen in den Mittelpunkt zu stellen, um eine gute
Zukunft zu sichern. Insbesondere fordert UNICEF
Investitionen in Bildung und Gesundheit von Kindern,
Klimaschutz und –anpassung sowie Internetzugang und digitale
Kompetenzen für alle Kinder.
Bundesweiter Aktionstag
in Deutschland: Kinderrechte und Demokratie
Rund um den
heutigen Internationalen Tag der Kinderrechte – dem Tag, an
dem vor 35 Jahren die UN-Kinderrechtskonvention
verabschiedet wurde – finden weltweit zahlreiche Aktionen
für Kinderrechte statt. Als Zeichen für Kinder und ihre
Rechte werden beispielsweise bekannte Gebäude blau
angestrahlt.
Bei den vielfältigen Aktionen in
Deutschland steht das Motto „Kinderrechte leben. Demokratie
stärken.“ im Fokus. Denn die konsequente Verwirklichung der
Kinderrechte ist nicht nur entscheidend für das Wohlergehen
der Kinder und Jugendlichen, sondern auch ein
unverzichtbarer Beitrag zur Stärkung unserer
freiheitlich-demokratischen Gesellschaft.
Im Rahmen
einer bundesweiten Mitmachaktion machen sich über eine
Viertelmillion Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland
mit UNICEF für ihre Rechte stark. Gemeinsam füllen sie die
Aktionsbotschaft „Du gehörst dazu" an ihrer Schule mit Leben
und setzen in ihrer Stadt ein Zeichen für Vielfalt und
Zusammenhalt. Ehrenamtlich für UNICEF engagierte Menschen
machen in allen Teilen des Landes auf die Kinderrechte
aufmerksam und führen vor Ort Gespräche mit
Entscheider*innen aus Politik und Wirtschaft.
|
|
UNICEF: Durchschnittlich 16 Kinder pro Woche in
der Ukraine getötet oder verletzt
|
|
1.000 Tage Krieg in der Ukraine -
Familien leiden unter harten Bedingungen vor drittem Winter
-
UNICEF ruft vor dem beginnenden Kriegswinter dringend zu
Spenden auf:
www.unicef.de/ukraine

Sofia in der Region Charkiw mit einem
Winterhilfe-Paket von UNICEF (Archivbild November 2023). Den
Kindern in der Ukraine steht ein weiterer schwerer
Kriegswinter bevor. © UNICEF/UNI497964/Filippov
New
York/Kiew/Köln/Duisburg, 18. November 2024 - Seit August
2024 mussten rund 170.000 Menschen ihre Häuser im Osten des
Landes verlassen, viele wurden aus Gebieten evakuiert, in
denen heftige Kämpfe stattfanden. Insgesamt sind fast 3,6
Millionen Menschen innerhalb der Ukraine vertrieben. Über
6,75 Millionen haben außerhalb des Landes Zuflucht gesucht.
In Europa sind neun von zehn geflüchteten Menschen aus der
Ukraine Frauen und Kinder.
In den Frontgebieten
brauchen fast drei Millionen Menschen dringend Wärme,
sauberes Wasser und medizinische Versorgung. Schulen und
Krankenhäuser sind immer wieder Ziel von Angriffen. In den
letzten tausend Tagen wurden nach Angaben der Vereinten
Nationen mindestens 1.496 Bildungseinrichtungen und 662
Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine beschädigt oder
zerstört. Rund 1,7 Millionen Kinder haben keinen Zugang zu
sauberem Wasser, und 3,4 Millionen haben keinen Zugang zu
zentralisierten Sanitäreinrichtungen, was ihr
Krankheitsrisiko erhöht.
„Schulen, Krankenhäuser und
zivile Infrastruktur sind nicht nur Gebäude; sie sind
Lebensadern und Symbole der Hoffnung für die Erholung und
Widerstandsfähigkeit der Kinder“, sagte Russell. „Die Kinder
der Ukraine müssen vor dem anhaltenden Horror dieses Krieges
geschützt werden. Die Welt kann nicht schweigen, während sie
leiden.“
UNICEF fordert weiterhin, das humanitäre
Völkerrecht durch den Schutz von Kindern und der für ihr
Überleben entscheidenden Infrastruktur aufrechtzuerhalten.
Die sofortige Beendigung des Einsatzes explosiver Waffen in
besiedelten Gebieten und aller schweren Übergriffe gegen
Kinder muss oberste Priorität haben.
Trotz der großen
Herausforderungen bleiben UNICEF und seine Partner vor Ort
im Einsatz und helfen Kindern und Familien unter anderem
durch psychosoziale Unterstützung, Bildung und grundlegende
Dienstleistungen wie Wasser- und Sanitärversorgung. Der
Nothilfe-Aufruf für Kinder in der Ukraine und für aus der
Ukraine geflüchtete Kinder in den Nachbarländern in 2024 ist
noch um 30 Prozent unterfinanziert.
|
|
|
|






 •
BZ-Sitemap
•
BZ-Sitemap