






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 4. Kalenderwoche:
18. Januar
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Montag, 20. Januar 2024
Azubis begeistern Schüler für Ausbildung - 43
Ausbildungsbotschafter von IHK geehrt
Ausbildungsbotschafter besuchen Schulen in der Region und
informieren über die berufliche Ausbildung. So erfahren Schüler aus
erster Hand, wie der Alltag eines Azubis in einem Unternehmen
wirklich aussieht. Am 16. Januar wurden 43 Ausbildungsbotschafter
für ihren Einsatz von der Niederrheinischen IHK geehrt. Insgesamt
bekamen 110 Azubis eine Urkunde.
Berufsorientierung auf
Augenhöhe: Dafür gehen Auszubildende aus Duisburg sowie den Kreisen
Kleve und Wesel persönlich in die Schulen. Als
IHK-Ausbildungsbotschafter berichten sie den Schülern von ihren
Erfahrungen und geben praktische Einblicke in ihre Berufe. Sie
beantworten Fragen zur Karriere und bringen ihnen die Berufswelt
näher.
Bevor es losgeht, werden die Azubis von der IHK in
Kommunikation und Präsentation geschult. 2024 wurden 175 neue
Ausbildungsbotschafter ausgebildet, die insgesamt über 3000 Schüler
in der Region erreicht haben. Die Initiative trägt maßgeblich dazu
bei, junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern.

Matthias Wulfert, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung, dankte den
Azubis für Ihr Engagement.
„Unsere
Ausbildungsbotschafter können den Jugendlichen die Vielfalt und die
Chancen einer Ausbildung authentisch vermitteln. So leisten sie
einen wichtigen Beitrag zur Berufsorientierung“, sagt Matthias
Wulfert, Geschäftsführer für Aus- und Weiterbildung bei der
Niederrheinischen IHK. „Durch ihre eigenen Geschichten und
Erfahrungen machen sie die berufliche Zukunft für die Schüler
greifbar und realistisch.“
Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) fördert das landesweite Projekt
„Ausbildungsbotschafter und Ausbildungsbotschafterinnen NRW –
Unterwegs für Kein Abschluss ohne Anschluss“. Die Koordination vor
Ort übernehmen die Handwerks- sowie Industrie- und Handelskammern.
Interessierte Unternehmen und Schulen können sich bei
IHK-Projektkoordinatorin Meike Komatowsky melden unter 0203 2821-495
oder über komatowsky@niederrhein.ihk.de.

Die Niederrheinische IHK ehrte 43 erfolgreiche
Ausbildungsbotschafter. Fotos: Niederrheinische IHK/Bettina
Engel-Albustin
Stadtteilbibliothek Ruhrort:
Nachhaltigkeit im digitalen Zeitalter
Die Frage, ob
Papier oder Tablets die bessere Wahl für Mensch und Umwelt sind,
steht im Mittelpunkt der Veranstaltung „Buch oder Byte?
Nachhaltigkeit im digitalen Zeitalter“, die am Freitag, 24. Januar,
um 15 Uhr in der Stadtteilbibliothek Ruhrort, Amtsgerichtsstr. 5,
stattfindet.
Das Team der Bibliothek lädt ein, gemeinsam
zu ergründen, wie ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen im
digitalen und analogen Bereich gestalten werden kann. Der Termin
gehört zur Reihe „Wissen, Aktion, Zukunft – die grüne Bibliothek
erleben“. Monatlich finden kreative Angebote für alle Altersgruppen
statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Um Anmeldung auf
der InternetSeite www.stadtbibliothek-duisburg.de wird gebeten.
Fragen beantwortet das Team der Bibliothek gerne persönlich oder
telefonisch unter 0203 89729. Die Öffnungszeiten sind mittwochs und
donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 10.30 bis 13 und 14 bis
18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.
Neuer
Intensivkurs der VHS: Sprechhemmungen
abbauen – Englisch auffrischen
Die Volkshochschule Duisburg bietet im
Januar 2025 wieder einen
EnglischIntensivkurs zum schnellen
Wiedereinstieg an. Eine Woche lang frischen
die Teilnehmenden ihre Englisch-Kenntnisse
auf und bauen Sprechhemmungen ab. Für
Anfänger ohne Vorkenntnisse eignet sich der
Intensivkurs nicht. Es sollte mindestens die
Niveaustufe A2 abgeschlossen sein. Erfahrene
Kursleitungen lehren, wie man flüssig
argumentiert und diskutiert.
Außerdem werden die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in Kleingruppen derselben
Niveaustufe Texte zu aktuellen Themen aus
Politik, Gesellschaft und Kultur auswerten
und verfassen. Der Kurs findet in der Woche
vom 20. bis 24. Januar statt. Er geht
jeweils von 9 Uhr bis 15.30 Uhr und kostet
175 Euro (Ermäßigungen möglich).
Eine Anmeldung ist erforderlich. Der Kurs
ist auch als Bildungsurlaub buchbar. Nähere
Informationen erteilt Franziska
Russ-Yardimci unter Tel. 0203-283- 2655.
Anmeldungen per Mail an
f.russ-yardimci@stadt-duisburg.de.
Neue Daten IMK-Konjunkturindikator: Rezessionsrisiko
geringfügig gesunken, doch Unsicherheit bleibt hoch
Das
Risiko, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2025 in eine
Rezession gerät, ist in den vergangenen Wochen leicht gesunken, die
ökonomische Unsicherheit bleibt aber vor dem Amtsantritt des neuen
US-Präsidenten und der Bundestagswahl hoch. Das signalisiert der
monatliche Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.

Für den Zeitraum von Januar bis Ende März 2025 weist der
Indikator, der die neuesten verfügbaren Daten zu den wichtigsten
wirtschaftlichen Kenngrößen bündelt, eine
Rezessionswahrscheinlichkeit von 44,6 Prozent aus. Anfang Dezember
2024 betrug sie für die folgenden drei Monate noch 48,7 Prozent.
Trotz der leichten Entspannung bleibt der nach dem Ampelsystem
arbeitende Indikator aber wie in den Vormonaten auf „gelb-rot“,
zumal sich die statistische Streuung des Indikators, in der sich die
Verunsicherung der Wirtschaftsakteure ausdrückt, parallel leicht
erhöht hat.
„Gelb-rot“ signalisiert konjunkturelle
Unsicherheit, aber keine akute Rezessionsgefahr. Das deutet auf eine
stagnierende Wirtschaft im aktuellen Winterquartal hin. Die aktuelle
Abnahme des Rezessionsrisikos beruht vor allem auf dem spürbaren
Produktionsanstieg im November 2024, dem aktuellsten Monat, für den
derzeit Daten vorliegen. Allerdings dürften für diese positive
Entwicklung Sondereffekte wie die Auslieferung einzelner
Großaufträge eine erhebliche Rolle gespielt haben, analysiert
IMK-Konjunkturexperte Dr. Thomas Theobald.
Eine
konjunkturelle Trendwende in der Industrie bleibe vorerst aus, wie
auch die schwache Entwicklung bei den Auftragseingängen nahelegt.
Und das Konsumentenvertrauen nimmt nur äußerst langsam zu – obwohl
die Haushalte Zuwächse bei den Realeinkommen erzielen. Die neuen
Indikatorwerte bestätigten die aktuelle Konjunkturprognose des IMK,
erklärt Theobald. Das Düsseldorfer Institut rechnet für dieses Jahr
nur mit einem Mini-Wachstum von durchschnittlich 0,1 Prozent.
Die Wachstumsschwäche lässt sich nach Analyse des IMK nur
durch entschlossenes Handeln der nächsten Bundesregierung
überwinden, das drei Schwerpunkte setzt: Erstens eine
Investitionsoffensive, um die Infrastruktur zu verbessern. Zweitens:
Eine Lösung für das Problem hoher und volatiler Energiepreise –
kurzfristig durch einen Brückenstrompreis, längerfristig
beispielsweise durch eine Finanzierung des Netzausbaus über
öffentliche Kredite.
Drittens raten die Forschenden zu
einer neuen, in der EU koordinierten, Industriepolitik, die zentrale
Zukunfts- und Schlüsselbranchen bei der Transformation hin zu
klimafreundlichen Prozessen unterstützt.* „Vor dem Hintergrund, dass
Donald Trump im internationalen Handel Chaos verursachen wird, und
dass mit immer länger anhaltender Stagnation Kipppunkte bei der
Beschäftigung drohen, wird die Wirtschafts- und insbesondere eine
europäisch koordinierte Industriepolitik für die neue
Bundesregierung zur Herkules-Aufgabe“, betont Ökonom Theobald.
„Leider gehen die wirtschaftspolitischen Vorschläge im
Bundestagswahlkampf vielfach am Ziel vorbei, die relevanten
Unsicherheiten zu reduzieren. Steuererleichterungen allein regen
nicht zwangsläufig realwirtschaftliche Investitionen in dem Umfang
und den Bereichen an, in denen die volkswirtschaftlich sinnvollsten
Bedarfe bestehen.“, sagt Theobald.
Zentralbibliothek im Stadtfenster am 20. Januar geschlossen
Die Zentralbibliothek einschließlich der Kinder- und
Jugendbibliothek, im Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in der
Stadtmitte bleibt am Montag, 20. Januar, wegen einer internen
Fortbildung geschlossen. Die Open Libraries in Wanheimerort, Beeck
und Vierlinden stehen Kundinnen und Kunden mit Bibliotheksausweis an
diesem Tag von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung.
Ebenso können
die digitalen Angebote der Stadtbibliothek genutzt werden. Für
weitere Informationen und Fragen steht das Team der Bibliothek
persönlich oder telefonisch unter der Nummer (0203) 283-4218 zur
Verfügung. Die Öffnungszeiten sind montags von 13 bis 19 Uhr,
dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 16
Uhr.
Betrugsversuche nehmen zu: Vorsicht beim
Scannen von QR-Codes im Ausland
Seit der Corona-Pandemie
sind QR-Codes aus dem Verbraucheralltag nicht mehr wegzudenken. Das
haben auch Kriminelle erkannt, die mit gefälschten QR-Codes und
Webseiten versuchen, schnelles Geld zu machen.
Aufpassen müssen
insbesondere Autofahrerinnen und Autofahrer. Denn der Betrug (auch
Quishing genannt) findet meist an Ladesäulen für Elektroautos oder
an Parkautomaten statt.

© Touchr / Adobe Stock
Quishing: So gehen die Täter vor
In
einem ersten Schritt erstellen die Kriminellen eine Internetseite,
die einer offiziellen Seite zum Beispiel einer Stadt oder eines
Ladesäulenbetreibers ähnelt.
Im zweiten Schritt präparieren
die Betrüger einen QR-Code, der auf die gefälschte Seite verlinkt.
Den ausgedruckten QR-Code bringen sie dann an öffentlichen
Parkuhren, Ladesäulen für Elektroautos etc. an oder überkleben die
echten QR-Codes. Verbraucherinnen und Verbraucher, die nun den
QR-Code scannen und ihre persönlichen Daten eingeben, um z.B. eine
Rechnung zu begleichen, zahlen das Geld direkt an die Betrüger bzw.
geben ihre Daten direkt an diese weiter.
Wo kann man dem
CR-Code-Betrug begegnen?
Quishing ist vor allem im öffentlichen
Raum anzutreffen. Dort, wo QR-Codes bereits vorhanden sind, um einen
Vorgang zu erleichtern, damit Verbraucher zum Beispiel eine Gebühr
einfach bezahlen können. Also an Parkuhren, E-Ladesäulen, an
Bahnhöfen, Bushaltestellen, Fahrradverleihstationen oder über
gefälschte Strafzettel an der Windschutzscheibe.
Die
Betrugsversuche wurden bereits europaweit gemeldet - Urlauber können
ihnen also in jedem Land begegnen.
Wie kann man sich vor dem
QR-Code-Betrug schützen?
Seien Sie bei öffentlichen QR-Codes
skeptisch: QR-Codes auf Flyern, Plakaten oder anderen öffentlichen
Orten können leicht manipuliert oder ausgetauscht werden. Scannen
Sie diese nur, wenn Sie der Quelle vertrauen.
Prüfen Sie
Alternativen: Verwenden Sie, wenn möglich, die direkte Eingabe der
URL anstelle eines QR-Codes.
Prüfen Sie Links genau: Viele
QR-Scanner-Apps zeigen die URL vor dem Öffnen an. Kontrollieren Sie
diese sorgfältig und achten Sie auf verdächtige Domains oder
Rechtschreibfehler.
Im Zweifel nicht interagieren: Schließen
Sie die Website, wenn Sie unsicher sind, und geben Sie keine
persönlichen Daten oder Bankinformationen ein.
Handeln Sie bei
Betrug: Sollte es zu einer verdächtigen Transaktion gekommen sein,
sperren Sie die Kreditkarte umgehend, beantragen Sie bei Ihrer Bank
ein Chargeback und informieren Sie Polizei sowie den Betreiber.
Hier finden Sie ausführliche Informationen zum Thema Quishing und
wie Sie sich davor schützen können.
Stadtwerke
Duisburg nehmen neue Ladepunkte im Stadtwesten in Betrieb
Duisburg hat sich ehrgeizige Ziele auf dem Weg zur
klimaneutralen Stadt gesetzt. Gemeinsam haben Stadt und Stadtwerke
Duisburg auf diesem Weg schon viel erreicht. Der Ausbau von
Ladeinfrastruktur für Elektromobilität in der gesamten Stadt geht
konsequent voran, um allen Menschen in Duisburg die Gelegenheit zu
geben, ihre Mobilität klimafreundlich zu gestalten. In den
vergangenen Wochen hat der lokale Energiedienstleister weitere acht
neue Ladepunkte im Westen der Stadt in Betrieb genommen.

An der Ottostraße in Homberg-Hochheide können Elektroautos ab sofort
unkompliziert an einer Ladesäule der Stadtwerke Duisburg geladen
werden. Quelle: Stadtwerke Duisburg
Jeweils zwei neue
Ladepunkte stehen jetzt an der Friedrichstraße in Homberg auf Höhe
der Hausnummer 3, an der Ottostraße in Homberg-Hochheide auf Höhe
der Hausnummer 15, an der Bachstraße in Rheinhausen auf Höhe der
Hausnummer 2 und an der Giesenfeldstraße in Rumeln-Kaldenhausen auf
Höhe der Hausnummer 5.
Die Stadtwerke sind der erste
Ansprechpartner zu allen Fragen rund um die Elektromobilität in
Duisburg. Der lokale Energiedienstleister betreibt insgesamt 206
Ladepunkte an 86 Standorten im Stadtgebiet. Davon sind 24 Ladepunkte
sogenannte Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung zwischen 49 und
150 kW.
Zusätzliche 36 Ladepunkte an 12 Standorten
befinden sich aktuell im Bau und für weitere 90 Ladepunkte an 37
Standorten wurden Prüfanträge bei der Stadtverwaltung eingereicht.
Die Stadtwerke treiben den Ausbau kontinuierlich voran. Das Ziel
ist, einen Bestand von 500 Ladepunkten aufzubauen. Die neu
installierten Ladesäulen entsprechen dem neuesten Stand der Technik
und den aktuellen Anforderungen des Mess- und Eichrechts. Die
Ladesäulen der Stadtwerke Duisburg sind an den Verbund ladenetz.de
angeschlossen, zu dem rund 260 Anbieter von Ladeinfrastruktur
gehören.
Insgesamt stehen über 19.000 Ladepunkte in ganz
Deutschland zur Verfügung. Durch Kooperationen auf internationaler
Ebene kommen europaweit rund 278.000 Ladepunkte hinzu. Kundinnen und
Kunden der Stadtwerke Duisburg können mit einer entsprechenden
Stadtwerke-Ladekarte an diesen Säulen ihr Elektroauto laden. Das
Laden ist neben der Ladekarte auch durch das Scannen des
angebrachten QR-Codes oder der „ladeapp“ an allen Ladestationen der
Stadtwerke Duisburg möglich. Somit gibt es auch die Möglichkeit, den
Ladevorgang ganz bequem spontan zu starten. Eine Ladekarte der
Stadtwerke Duisburg können Interessierte über das Online-Formular
unter swdu.de/ladekarte
bestellen. Kundinnen und Kunden profitieren dabei von einem
Preis-Vorteil in Höhe von 60 Euro im Jahr.
Sozialer Zusammenhalt in Europa: Kohäsions-
und Strukturförderung unabdingbar dafür
Die
aktuellen Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge e.V. bekräftigen eine ambitionierte Kohäsions- und
Strukturförderung durch den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR)
der EU.
Der Mehrjährige Finanzrahmen gibt für eine
siebenjährige Periode die Ausgabeposten des EU-Haushalts vor.
Hierfür hat der Deutsche Verein nun seine Empfehlungen mit Blick auf
die in 2025 anstehenden Verhandlungen zum MFR formuliert.
Die von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen formulierten
politischen Richtlinien für die anstehende Legislatur kündigen
grundlegende Reformen für den nächsten MFR an. Die wichtigen
Programme zur Förderung der regionalen Entwicklung und des Sozialen
stehen dabei zur Disposition.
„Herausforderungen wie eine
nachteilhafte demografische Entwicklung oder der Umbau von
energieintensiven Wirtschaftsstrukturen stellen insbesondere
strukturschwache Regionen in ganz Europa vor große
Herausforderungen“, so Dr. Irme Stetter-Karp, Präsidentin des
Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V.
„Europäische Förderprogramme wie der Europäische Fonds für regionale
Entwicklung oder der Europäische Sozialfonds sind nicht nur
essenziell für die regionale Entwicklung, sondern auch für die
Sichtbarkeit der EU in allen Regionen.“
Durch die lang
etablierten EU-Förderprogramme haben sich zahlreiche
Versorgungsstrukturen von sozialen und anderen lokalen Akteuren
etabliert, die ohne die Förderung wegbrechen würden. Gerade die
freien Träger können über den Europäischen Sozialfonds Angebote für
die Schwächsten in unserer Gesellschaft schaffen, die sie ohne
EU-Mittel nicht ermöglichen könnten. Sie leisten so einen wichtigen
Beitrag für den sozialen Zusammenhalt in Europa.
Die
Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge e.V. zur Kohäsions- und Strukturpolitik im nächsten
Mehrjährigen Finanzrahmen der EU sind unter
https://www.deutscher-verein.de/fileadmin/user_upload/dv/pdfs/Empfehlungen_Stellungnahmen/2024/DV-22-24_Kohaesions-und_Strukturpolitik_der_EU_01.pdf
abrufbar.
Erinnerungen an Pauline Leicher:
Lesung im Obermeidericher Gemeindezentrum
Am 27. Januar
ist Holocaust Gedenktag. An diesem Tag lesen Heiner Feldhoff und
Claudia Schwamberger in der Kirche der Evangelischen Gemeinde
Duisburg Obermeiderich, Emilstr. 27, um 18 Uhr aus Feldhoffs Buch
„Pauline Leicher oder Die Vernichtung des Lebens“. Pauline Leicher,
1904 in Lautzert im Westerwald geboren, war geistig behindert; den
Nazis galt sie als „unwertes Leben“.
1941 wurde sie in
der Gaskammer von Hadamar ermordet. Trotz fehlender Quellen und
Dokumente – es gibt von ihr keine einzige Fotografie – hat Heiner
Feldhoff wesentliche Ereignisse aus ihrem 37jährigen Leben
zusammentragen können. Der Weg der Recherche zum Buch des in
Duisburg geborenen Autors macht deutlich, wie sehr Verdrängung und
Tabuisierung das Gedenken an die Opfer der NS-Euthanasie bis heute
erschweren.
Das Buch ist ein sehr persönlicher Appell
gegen das Vergessen, eine engagierte Erinnerung an die Verbrechen
damals in Hadamar und anderen sogenannten Tötungsanstalten. Und ein
ganz eigener Aufruf zur Wachsamkeit heute. Den musikalischen Rahmen
der Lesung gestaltet Martin Feldhoff am Flügel. Der Eintritt ist
frei. Infos zum Autor gibt es um Netz unter www.heinerfeldhoff.de,
zur Gemeinde unter
www.obermeiderich.de.
Über den Autor: Heiner
Feldhoff, geb. 1945, wuchs in Duisburg auf und ging dort aufs
Max-Planck-Gymnasium. Seit 1972 lebt er in Lautzert im Westerwald.
Bis 1996 im Schuldienst. Schreibt Lyrik und Prosa, Übersetzungen,
Biographien (Henry David Thoreau, Albert Camus, Paul Deussen). 2018
veröffentlichte er seine Jugenderinnerungen („Die Sonntage von
Duisburg-Beeck). Zuletzt erschien im Aisthesis-Verlag das „Lesebuch
Heiner Feldhoff“ (2022).
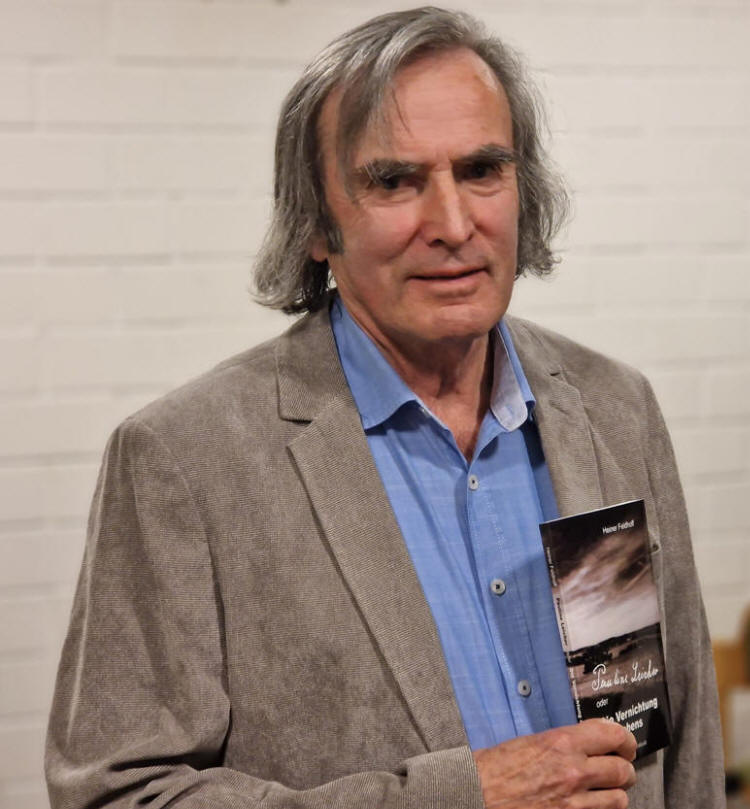
Heiner Feldhoff (Foto: Jens Schawaller).
Würfel,
Karten, Knabbereien Rheingemeinde lädt zum Spieleabend nach Wanheim
Spielen in großer Runde macht Spaß. Das wusste ein Team
um Presbyterin Ute Theisen aus der Evangelischen Rheingemeinde
Duisburg und plante im Sommer 2024 spontan einen Abend mit
Gesellschaftsspielen und mehr im Gemeindehaus Knevelshof. Gespielt
wurde dann u.a. „Dogs“ - eine Variante des bekannten „Mensch, ärgere
dich nicht“ - und der heimliche Spiele-Star unter den
Gemeinde-Aktiven: Sky-Jo, ein pfiffiges Kartenspiel. Weil das alles
so gut ankam, gibt es weiterhin Spieleabende in der Gemeinde.
So sind für Montag, 20. Januar 2025 Interessierte
eingeladen, ab 17 Uhr im Gemeindehaus Wanheim, Beim Knevelshof 45,
bei Knabbereien und Getränken Spaß mit solchen Spielen zu haben.
Anmelden muss sich niemand. Wer mag, darf sein Lieblingsspiel
mitbringen und es den anderen vorstellen. Mehr Informationen gibt es
bei Ute Theisen, 0177/8066048,
ute.theisen.1@ekir.de.

Spieleabend 29.7.2024 (Foto: Evangelisch Rheingemeinde Duisburg)
Evangelische Gemeinde Obermeiderich lädt wieder zum
kostenfreien Mittagstisch ein
Die Evangelische
Kirchengemeinde Duisburg Obermeiderich startete vor zwei Jahren
unter dem Motto „eine Kelle Suppe – eine Kelle Gemeinschaft“ einen
kostenfreien Mittagstisch. Sie lädt seitdem weiterhin alle Menschen
unabhängig von Religion und Kultur an einem Sonntag - meist dem
letzten - im Monat um zwölf Uhr zur gemeinsamen Mahlzeit in das
Gemeindezentrum an der Emilstraße 27 ein. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Das Essen ist gratis, Spenden werden aber
gerne entgegen genommen. Beim nächsten Mittagstisch, am 26. Januar
2025 kommen um 12 Uhr ein Möhrendurcheinander mit Mettwürstchen und
ein leckeres Dessert auf den Tisch. Alles mit Liebe gekocht!
Beim Mittagstisch geht es der Gemeinde und dem Team der
Ehrenamtlichen, die vom Schnibbeln, Kochen, Servieren und Abräumen
alles selber machen, um Hilfe für Menschen, die Hilfe benötigen. Und
um mehr: „Menschen brauchen in unserer herausfordernden und
unsicheren Zeit Angebote, die sowohl dem Leib als auch der Seele
guttun. Hunger hat viele Komponenten.
Deshalb gibt es
bei Emils Mittagstisch neben einer Kelle Suppe auch eine Kelle
Gemeinschaft“ sagt auch Sarah Süselbeck, Pfarrerin der Gemeinde, die
voll hinter dem Projekt steht und selbst mit anpackt. Infos zur
Gemeinde gibt es im Netz unter
www.obermeiderich.de.
Pfarrer Poll am Service-Telefon der
evangelischen Kirche in Duisburg
„Zu welcher Gemeinde
gehöre ich?“ oder „Wie kann ich in die Kirche eintreten?“ oder „Holt
die Diakonie auch Möbel ab?“: Antworten auf Fragen dieser Art
erhalten Anrufende beim kostenfreien Servicetelefon der
evangelischen Kirche in Duisburg.
Es ist unter der
Rufnummer 0800 / 12131213 auch immer montags von 18 bis 20 Uhr
besetzt, und dann geben Pfarrerinnen und Pfarrer Antworten auf
Fragen rund um die kirchliche Arbeit und haben als Seelsorgende ein
offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das Service-Telefon ist am Montag,
20. Januar 2025 von Tillmann Poll, Pfarrer in der Evangelischen
Kirchengemeinde Hochfeld-Neudorf, besetzt.

Über acht von zehn Tarifbeschäftigten erhielten bis Ende
2024 eine Inflationsausgleichsprämie
• Im Durchschnitt
lag die Inflationsausgleichsprämie bei 2 680 Euro
• Die
niedrigsten Prämien wurden im Baugewerbe gezahlt, im Gastgewerbe
erhielten anteilig die wenigsten Tarifbeschäftigten diese
Sonderzahlung
Mehr als acht von zehn Tarifbeschäftigten (86,3
%) in Deutschland haben im Zeitraum Oktober 2022 bis Dezember 2024
eine Inflationsausgleichsprämie erhalten. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der Statistik der
Tarifverdienste mitteilt, lag der durchschnittliche Auszahlbetrag
pro Person bei 2 680 Euro. Bei der Inflationsausgleichsprämie
handelte es sich um eine steuerfreie Sonderzahlung von bis zu 3 000
Euro, die je nach Tarifvereinbarung als Gesamtbetrag oder gestaffelt
in Teilbeträgen an die Beschäftigten ausgezahlt werden konnte. Die
Steuerfreiheit dieser Sonderzahlung war eine Maßnahme des dritten
Entlastungspakets der Bundesregierung zur Milderung der Folgen der
Energiekrise.
Deutliche Unterschiede zwischen den Branchen
Sowohl in der durchschnittlichen Höhe der Inflationsausgleichsprämie
als auch im Anteil der Tarifbeschäftigten, die eine solche Prämie
erhielten, gab es zwischen den einzelnen Branchen deutliche
Unterschiede: Die niedrigsten Prämien wurden im Baugewerbe mit
durchschnittlich 1 103 Euro sowie im Handel mit durchschnittlich
1 419 Euro gezahlt, die höchsten in den Wirtschaftsabschnitten
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung sowie
Erziehung und Unterricht mit jeweils 3 000 Euro.
Ebenfalls überdurchschnittlich hohe Inflationsausgleichsprämien
waren in den Bereichen Kunst, Unterhaltung und Erholung (2 976 Euro)
sowie Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung (2 942 Euro)
vereinbart worden. Alle Tarifbeschäftigten im Wirtschaftsabschnitt
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung verfügten
über einen tariflichen
Anspruch auf eine Inflationsausgleichsprämie.
Auch
viele Tarifbeschäftigte in den Wirtschaftsabschnitten Erziehung und
Unterricht (99,3 %), Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
(98,3 %) und Verarbeitendes Gewerbe (97,7 %) hatten einen Anspruch
darauf. Im Gastgewerbe (11,6 %) und im Bereich der Erbringung
sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen (12,2 %) profitierten
anteilig die wenigsten Tarifbeschäftigten von einer
Inflationsausgleichsprämie.
Durchschnittliche tarifliche
Inflationsausgleichprämie und Anteil der Berechtigten nach
Wirtschaftsbereichen
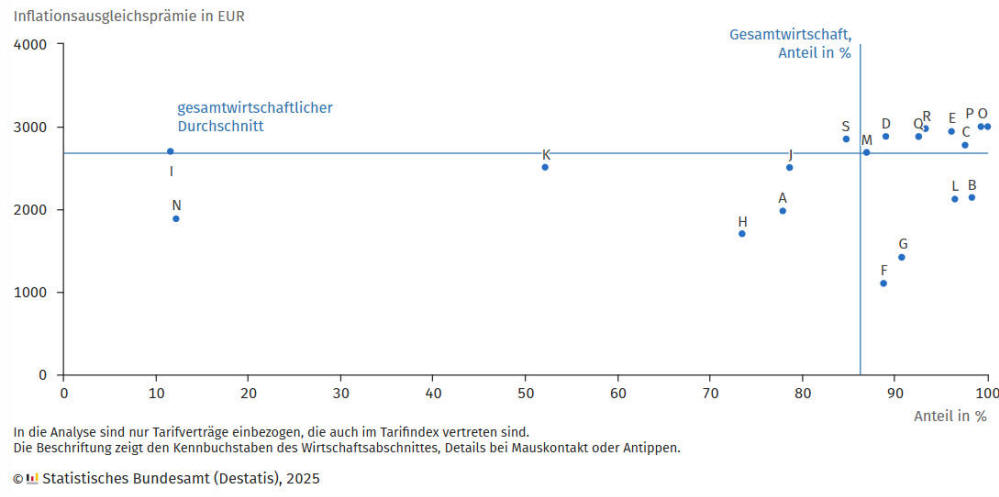
2,6 % weniger
Schwangerschaftsabbrüche im 3. Quartal 2024 als im Vorjahresquartal
Im 3. Quartal 2024 wurden in Deutschland rund 26 000
Schwangerschaftsabbrüche gemeldet. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, waren das 2,6 % weniger als im 3. Quartal 2023.
Die Ursachen für die Entwicklung sind anhand der Daten nicht
bewertbar. Insbesondere liegen keine Erkenntnisse über die
persönlichen Entscheidungsgründe für einen Schwangerschaftsabbruch
nach der Beratungsregelung vor.
68 % der Frauen, die im 3.
Quartal 2024 einen Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen, waren
zwischen 18 und 34 Jahre alt, 20 % zwischen 35 und 39 Jahre. 9 % der
Frauen waren 40 Jahre und älter, 3 % waren jünger als 18 Jahre. 42 %
der Frauen hatten vor dem Schwangerschaftsabbruch noch kein Kind zur
Welt gebracht.
96 % der gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche
wurden nach der Beratungsregelung vorgenommen. Eine Indikation aus
medizinischen Gründen oder aufgrund von Sexualdelikten war in den
übrigen 4 % der Fälle die Begründung für den Abbruch.
Die
meisten Schwangerschaftsabbrüche (45 %) wurden mit der Absaugmethode
durchgeführt, bei 42 % wurde das Mittel Mifegyne® verwendet. Die
Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant, darunter 85 % in
Arztpraxen beziehungsweise OP-Zentren und 13 % ambulant in
Krankenhäusern.