






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 16. Kalenderwoche:
15. April
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Mittwoch, 16. April 2025
Ärztlicher Notdienst in Nordrhein an Ostern einsatzbereit
Die niedergelassenen Ärzte in Nordrhein versorgen ihre
Patienten auch an den bevorstehenden Ostertagen. Wer zwischen
Karfreitag und Ostermontag akute gesundheitliche Beschwerden hat,
kann den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst kontaktieren.
Erste Anlaufstelle ist der telefonische Patientenservice 116 117.
Dieser kann eine medizinische Ersteinschätzung vornehmen und bei
Bedarf an eine der rund 90 Notdienstpraxen der Kassenärztlichen
Vereinigung Nordrhein (KVNO) verweisen. Informationen zu Adressen
und Öffnungszeiten gibt es auch im Netz unter www.kvno.de/notdienst.
Der Patientenservice 116 117 ist rund um die Uhr erreichbar und
hat seine Telefon-Kapazitäten zu den Feiertagen verstärkt.
Patienten, die nicht gehfähig oder bettlägerig sind, können über den
Patientenservice einen ärztlichen Hausbesuch erfragen. Außerdem
erhalten Anrufende auf Wunsch Hinweise über die Erreichbarkeiten der
fachärztlichen Notdienste im Rheinland (Augen-, HNO-,
Kinder-Notdienst).
Videosprechstunden für erkrankte Kinder
und Erwachsene
Zusätzlich haben sowohl Eltern erkrankter Kinder
als auch Erwachsene die Möglichkeit, eine Videosprechstunde im
Notdienst durchzuführen. Im Rahmen der digitalen Konsultation können
Symptome abgeklärt und Behandlungsmaßnahmen besprochen werden.
Sollte die Gabe von verschreibungspflichtigen Medikamenten notwendig
sein, ist das Ausstellen eines E-Rezeptes möglich.
Die
kinderärztliche Videosprechstunde ist samstags, sonntags und
feiertags von 10 bis 22 Uhr verfügbar. Das Videosprechstunde für
Erwachsene samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 21 Uhr.
Angefragt werden können beide Videosprechstunden-Angebote der KVNO
entweder über die Servicenummer 116 117 oder über www.kvno.de/kinder
bzw. www.kvno.de/erwachsene
Nachdem das gesundheitliche Beschwerdebild erfasst ist,
erhalten Anrufende per E-Mail einen Termin-Link. Wichtig: Patienten
sollten unbedingt ihre Versichertendaten bzw. die des erkrankten
Kindes zur Hand haben. Um die Videosprechstunde zu nutzen, wird
neben einer stabilen Internetverbindung ein Smartphone, Tablet,
Notebook oder einen Computer mit Kamera und Mikrofon benötigt.
Während des digitalen Arzt-Patienten-Gesprächs sollte eine möglichst
ruhige Umgebung ohne weitere anwesende Personen aufgesucht werden.
NGG-„Bäckerei-Monitor“: „Ohne Migranten wird
Brotbacken schwierig“
Es sind Frühaufsteher-Jobs:
1.180 Profis backen und verkaufen in Duisburg Brot und Brötchen. Sie
machen die Frühaufsteher-Jobs: Rund 1.180 Profis backen und
verkaufen in Duisburg Brot, Brötchen und Butterkuchen. „Sie müssen
früh auf den Beinen sein. Der Wecker rappelt bei vielen schon mitten
in der Nacht.
Morgenmuffel haben’s da eher schwer“, sagt
Adnan Kandemir von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG). Allerdings passiere in der Backbranche gerade viel, was die
Arbeit in Bäckereien erleichtern könne: „Schafft eine Bäckerei zum
Beispiel neue Kühltechnik an, kann der Teig schon am Vortag
vorbereitet werden. Morgens wird dann gebacken. Dadurch liegen ein
paar Stunden mehr Schlaf drin“, so Adnan Kandemir.
Der
Geschäftsführer der NGG Nordrhein appelliert an die Bäckereien in
Duisburg, die Jobs der Branche attraktiver zu machen. Immerhin
beklage gut die Hälfte der Beschäftigten im Backgewerbe, oft
Überstunden machen zu müssen. Das ist ein Ergebnis des
„Bäckerei-Monitors“, den die Hans-Böckler-Stiftung im Auftrag der
NGG gemacht hat.
Die Gewerkschaft hat dazu zum ersten Mal
bundesweit rund 1.400 Beschäftigte im Bäckerhandwerk und in der
Brotindustrie befragt. Künftig soll es die Branchen-Analyse einmal
pro Jahr geben. Beim ersten „Bäckerei-Monitor“ haben mehr als acht
von zehn Beschäftigten angegeben, dass sie oft Zeitdruck und Stress
im Job erleben. Knapp die Hälfte arbeitet mit wenig Pausen. Und
84 Prozent beklagen, dass Personalmangel im eigenen Betrieb für sie
zu spürbaren Belastungen führe.

Es staubt auch mal in Bäckereien. Aber das Backen von Brot und
Brötchen wird attraktiver: Inzwischen geht ein Bäckerei-Azubi im
dritten Ausbildungsjahr mit 1.230 Euro im Monat nach Hause, so die
Gewerkschaft NGG Nordrhein. Und ein Trend zeichnet sich ab: Immer
häufiger entscheiden sich junge Menschen, die als Flüchtlinge oder
Zuwanderer kommen, für einen Job-Start im Backgewerbe. Foto NGG
Tobias Seifert
„Fehlender Nachwuchs ist ein
entscheidender Punkt – vor allem für das Bäckerhandwerk“, sagt Adnan
Kandemir. Insgesamt gebe es aktuell in den 78 Betrieben des
Backgewerbes in Duisburg 78 Auszubildende – vom Bäcker-Azubi bis zur
Auszubildenden im Fachverkauf. Die NGG beruft sich bei den Angaben
zu Betrieben und Beschäftigten im Backgewerbe auf Zahlen der
Arbeitsagentur.
Beim Bäckerei-Nachwuchs sieht die NGG
Nordrhein einen Trend: Immer häufiger setzten Bäckereien in der
Region auf Migranten. „Eines ist klar: Ohne junge Menschen, die als
Geflüchtete oder Zuwanderer zu uns kommen, wird das Brotbacken von
morgen schwierig“, so Adnan Kandemir. Bereits heute habe bundesweit
jeder vierte Azubi im Backgewerbe einen Migrationshintergrund.
Für den Nachwuchs habe die NGG zusammen mit dem Zentralverband
des Deutschen Bäckerhandwerks einen wichtigen Anreiz gesetzt: „Das
Portemonnaie der Azubis in Bäckereien ist deutlich voller geworden.
Zum Ausbildungsstart bekommen sie bereits 1.020 Euro pro Monat. Und
im dritten Ausbildungsjahr sind es sogar 1.230 Euro“, so Adnan
Kandemir.
Die NGG kündigt an, noch in diesem Jahr mit den
Arbeitgebern über eine weitere Verbesserung der Arbeitsbedingungen
zu verhandeln – vor allem in der Brotindustrie: „Wichtig sind
bessere Arbeitszeiten. Es geht darum, die Belastungen gerade bei
Früh-, Spät- und Nachtschichten besser aufzufangen: Wenn auf sechs
Tage Schichtarbeit drei freie Tage folgen, dann lassen sich die Jobs
in der Brotindustrie dadurch enorm attraktiver machen“, sagt Adnan
Kandemir.
Die NGG werde sich unter dem Motto „Backen wir’s“
auch für bessere Löhne stark machen: „Es ist wichtig, dass alle
Bäckereien Tariflohn zahlen. Denn wenn der Lohn von heute schon ein
Problem ist, dann ist es die Rente von morgen erst recht“, so
Kandemir.
Bürgergespräch mit Oberbürgermeister Sören Link
Oberbürgermeister Sören Link möchte am Dienstag, 29. April, mit
den Duisburgerinnen und Duisburgern ins Gespräch kommen. Termine
können am Mittwoch, 16. April, angefragt werden.
Interessierten
Bürgerinnen und Bürgern steht hierfür das an diesem Tag
freigeschaltete Kontaktformular unter www.duisburg.de/dialog zur
Verfügung. Eine telefonische Kontaktaufnahme ist von 8.30 bis 16 Uhr
unter 0203 283- 6111 ebenfalls möglich.
Kommunionkinder führen Palmprozession durch Neumühl an
Pater Tobias Breer konnte mehr als 300 Teilnehmer am Palmsonntag
begrüßen. Beim Einzug in den Schmidthorster Dom durfte ein echter
Esel nicht fehlen. Duisburg. Die Palmprozession durch Neumühl gehört
in der Herz-Jesu-Gemeinde zu den Höhepunkten im Kirchenjahr. Diesmal
konnte Pater Tobias Breer wieder mehr als 300 Teilnehmer – darunter
80 Kinder – bei schönem Wetter begrüßen. Zuvor war ausgelost worden,
wer bei der Prozession den Jesus spielen darf.

Die 50 Kommunionkinder warteten gespannt auf das Ergebnis.
Losglück hatten Mia-Sophie und Alexander. Die Kommunionkinder hatten
sich auch an der Vorbereitung beteiligten. Nachdem sie am Vortag die
Beichte abgelegt hatten, bastelten sie die Palmbüsche aus Buchsbaum
und schmückten sie mit bunten Schleifen. Der Sonntag begann dann mit
einer Weihe vor dem Agnesheim.

Pater Tobias segnete die Palmzweige, bevor die Prozession durch
den nahegelegenen Stielmuspark begann. Die Gruppe sang unterwegs
Lieder und zog zur Herz-Jesu-Kirche. Eine Eselin namens Gabi ging
vorneweg. Mia-Sophie und Alexander führten in ihrer Rolle als Jesus
das Tier zum Schmidthorster Dom. Während des Gottesdienstes stand
der Esel vorne im Kirchenraum. Das freute die Kinder, die sich um
den Altar versammelten und Texte vorlasen.

Der Chor „Die PFad“ begleitete den Familiengottesdienst, den Pater
Tobias kindgerecht gestaltet hatte. „Es hat echt Spaß gemacht, auf
dem Esel zu reiten und Jesus zu spielen. Ich habe mich echt gefreut,
dass mein Name gezogen wurde“, sagte Alexander anschließend. Auch
Mia-Sophie sprach voller Begeisterung über den Palmsonntag: „Es war
toll, dass ich dabei sein durfte. Ich trug ein weißes Gewand und
durfte Jesus spielen, und alle anderen Kinder gingen mit ihren
Palmzweigen hinter uns her. Und der Einzug in die Kirche war
besonders schön.“
Undurchsichtige Abos: Vorsicht bei Reiseportalen und Flug-Flatrates
Immer mehr Reiseportale und Airlines werben mit Mitgliedschaften und
Abonnements, die scheinbar günstige Vorteile bieten. Doch oft sind
die Bedingungen intransparent, Kündigungen kompliziert und es lauern
versteckte Kosten. Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ)
Deutschland erklärt, worauf Reisende achten sollten.
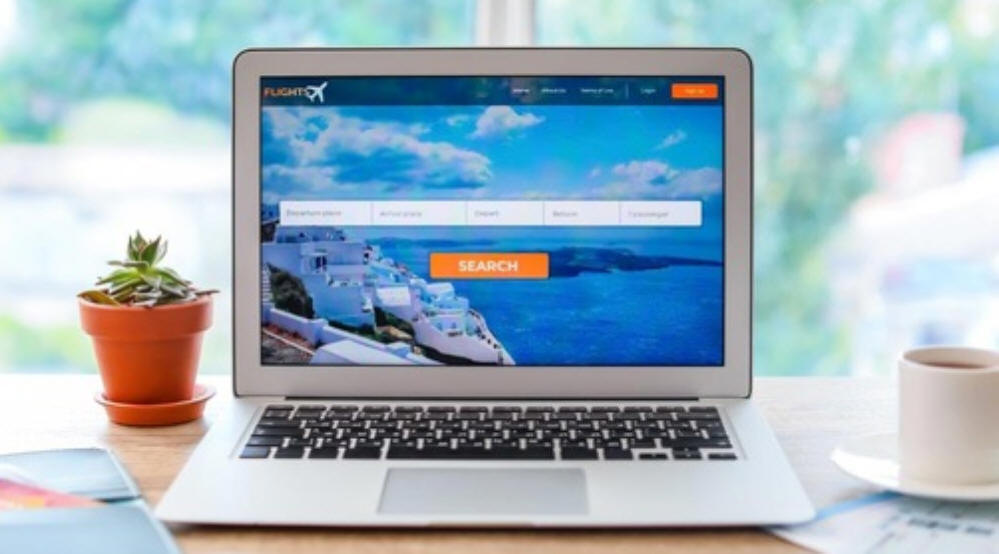
© Adobe Stock / Pixel-Shot
Typische Verbraucherbeschwerde
beim EVZ
Ein Verbraucher schloss ein kostenloses Probeabo bei
einem Reiseportal ab und wollte es kurze Zeit später kündigen –
vergeblich. Ohne seine Zustimmung wurde ihm eine Jahresgebühr von
89,99 € abgebucht. Erst nach Intervention des EVZ erhielt er sein
Geld zurück und das Abo wurde beendet.
Intransparente
Preisgestaltung und automatische Verlängerungen
Mitgliedschaften,
die Vergünstigungen bei Reisebuchungen versprechen, klingen
verlockend. Doch häufig ist nicht klar ersichtlich, dass eine
kostenlose Testphase nach einmaliger Nutzung nicht erneut gewährt
wird. Dies führt dazu, dass Verbraucher bei der nächsten Buchung
unwissentlich in eine teure Jahresmitgliedschaft rutschen.
Problematisch ist insbesondere:
Mangelnde Transparenz: Der
kostenpflichtige Übergang in die Mitgliedschaft wird oft nur
versteckt in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) erwähnt.
Irreführende Preisangaben: Der vergünstigte Abo-Preis wird
hervorgehoben, während der reguläre Preis weniger auffällt.
Schwierige Kündigungsmöglichkeiten: Kündigungsprozesse sind oft
unnötig kompliziert, obwohl das Gesetz eine einfache Kündigung
vorschreibt.
Flatrate-Fliegen: Nicht so flexibel wie
versprochen
Der Blick auf sogenannte Flug-Flatrates, bei denen
man zum Einheitspreis pro Jahr so viel Fliegen kann, wie man will,
zeigt, dass diese mehr versprechen, als sie halten. Wer eine solche
Mitgliedschaft erwägt, sollte wissen:
•
Eingeschränkte Streckenauswahl: Nicht alle Destinationen sind in der
Flatrate enthalten. Oft sind nur wenige attraktive Ziele verfügbar.
•
Buchungsbeschränkungen: Flüge können erst ein paar Tage vor Abflug
gebucht werden – langfristige Planung ist damit kaum möglich.
•
Zusatzkosten: Pro Flugstrecke wird i.d.R. eine zusätzliche Gebühr
fällig. Zudem sind nur minimale Handgepäckstücke inklusive –
normales Handgepäck oder aufgegebenes Gepäck kosten extra.
•
Strenge Stornoregeln: Wer öfter nicht zum gebuchten Flug erscheint,
kann die Mitgliedschaft verlieren und muss unter Umständen eine
Vertragsstrafe zahlen.
Hinzu kommt, dass eine Flug-Flatrate
Vielfliegen fördert und somit im Widerspruch zu den
Klimaschutzbemühungen steht.
Wichtige rechtliche Hinweise zu
Abonnements
•
Unternehmen müssen Verbraucher vor Vertragsabschluss klar über
Kosten, Laufzeit und Kündigungsbedingungen informieren.
•
Bei Online-Abos gilt die sogenannte Button-Lösung: Ein
kostenpflichtiger Vertrag darf nur durch eine eindeutige Bestätigung
wie „Zahlungspflichtig bestellen“ zustande kommen.
•
Zudem haben Verbraucher in der Regel ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
Seit März 2022 müssen viele Abonnements, darunter Abos und
Mitgliedschaften von Reiseportalen und Fluggesellschaften, nach der
Mindestlaufzeit monatlich kündbar sein. Ist deutsches Recht
anwendbar, muss zudem eine einfache Kündigungsmöglichkeit - etwa ein
„Kündigungsbutton“ auf der Webseite - zur Verfügung gestellt werden.
Tipps für Verbraucher:
•
Prüfen Sie genau, welche Leistungen wirklich in einem Abonnement
oder einer Flug-Flatrate enthalten sind.
•
Lassen Sie sich nicht von besonders hervorgehobenen Rabatten oder
Preisen täuschen.
•
Lesen Sie die Vertragsbedingungen sorgfältig – insbesondere zu
Kündigung und automatischer Verlängerung.
•
Achten Sie auf versteckte Gebühren oder Zusatzkosten.
•
Informieren Sie sich auf unabhängigen Bewertungsportalen über die
Erfahrungen anderer Reisender.
•
Nutzen Sie Ihr gesetzliches Widerrufsrecht, falls Sie sich ungewollt
gebunden fühlen.
Alte Sorten im Freizeitgarten:
eine gute Idee? Antworten vom Gartenbauexperten
Mehr
Abwechslung auf dem Teller, die Erhaltung der Sortenvielfalt, der
Wunsch nach regionalspezifischem Obst und Gemüse: Alte Sorten
erleben in letzter Zeit einen regelrechten Hype. Auch bei
Hobbygärtnern stoßen Früchte wie „Schöner von Nordhausen“ oder
„Wangenheims Frühzwetschge“ auf großes Interesse. Doch sind die
alten Sorten überhaupt für den Anbau im privaten Obst- und
Gemüsegarten geeignet? Antworten gibt Dr. Lutz Popp,
Gartenbauexperte vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und
Landespflege e. V. (BLGL).

Eine alte Sorte ist die Goldparmäne, die schon um 1205 in Frankreich
angebaut wurde und seitdem Mensch und Tier schmeckt. Quelle: BLGL
Was sind alte Sorten?
Eine rechtliche Definition, was als
alte Sorte gilt, existiert nicht. „Gemeint sind damit im Allgemeinen
Nutzpflanzen, die teils über Jahrhunderte vermehrt und kultiviert
wurden, im modernen Erwerbsanbau aber keine Rolle mehr spielen“,
weiß Dr. Lutz Popp, Experte vom BLGL.
Viele der alten Sorten
sind inzwischen unwiederbringlich verloren. Unzuverlässige Erträge,
für den gewerblichen Anbau ungeeignete Wuchsformen, schlechte
Transport- und Lagerfähigkeit sowie die von Verbrauchern gewünschte,
aber nicht vorhandene Uniformität bei Äpfeln, Birnen und Co. machen
alte Sorten untauglich für den Einsatz im Erwerbsanbau – und damit
finden sie auch nicht ihren Weg in die Supermarktregale. „Das
Verbraucherverhalten spielt eine wichtige Rolle: Anstatt andere
Geschmäcker kennenzulernen, ist es vielen wichtiger, dass der Apfel
immer gleich aussieht, dieselbe Größe und denselben Geschmack hat
und er nicht die kleinste braune Stelle aufweist“, so Dr. Popp.
Neue Sorten haben die alten verdrängt
Was Verbraucher heute
in den Supermarktregalen finden, sind meist nur wenige
„Profi“-Sorten, die speziell für den großflächigen „industriellen“
Erwerbsanbau gezüchtet werden – und auf Zuchtziele wie einen
gleichmäßigen hohen Ertrag, gute Lagerfähigkeit und Robustheit in
der Handhabung getrimmt sind. Obwohl es weltweit geschätzt mehr als
20.000 Apfelsorten gibt und laut einer Umfrage unter den
Kreisfachberatungen für Gartenkultur und Landespflege über 600
Sorten vorkommen, werden in Deutschland höchstens 20 bis 30 in
wirtschaftlich bedeutenden Mengen erzeugt.
Die tatsächliche
Sortenvielfalt im Supermarkt lässt sich häufig an einer Hand
abzählen. „Wer alte Sorten probieren möchte, findet sie auf
Streuobstwiesen und dort, wo Kleinbauern sie zum Verkauf anbieten,
zum Beispiel in Hofläden oder auf regionalen Wochenmärkten“, weiß
Dr. Popp.
Warum alte Sorten wichtig sind
Alten Sorten
werden oft echte Wunderdinge nachgesagt – die jedoch nicht immer
stimmen: So ist beispielsweise die Behauptung, Äpfel alter Sorten
seien für Allergiker weitaus besser geeignet, ein weitverbreiteter
Irrglaube. „Tatsächlich zeigen aktuelle Untersuchungen, dass das
nicht stimmt. Es gibt sowohl alte als auch neue Sorten, die
besonders gut – oder schlecht – verträglich sind. Das Alter einer
Apfelsorte per se hat keinen Einfluss auf das allergene Potenzial
der Frucht. Dieses muss für jede Sorte individuell geprüft werden“,
klärt Dr. Popp auf.
Alte Sorten sind aber eine wichtige
Genressource: Ihr Genpool enthält einzigartige Eigenschaften, die
als Basis für neue Züchtungen dienen können, etwa für neue, an
bestimmte Klimabedingungen angepasste Sorten. Eine große Vielfalt an
alten Sorten könnte sich in Zukunft daher noch als sehr nützlich
erweisen. „Diese Biodiversität zu bewahren, ist eine wichtige
Aufgabe, die zusätzlich auch noch einen positiven Effekt auf die
Erhaltung von Streuobstwiesen und anderen schützenswerten
Kulturlandschaften hat“, so der Gartenbauexperte.
Alte Sorten
im Hobbygarten – eine gute Wahl?
Dank Saatguthändlern, die sich
auf alte Sorten spezialisiert haben, können Hobbygärtner aus einer
großen Vielfalt alter Sorten wählen. Dr. Popp empfiehlt, bei der
Anbauplanung eine Checkliste zu erstellen, auf der festgehalten ist,
welche Merkmale eine Sorte aufweisen muss, um Ansprüche an die
Standortfaktoren Klima und Boden sowie die Widerstandsfähigkeit
gegen Krankheiten und Schädlinge zu erfüllen.
„Je
besser die Pflanze zu den Standortgegebenheiten passt, desto weniger
eingreifende Kultur- und Pflegemaßnahmen sind nötig“, weiß der
Gartenbauexperte. „Für den Freizeitgärtner beginnt der
Pflanzenschutz mit der Sortenwahl.“
Viele alte Sorten sind
aber stark anfällig für Krankheiten wie Feuerbrand, Schorf und
Mehltau. Es besteht also ein erhöhtes Risiko von Ernteeinbußen und
sogar Totalausfällen. Auch die meisten Profi-Sorten haben im
Freizeitgarten übrigens nichts verloren: „Diese Züchtungen benötigen
meist einen intensiven chemischen Pflanzenschutz mit nur im
Erwerbsanbau, nicht aber im Haus- und Kleingarten zugelassenen
Pflanzenschutzmitteln“, erläutert Dr. Popp.
Er empfiehlt
Hobbygärtnern eine Mischung aus an die regionalen Bedingungen
angepassten alten Sorten und neuen Züchtungen: „Es geht nicht darum,
alte Sorten generell zu meiden oder Alt gegen Neu auszuspielen,
sondern bewährte traditionelle und regionale Sorten zu erhalten und
um neue, verbesserte Sorten zu ergänzen.
Neue Sorten werden
ja gerade deswegen gezüchtet, weil sie im Vergleich zu bisherigen,
‚alten‘ Sorten laut Bundessortenamt einen sogenannten
landeskulturellen Wert besitzen. Das heißt, sie lassen eine
deutliche Verbesserung für den Pflanzenbau und für die Verwertung
des Ernteguts erwarten – wobei die Verbesserung geprüft wird anhand
wertbestimmender Eigenschaften einer Sorte, wie Anbau-, Resistenz-,
Ertrags-, Qualitäts- und Verwendungseigenschaften.“
Neuer Wanderführer zeigt Routen entlang der Ruhr
Burgen und Industriekultur, Wälder, Berge und Wassererlebnisse
vereint der neue Freizeitführer "Wandern für die Seele. Ruhr", der
jetzt im Droste Verlag erschienen ist. Thomas Dörmann hat 20 Touren
entlang des Flusses von der Quelle bei Winterberg bis zur Mündung in
den Rhein bei Duisburg zusammengestellt.
Die
Rundwanderrouten zwischen sieben und 14 Kilometern haben
unterschiedliche Schwerpunkte: Die Auszeittouren versprechen
Naturerlebnisse, die Weitblicktouren gute Aussichten. Bei den
Genusstouren steht die Einkehr im Fokus. Auf den
Entschleunigungstouren bekommen Wandernde immer wieder Gelegenheit,
an besinnlichen Ruheorten zu verweilen, während die
Erfrischungstouren an Gewässern entlangführen.
Der
Serviceteil enthält Übersichtskarten und Streckenprofile, Tipps zur
An- und Abreise sowie Adressen für Pausen und Infos zu Sehenswertem
am Wegesrand. idr
Infos: www.droste-verlag.de
Kirche
kocht und lädt zum kostenfreien Mittagessen nach Untermeiderich
In der Evangelischen Gemeinde Meiderich heißt es einmal
im Monat „Kirche kocht“, denn im Begegnungscafé „Die Ecke“,
Horststr. 44a, stehen dann Ehrenamtliche an den Töpfen und zaubern
Leckeres; so zum Beispiel am 22. April, wenn sie um 12 Uhr Leberkäse
mit Stampfkartoffeln und Salat auftischen. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig, das Angebot ist kostenfrei. „
Wir wollen Wärme
spenden, schöne Momente schenken und gemeinsam Mittagessen!“ sagt
Yvonne de Temple-Hannappel, die Leiterin des Begegnungscafés (Tel.
0203 45 57 92 70, E-Mail: detemple-hannappel@gmx.de). Die Menüs für
die nächsten Termine stehen schon fest. Infos zur Gemeinde gibt es
im Netz unter
www.kirche-meiderich.de.

Engagierte
des Begegnungscafés „DIE ECKE“ Untermeiderich (Foto:
www.kirche-meiderich.de).
Spielenachmittag in
Obermarxloh für Jung und Alt
Zu einem Spielenachmittag
lädt die Evangelische Bonhoeffer Gemeinde Marxloh Obermarxloh in das
Kinder- und Familienzentrum Lutherkirche, Wittenberger Straße 15,
ein. Dort sind am Mittwoch, 23. April 2025 um 16 Uhr Karten-,
Brett-, Taktik-, Geschicklichkeits- und Familienspiele bereits
aufgebaut.
Der Eintritt ist frei. Diese Veranstaltung ist
Teil der „Wirkstatt“ im Rahmen des Erprobungsraumes der Gemeinde:
Hier können alle ihre Ideen einbringen, kreativ werden und
Gemeinschaft neu erleben. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.bonhoeffer-gemeinde.org.

1 % der Vollzeitbeschäftigten verdiente im Jahr 2024
mehr als 213 286 Euro brutto
• Mittlerer
Bruttojahresverdienst bei 52 159 Euro: Eine Hälfte der
Vollzeitbeschäftigten verdiente mehr, die andere weniger
•
Untere 10 % der Verdienstverteilung erzielten 32 526 Euro brutto
oder weniger
Der mittlere Bruttojahresverdienst,
gemessen am Median, lag 2024 in Deutschland einschließlich
Sonderzahlungen bei 52 159 Euro. Somit verdiente die Hälfte der
Beschäftigten mehr als oder genau diesen Betrag, während die andere
Hälfte weniger erhielt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
weiter mitteilt, erzielte das oberste Prozent der
Vollzeitbeschäftigten 2024 einen Bruttojahresverdienst von 213 286
Euro oder mehr und damit rund viermal so viel wie den
Medianverdienst. Die 10 % am unteren Ende der Verteilung erhielten
32 526 Euro brutto oder weniger.
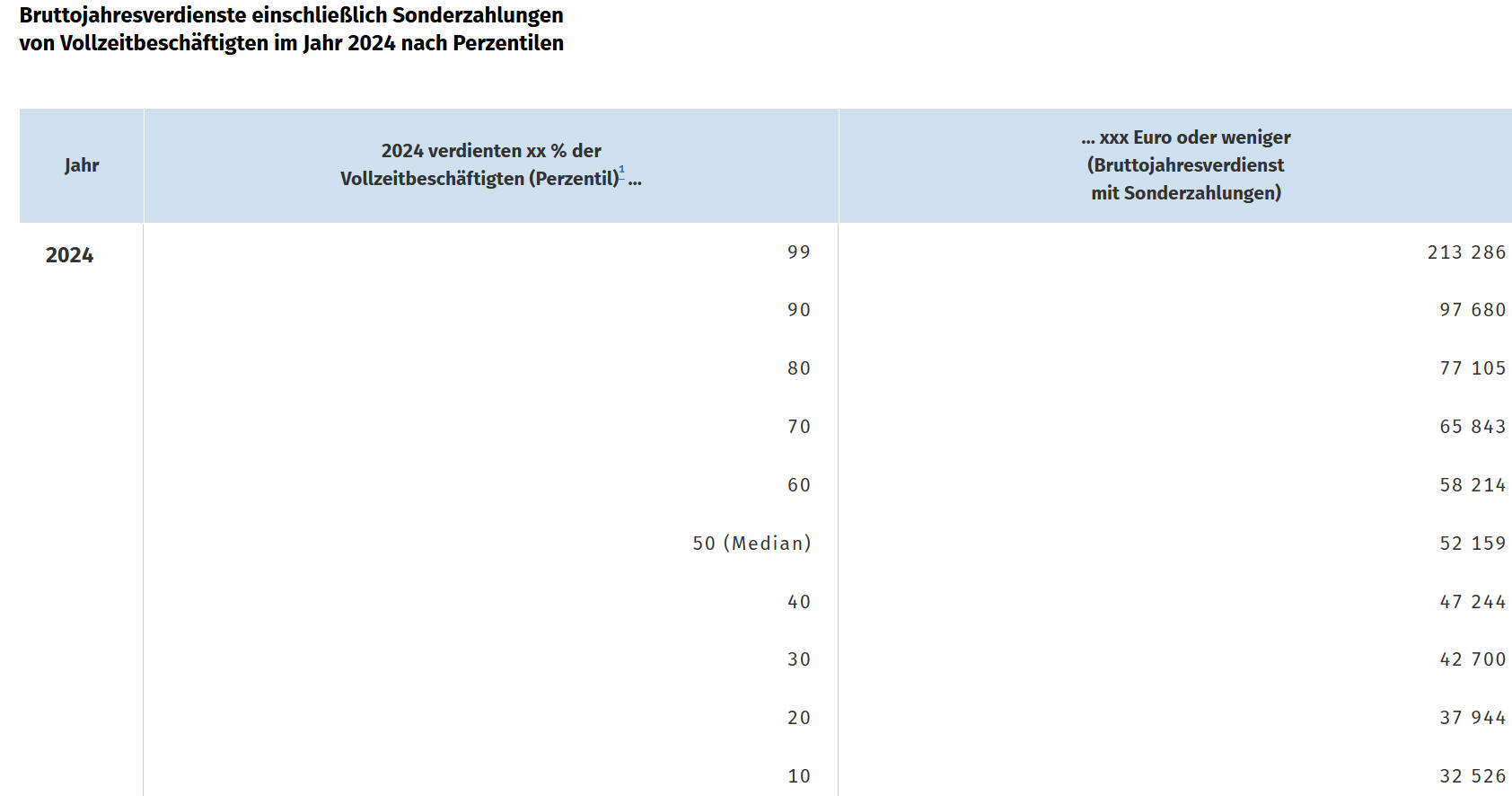
1,8 % weniger neue Ausbildungsverträge in der dualen
Berufsausbildung im Jahr 2024
• Rund 8 900 Neuverträge
weniger als im Jahr 2023 – leicht positiver Trend aus den Vorjahren
setzt sich nicht fort
• Frauen schließen weiterhin seltener
einen Ausbildungsvertrag in der dualen Berufsausbildung ab als
Männer
• Gesamtzahl der Auszubildenden im Vorjahresvergleich
fast unverändert
Die Zahl neuer Ausbildungsverträge in der
dualen Berufsausbildung ist im Jahr 2024 um 1,8 % oder rund 8 900
gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, setzte sich damit
der leicht positive Trend in der dualen Berufsausbildung seit dem
starken coronabedingten Rückgang im Jahr 2020 nicht fort (2023: +2,1
%; 2022: +0,8 %; 2021: +0,6 %, 2020: -9,3 %). Insgesamt schlossen im
Jahr 2024 rund 470 900 Auszubildende einen neuen Ausbildungsvertrag
ab.
Im langfristigen Trend Rückgang des
Frauenanteils bei neu begonnenen Ausbildungen Bei der
Geschlechterverteilung gab es im Vergleich zum Vorjahr keine
Veränderung: Auch im Jahr 2024 wurden 36 % (170 700) der neuen
Ausbildungsverträge von Frauen und 64 % (300 200) von Männern
abgeschlossen. Im längeren Zeitverlauf zeigt sich hingegen weiterhin
der Trend, dass sich Frauen aus der dualen Berufsausbildung
zurückziehen. S
o waren im Jahr 2014 noch 40 % der
Neuverträge von Frauen und 60 % von Männern abgeschlossen worden.
Gesamtzahl der Auszubildenden fast unverändert gegenüber dem Vorjahr
Die Gesamtzahl aller gemeldeten Auszubildenden über alle
Ausbildungsjahre hinweg blieb im Jahr 2024 beinahe unverändert
gegenüber dem Vorjahr (-0,2 %): Zum Jahresende befanden sich
deutschlandweit rund 1 213 800 Personen (2023: 1 216 600) in einer
dualen Ausbildung.
Davon waren anteilig weiterhin 35 %
Frauen und 65 % Männer. Zwischen den Ausbildungsbereichen zeichneten
sich auch im Jahr 2024 deutliche Größenunterschiede ab. Der Bereich
Industrie und Handel umfasste mit 688 500 die meisten
Auszubildenden. Zweitgrößter Ausbildungsbereich war das Handwerk mit
rund 337 800 Auszubildenden, gefolgt von den Freien Berufen
(111 000), dem Öffentlichen Dienst (41 500) und der Landwirtschaft
(31 700). Wesentlich geringer war die Zahl der Auszubildenden in der
Hauswirtschaft (3 300).