






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 28. Kalenderwoche:
12. Juli
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Montag, 14. Juli 2025
Beeinträchtigung auf der Linie 901
Die Duisburger
Verkehrsgesellschaft AG (DVG) arbeitet gemeinsam mit der Stadt
Duisburg an der Modernisierung der Infrastruktur für einen
zukunftsfähigen ÖPNV. In den vergangenen Jahren haben DVG und Stadt
bereits viel erreicht.
Die Modernisierung der
ÖPNV-Infrastruktur geht deshalb stetig weiter. Deshalb finden von
Montag, 14. Juli, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Dienstag,
22. Juli, Betriebsende, Arbeiten an den Weichen auf der Rampe
Rathaus sowie am Abzweig Zoo/Uni statt.
Zudem finden
Brückensanierungsarbeiten auf der Mülheimer Straße zwischen den
Haltestellen „Zoo/Uni“ und „Monning“ statt. Dies hat zur Folge, dass
auf dem Streckenabschnitt zwischen „Landesarchiv NRW“ und „Mülheim
Bf.“ in beiden Richtungen Busse statt Bahnen fahren.
Treffen mit Trump
NATO-Generalsekretär Mark Rutte traf am 14.
Juli 2025 US-Präsident Donald Trump im
Weißen Haus, um wichtige Bemühungen zur
Unterstützung der ukrainischen Verteidigung
gegen die russische Aggression
voranzutreiben. In einer Pressekonferenz im
Oval Office begrüßte Rutte Präsident Trumps
wichtige Entscheidung, der Ukraine wichtige
militärische Ressourcen zu sichern.

Die NATO koordiniert diese Bemühungen mit
Mitteln der Verbündeten in Europa und
Kanada. Herr Rutte betonte die Dynamik des
jüngsten NATO-Gipfels in Den Haag, auf dem
sich die Bündnispartner auf ein
Verteidigungsausgabenziel von 5 % des BIP,
eine erhöhte Rüstungsproduktion sowie die
fortgesetzte Unterstützung der Ukraine
einigten. Er betonte, wie diese Bemühungen
alle drei Aspekte nur wenige Wochen nach den
historischen Entscheidungen zusammenbringen.
Die NATO arbeitet nun an
umfangreichen militärischen
Ausrüstungspaketen, darunter
Flugabwehrsysteme, Raketen und Munition.
Statt eines einzelnen, begrenzten Pakets
setzt die gestrige Ankündigung neue Impulse,
die sich auf schnelle, umfangreiche
Ausrüstungslieferungen an die Ukraine
konzentrieren. „Europa tritt hier an“,
erklärte er und verwies auf Zusagen
Deutschlands, Finnlands, Dänemarks,
Schwedens, Norwegens, des Vereinigten
Königreichs, der Niederlande und Kanadas.
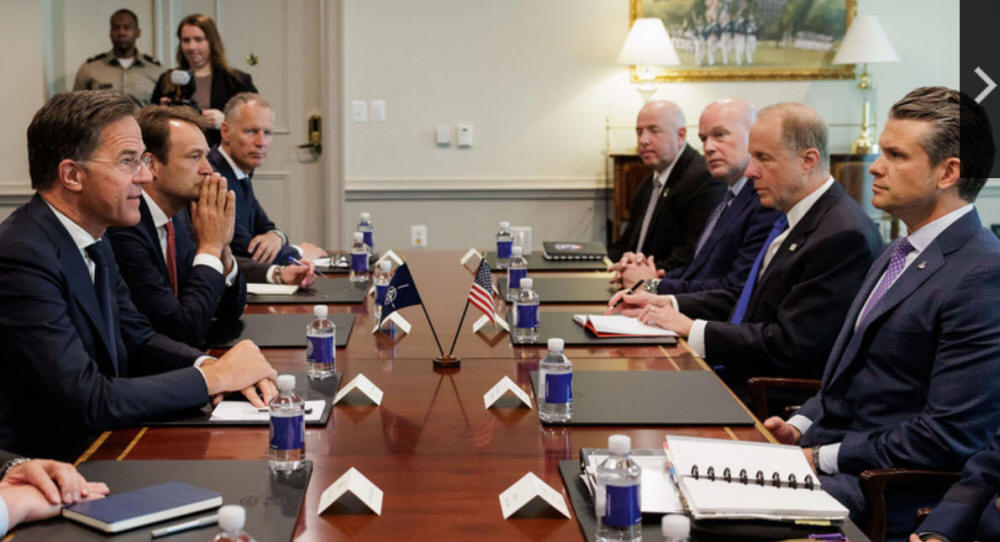
Weitere Zusagen werden erwartet. Während
seines Aufenthalts in Washington traf sich
der Generalsekretär auch mit
Verteidigungsminister Pete Hegseth,
Außenminister Marco Rubio und Mitgliedern
des Kongresses.
Ferienjobs: Diese Regeln sollten
Jugendliche, Eltern und Arbeitgeber beachten
Minister Laumann: Ein Ferienjob
kann einen guten ersten Einblick in die
Berufswelt bieten.

Foto: pexels.com Arbeit, Gesundheit und
Soziales
Die Sommerferien stehen vor
der Tür. Neben Reisen, Freibadbesuchen oder
anderen Ausflügen stehen bei Jugendlichen
auch Ferienjobs hoch im Kurs. Damit es dabei
fair und sicher zugeht, sind einige Regeln
zu beachten.
„Viele Unternehmen
suchen dringend nach Nachwuchs und da kann
ein Ferienjob ein guter Einstieg in ein
späteres Ausbildungsverhältnis sein”, sagt
Arbeitsminister Karl-Josef Laumann. „Daher
freut es mich, wenn Jugendliche in den
Ferien erste Berufserfahrungen sammeln und
ihr Taschengeld aufbessern wollen. Damit es
dabei gerecht zu geht, ist es wichtig, dass
die Regeln des Jugendarbeitsschutzes
eingehalten werden.”
Grundsätzlich
ist die Beschäftigung von Kindern verboten.
Es gibt aber Ausnahmen für Schülerinnen und
Schüler über 13 Jahren, wenn ihre Eltern
zustimmen und die Beschäftigung leicht und
für Kinder geeignet ist. Das gilt
beispielsweise für das Austragen von
Zeitungen, Babysitten, Gartenarbeiten oder
für das Unterrichten von Nachhilfe –
allerdings nur bis zu zwei Stunden täglich.
Jugendliche über 15 Jahre, die noch
nicht volljährig sind, dürfen einen
Ferienjob ausüben, es gelten jedoch
Einschränkungen: So dürfen Schülerinnen und
Schüler an maximal vier Wochen im Jahr in
der Ferienzeit jobben.
Die tägliche
Arbeitszeit darf nicht mehr als acht Stunden
und die wöchentliche nicht mehr als 40
Stunden überschreiten. Nachts zwischen 20.00
und 6.00 Uhr sowie an Samstagen und Sonn-
und Feiertagen ist die Arbeit für
Jugendliche nicht erlaubt.
Es gibt
auch Ausnahmen in bestimmten Branchen: Etwa
in der Gastronomie, in der Landwirtschaft
sowie bei Tätigkeiten im Gesundheitsdienst
und im Bäckereihandwerk. So dürfen
Jugendliche in der Gaststätte, im
Krankenhaus oder Altenheim auch an Samstagen
oder Sonn- und Feiertagen beschäftigt
werden. In der Gastronomie dürfen
jugendliche Ferienjobber über 16 Jahre auch
bis 22.00 Uhr arbeiten.
Grundsätzlich gilt: Pausen schützen vor
Übermüdung, Leistungsabfall und
gesundheitlichen Risiken. Sie sind wichtig
und müssen eingehalten werden. Unter
18-Jährige haben bei viereinhalb bis sechs
Stunden Arbeit am Tag Anspruch auf
mindestens 30 Minuten Pause; bei mehr als
sechs Stunden besteht Anspruch auf 60
Minuten.
Jugendlichen dürfen nur
Arbeiten durchführen, die sie körperlich
nicht überfordern und die keine
gesundheitlichen Gefahren mit sich bringen.
Fließband- und Akkordarbeiten sind daher
verboten. Arbeitgeber müssen die
Jugendlichen vor der Arbeitsaufnahme auf
mögliche Unfall- und Gesundheitsgefahren
hinweisen.
Verstöße gegen das
Jugendarbeitsschutzgesetz sind eine
Ordnungswidrigkeit und können in schweren
Fällen sogar als Straftat verfolgt werden.
Abschließend sind folgende Punkte noch
wichtig: Jugendliche sind bei Ferienjobs
über den Arbeitgeber unfallversichert.
Beiträge zu den Sozialversicherungen,
wie der Krankenversicherung, fallen nicht
an. Ansprechpartner für Fragen zum
Jugendarbeitsschutzgesetz sind in
Nordrhein-Westfalen die Bezirksregierungen.
Nähere Informationen zum Jugendarbeitsschutz
unter: https://www.arbeitsschutz.nrw.de/
Schlösser Ludwigs II. von
Bayern zum Welterbe erklärt
Prunkvolle
Rückzugsorte spiegeln Fantasiewelten des
Märchenkönigs wider
Die
Schlösser König Ludwigs II. von Bayern
werden in die Welterbeliste aufgenommen. Das
beschloss das UNESCO-Welterbekomitee soeben
auf seiner aktuellen Tagung in Paris.
Neuschwanstein, Linderhof, das Königshaus am
Schachen und Herrenchiemsee spiegeln die
Fantasiewelten des bayerischen Königs wider,
der die prunkvollen Rückzugsorte in der
zweiten Hälfte 19. Jahrhundert zu seinem
persönlichen Genuss errichten ließ. Das
Ensemble ist die 55. Welterbestätte in
Deutschland.
Die Staatsministerin im
Auswärtigen Amt Serap Güler unterstreicht:
„UNESCO-Welterbe schützt als bedeutendstes
internationales Instrument natürliches und
kulturelles Erbe weltweit und stärkt
internationale Zusammenarbeit. Ich freue
mich daher sehr über die Aufnahme der
weltweit bekannten Schlösser König Ludwigs
II. von Bayern. Der hohe Standard an
denkmalpflegerischer Praxis vor Ort kann
einen wichtigen Beitrag für den zukünftigen
Austausch innerhalb der internationalen
Welterbe-Gemeinschaft zum Schutz und der
Erhaltung von Welterbestätten leisten.“
Die Präsidentin der Deutschen
UNESCO-Kommission Maria Böhmer macht
deutlich: „Die Aufnahme der Schlösser in die
Welterbeliste ist eine herausragende
Würdigung dieser eindrucksvollen Orte. Sie
sind allesamt architektonische Meisterwerke
und zeugen von der künstlerischen
Vorstellungskraft, aber auch der Exzentrik
des Märchenkönigs. Neuschwanstein,
Linderhof, das Königshaus am Schachen und
Herrenchiemsee sind den Traumwelten Ludwigs
II. entsprungen. Heute zählen sie zum Erbe
der gesamten Menschheit. Mein herzlicher
Dank gilt allen, die sich mit großer Hingabe
für diesen Erfolg eingesetzt haben!“


Maria Böhmer und Vizepräsident Prof.
Dr Christoph Wulf © Deutsche
Unesco-Komission Danetzki
Neuschwanstein wurde als
erstes der vier Schlösser erbaut und gilt
mit seinen romantischen Türmen und seiner
exponierten Lage vor dramatischer
Bergkulisse als Inbegriff des
Märchenschlosses. Innen dominieren Motive
aus Wagner-Opern: Tannhäuser, Lohengrin,
Tristan und Isolde, Parsifal – der
Opernstoff findet sich in Wandmalereien und
Holzarbeiten wieder, in Porzellanfiguren und
Stickereien. Wohn- und Arbeitszimmer ließ
der König durch eine künstliche Grotte
verbinden.
Auch in Linderhof verband
Ludwig Rückzugssehnsucht mit technischen
Finessen. Die Venusgrotte mit farbig
beleuchtetem Wasserfall, Regenbogeneffekt
und elektrischem Licht war ihrer Zeit weit
voraus. Ihren Strom bezogen die Lampen aus
einem etwa 100 Meter entfernt gelegenen
Kraftwerk, wo eine Dampfmaschine Dienst tat.
Das Königshaus am Schachen bringt
orientalisches Flair in die Alpen: In über
1.800 Metern Höhe ließ Ludwig einen
„Türkischen Saal“ einrichten, in dem er sich
feiern ließ. Auch der Maurische Kiosk und
das Marokkanische Haus auf dem Linderhofer
Gelände zeugen von seiner Begeisterung für
die Orientmode des 19. Jahrhunderts.
Herrenchiemsee schließlich ist Ludwigs
Idealbild von Versailles – monumental,
fantasievoll, aber unvollendet.
Es
war dieser Bau, der zum finanziellen Ruin
des Königs führen, mit seiner Entmündigung
und dem frühen Tod des erst 40-Jährigen
enden sollte. Nur Wochen nach dem Ableben
des Herrschers im Jahr 1886 wurden die
Anlagen der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht und faszinieren seitdem Menschen aus
aller Welt.
Das
UNESCO-Welterbekomitee tagt vom 6. bis 16.
Juli am Sitz der Weltkulturorganisation in
Paris. Es setzt sich aus 21 gewählten
Vertragsstaaten der Welterbekonvention
zusammen. Das Gremium entscheidet über die
Einschreibung neuer Kultur- und Naturstätten
in die Welterbeliste und befasst sich mit
dem Erhaltungszustand eingeschriebener
Stätten. Auf der Liste des UNESCO-Welterbes
stehen derzeit mehr als 1.200 Kultur- und
Naturstätten. 53 davon gelten als bedroht.
Deutschland verzeichnet 55 Welterbestätten.


Thronsaal Neuschwanstein


Schlafzimmer im Schloss Neuschwanstein
Entscheidung gefallen:
Startup-Schmiede erhält Millionenförderung
für Deep-Tech-Innovationen im Ruhrgebiet
Die Bryck Startup Alliance
erhält eine mehrjährige Millionenförderung
zur Etablierung eines europäischen
Deep-Tech-Hotspots im Ruhrgebiet. In den
kommenden fünf Jahren entsteht ein
leistungsfähiges, hochschul- und
industrienahes Gründungszentrum mit
internationaler Strahlkraft, das
Deep-Tech-Innovationen in Deutschland
hervorbringen soll. Geplant sind
verschiedene Programme für
Unternehmensgründungen.
Startups
bekommen zudem Zugang zu Wachstumskapital
für Ausgründungen. Ziel ist es, bis 2030
mindestens 1.000 Ausgründungen, über 200
skalierende Deep-Tech-Startups und über eine
Milliarde Euro Risikokapital im Ökosystem zu
mobilisieren. Sitz des Zentrums wird das
historische, denkmalgeschützte Colosseum,
eine ehemalige Industriehalle in Essen.
Mit der Universitätsallianz Ruhr sind
drei forschungsstarke Universitäten
(Ruhr-Universität Bochum, TU Dortmund,
Universität Duisburg-Essen) zentrale Partner
im Verbund. Auf industrieller Seite
engagiert sich das Wirtschaftsbündnis
Initiativkreis Ruhr aus über 70 führenden
regionalen Unternehmen und Institutionen.
Die RAG-Stiftung bringt sich mit dem von ihr
initiierten Innovations- und
Gründungszentrum Bryck, ihrem Netzwerk und
privatwirtschaftlichem Kapital in die
Allianz ein. idr
„Im Land der Buntgemischten“ – Schreibcamp in der
Zentralbibliothek
Die Zentralbibliothek auf der
Steinschen Gasse 26 lädt Jugendliche von 10 bis 14 Jahren auch in
diesem Jahr zum traditionellen fünftägigen SommerSchreibcamp ein.
Von Montag bis Freitag, 14. bis 18. Juli, entwickeln die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer täglich von 10 bis 13 Uhr gemeinsam
mit der Journalistin Monika Hanewinkel Ideen und Texte. Dabei geht
es auch darum, warum anders zu sein als die anderen manchmal
schwierig ist, auch wenn es eigentlich ganz normal sein sollte.
Denn jeder Mensch ist auf seine Weise einzigartig, das macht die
Welt erst bunt und vielfältig. Aber wie können all die
„Blaukarierten“, die „Gelbgetupften“ und „Grüngestreiften“ friedlich
miteinander leben?
Was kann man Vorurteilen, Hass und Gewalt
entgegensetzen?
Welche Möglichkeiten und Chancen gibt es in
einer Demokratie?
In diesem Workshop wird in die Zukunft
gedacht. Gemeinsam entstehen neue Visionen für ein Land der
„Buntgemischten“. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Für
das von Schreibland NRW geförderte Camp sind keine Vorkenntnisse
erforderlich. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Anmeldungen sind ab
sofort im Internet auf www.stadtbibliothek-duisburg.de möglich.
Freie Plätze bei
Kreativ-Workshops der Zentralbibliothek
Die Zentralbibliothek an der
Steinschen Gasse 26 in der Duisburger
Innenstadt lädt Jugendliche von 10 bis 14
Jahren in den Sommerferien wieder zu
verschiedensten Workshops ein. Am Montag,
14. Juli, beginnt eine fünftägige
Schreibwerkstatt mit dem Thema „Im Land der
Buntgemischten“.
Die Jugendlichen
beschäftigen sich täglich von 10 bis 13 Uhr
kreativ mit der Frage, wie ein Zusammenleben
in einer vielfältigen Gesellschaft gut
gelingen kann. Am Samstag, 19. Juli, kann
man zwischen 10 und 15 Uhr erfahren, wie
packende Duelle für Bühne oder Film
entstehen. Neben der Kunst des Schwertkampfs
wird auch erklärt, wie man solche Szenen mit
dem Handy aufnehmen kann. Wer lieber
zeichnet, ist bei den viertägigen
Portrait-Zeichenworkshops richtig.
Der Anfängerkurs beginnt am Dienstag, 22.
Juli, um 14.30 Uhr. Daran anschließend
beginnt ein Fortgeschrittenenkurs am
Dienstag, 29. Juli. Auch den beliebten
Manga-Workshop gibt es wieder. Er beginnt am
Montag, 18. August, und findet bis zum
darauffolgenden Freitag täglich von 11.30
bis 14 Uhr statt. Weitere Informationen und
die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es online
auf www.stadtbibliothek-duisburg.de (unter
„Veranstaltungen“).
Vor 10 Jahren in der BZ:
Hochmoderne Zentralbibliothek im Stadtfenster eröffnet
Duisburg, 14. Juli 2015 - Von Manfred
Schneider
Unter großem Andrang Duisburger
Leserinnen und Leser, wurde heute die neue
Stadtbibliothek im Stadtfenster, von OB
Sören Link, dem Direktor der Stadtbibliothek
Dr. Jan-Pieter Barbian und Kulturdezernent
Thomas Krützberg eröffnet.
Eingangstor zur Stadtbibliothek im Stadtfenster
Die
hochmoderne Zentralbibliothek auf der Steinschen Gasse in
der Stadtmitte hat zur Zeit einen Bestand von insgesamt
320.000 Medien. Weiterhin befindet sich in dem Haus eine
Sammlung unter dem Titel „Historische und Schöne Bücher“,
mit 3.500 Büchern aus dem 14. bis frühen 20. Jahrhundert.
Über drei Etagen verteilt, bietet das Haus eine
Publikumsfläche zur Medienpräsentation von 3.800
Quadratmetern.
Weite und übersichtliche Anordnung der Bücherregale
Mit gültigen Ausweis können sich hier die
Bibliothekskundinnen- und Kunden aus drei Medienschränken
Notebooks oder mobile DVD-Player zur Nutzung innerhalb der
Stadtbibliothek ausleihen.
Modernes Ausleihsystem
Im Foyer gibt es ein
„Intelligentes Vormerkregal“ zur Abholung vorgemerkter
Medien sowie zwei Rückgabestationen für die
ausgeliehenen Artikel. Zahlreiche Einzelarbeitsplätze, vier
„Arbeitskabinen“ als Gruppenarbeitsplätze für bis zu acht
Personen, ergänzen das Angebot der Stadtbibliothek. Die
Foyers im Erdgeschoss sowie im 1. Obergeschoss werden von
Stadtbibliothek und Volkshochschule (VHS) gemeinsam genutzt.
Oberbürgermeister Sören Link Link
ließ es sich nicht nehmen, auch im Namen von Thomas
Krützberg und Dr. Jan-Pieter Barbian mit seinem Team, der
ersten Besucherin der neuen Stadtbibliothek, Maria Linke,
einen Blumenstrauß zu überreichen.
Thomas Krützberg, Dr. Jan-Pieter Barbian und OB Sören
Link (v. li.) im großzügigen Kinder- und Jugendbereich
Oliver Hallscheidt erklärt OB Link das moderne Ausleihsystem
Wohlfühlen können sich die jungen Leser im Kinder- und
Jugendbereich
Bibliothekmitarbeiterin Elke Strunk-Stinn weist einen Kunden
in das System ein
Wertvolle Lebensräume für
Insekten über viele Jahre schaffen
Tipps für die Aussaat von Wildblumen im
eigenen Garten
Wildblumenwiesen bieten
Bienen und anderen Insekten wertvollen
Lebensraum. Quelle: James Michael Saxon
Young

Dass Insektenschutz wichtig für uns Menschen
und das gesamte Ökosystem ist, hat sich
längst herumgesprochen. Nur: Wie lassen sich
neue, artenreiche Wildblumen-Oasen anlegen –
und dann auch noch nachhaltig zum Blühen
bringen? Der Biologe Tom Strobl, der sich
auf den Schutz von Wildbienen spezialisiert
hat, erläutert, wie nahezu jeder mit
geringem Aufwand ökologische Vielfalt säen
kann.
Die gute Nachricht ist: Es
braucht gar nicht viel, um mit einer eigenen
Blühfläche aktiv etwas für Wildbienen und
andere Insekten zu tun. „Am besten geeignet
sind eine Ecke im Garten oder ein großer
Topf auf dem Balkon, eine hochwertige
Wildblumen-Saatmischung und Geduld”, erklärt
der Wildbienen-Experte Tom Strobl. Denn die
Samen brauchen Zeit, um anzukommen.
„Im ersten Jahr nach der Aussaat wächst an
der Stelle eigentlich nur Beikraut wie
Löwenzahn, das kurzgehalten werden sollte“,
empfiehlt Strobl. Bis zum Herbst zeigten
sich am Boden dann erste Blätter und
Rosetten der aufgehenden Wildblumen. „Aus
ihnen werden im darauffolgenden Frühjahr die
ersten Blumen.” Das gelte übrigens für alle
mehrjährigen Wildblumen, so Strobl.
Das Warten lohnt sich – auch für Bienen
Dafür haben „Wildblumengärtner“ aber auch
länger etwas davon, und nicht nur sie: Sind
die Kräuter und Blumen einmal am Standort
angekommen – am besten in einer stabilen
Pflanzengesellschaft mit anderen Arten –,
dann blühen sie meist gleich mehrere Jahre
lang. Das sei nicht nur optisch eine
Bereicherung, betont Tom Strobl: Wildbienen
und andere Insekten bohren etwa Löcher in
abgestorbene, markhaltige Stängel, um dort
ihre Eier abzulegen, wo sie überwintern.
Vier Tipps für Einsteiger:
- Gute
Mischung wählen: Start mit hochwertigen
Mischungen (regional, genetisch vielfältig,
ursprünglich, mit Früh-, Mittel- und
Spätblühern).
- Mehrjährigkeit
bevorzugen: Viele Arten wie Witwenblume,
Margerite & Co. blühen zuverlässig jedes
Jahr.
- Auch „wild“ braucht Pflege: Boden
für Aussaat vorbereiten, regelmäßig
Säuberungsschnitte durchführen und Beikraut
entfernen, um Platz für langsamer wachsende
Pflanzen zu schaffen.
- Geduld
mitbringen: Wildblumen sind langsam – aber
treu. Wer sie einmal etabliert, hat viele
Jahre Freude (und summende Gäste).
Der Biologe forscht dazu seit Jahren: Er ist
Mitbegründer von Wildbiene + Partner, einem
Start-up, das mit Unterstützung von Experten
und einer inzwischen internationalen
Community die Anlage neuer Lebensräume sowie
die Verbreitung von Wildbienen-Nisthilfen
vorantreibt und sogar ein wissenschaftliches
Pflanzen-Monitoring betreibt.
Im
Rahmen ihrer 2022 ins Leben gerufenen
Beegnetten-Initiative, bei der jedermann
einen Beitrag zum Schutz und zur Förderung
der Biodiversität leisten kann, konnten
Strobl und seine Mitstreiter bereits über
14.000 m2 wertvolle Blühflächen für
Wildbienen und andere Insekten schaffen:
„Wir erfassen, was dort wächst und blüht,
welche Pflanzen besonders produktive
Gemeinschaften bilden.“ Dabei beobachten
Strobl und seine Mitstreiter auch deren
Effekte auf Wildbienen: Welche Arten siedeln
sich in der Nähe welcher Wildpflanzen an?
„Das Monitoring hilft uns, jede Fläche
wissenschaftlich fundiert weiterzuentwickeln
– damit echte Wirkung für die Artenvielfalt
entstehen kann.“
Saatgut ist nicht
gleich Saatgut
Wie aber kommen Klein- und
Hobbygärtner, Balkonbesitzer und
Wildblumenfreunde nun an ihr Saatgut, um
selbst eine Oase für Wildbienen anzulegen?
„Es gibt inzwischen gute Mischungen mit bis
zu 30 verschiedenen Pflanzenarten in einem
Tütchen. Wer diese auf zwei bis drei
Quadratmetern aussät, erhält mit der Zeit
eine richtig bunte Blühfläche“, so Strobl
von Wildbiene + Partner. Er empfiehlt
allerdings, bei der Wahl der Mischung Wert
auf Qualität zu legen: Eine
Wiesenblumen-Mischung aus dem Supermarkt
macht noch lange keine ökologisch wertvolle
Wildblumenwiese.
Die Mischung
macht’s!
Strobl achtet bei der Auswahl
von Saaten für die Anlage neuer Blühflächen
darauf, dass sie regional gewonnen und daher
an den Standort angepasst, genetisch
vielfältig und ursprünglich sind sowie
zeitlich versetzt zur Blüte kommen – also
Früh-, Mittel- und Spätblüher enthalten. Die
sorgfältige Auswahl und ein bisschen Pflege
zahlen sich für Insekten und Betrachter aus:
Durch eine bunte Blütenpracht, die von
Frühjahr bis Herbst Nahrung für Insekten
bietet. „Schon eine einzige Blume kann für
viele verschiedene Insekten wertvoll sein“,
betont Strobl.
Weitere Informationen
finden Sie unter
https://wildbieneundpartner.de/.
ACV informiert über Vorschriften und
gibt Tipps für den Transport von Haustieren

Ein passendes Sicherungssystem für Haustiere
ist entscheidend für die Sicherheit von Tier
und Mensch im Auto / Bildrechte: Andrey
Popov (GettyImages)
In der Ferien-
und Reisezeit sind viele Menschen gemeinsam
mit ihrem Haustier unterwegs – sei es ein
Bernhardiner, ein Dackel oder eine
Hauskatze. Wer Tiere im Auto mitnimmt, trägt
jedoch eine besondere Verantwortung für ihre
Sicherheit und die der Mitfahrenden. Denn
schon bei einem Aufprall mit 50 km/h
vervielfacht sich das Gewicht des Tieres
durch die entstehenden Kräfte. Damit die
Fahrt entspannt und sicher verläuft,
informiert der ACV Automobil-Club Verkehr
über Vorschriften, geeignete
Sicherungssysteme und nützliche Tipps für
den Transport von Haustieren im Auto.
Was gibt die StVO für im Auto
mitreisende Tiere vor?
Nach der
Straßenverkehrsordnung (StVO) gelten Tiere
im Fahrzeug als Ladung. §22 Abs. 1 StVO
verpflichtet, Ladung so zu sichern, dass sie
selbst bei Vollbremsung oder plötzlichem
Ausweichen weder verrutschen noch
herabfallen darf. Darüber hinaus bestimmt
§ 23 StVO, dass der Fahrzeugführer dafür
sorgen muss, dass das Tier ihn nicht in der
sicheren Fahrzeugführung beeinträchtigt.
Ein Tier, das frei im Auto umherläuft,
stellt eine erhebliche Ablenkungsgefahr dar.
Verstöße gegen diese Vorschriften können,
abhängig von der Gefährdung anderer
Verkehrsteilnehmer und den Folgen, mit
Bußgeldern von bis zu 80 Euro und einem
Punkt in Flensburg geahndet werden.
Zudem kann die Kaskoversicherung bei einer
unzureichenden Sicherung die
Schadenregulierung ablehnen. Auch
zivilrechtlich haftet der Halter für
Schäden, die durch ein ungesichertes Tier
verursacht werden – etwa, wenn es nach einem
Unfall entkommt und weitere Unfälle auslöst.
Welche Sicherungsmöglichkeiten gibt es?
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfnormen für
Sicherungssysteme bestehen bislang nicht.
Der ACV empfiehlt jedoch, Produkte
auszuwählen, die über Crashtest-Ergebnisse,
DIN-Prüfungen (DIN75410-2) oder Prüfsiegel
wie „GS – Geprüfte Sicherheit“ verfügen.
Der Beifahrersitz ist für den Transport
von Tieren grundsätzlich ungeeignet. Falls
eine Box ausnahmsweise dort platziert werden
muss, sollte unbedingt der Airbag
deaktiviert werden, da er bei einer
Auslösung lebensgefährlich für das Tier sein
kann. Rückbank, Fußraum oder Kofferraum
stellen die geeigneten Bereiche dar.
Wie können Hunde gesichert werden?
Für
Hunde bietet der Handel spezielle Geschirre
und Gurtsysteme, die am Anschnallgurt oder
an Isofix-Haken befestigt werden. Sie
sollten beim Transport eingesetzt werden,
wenn keine geeignete Box zur Verfügung
steht. Entscheidend ist, ob das System für
große oder kleine Hunde ausgelegt ist und
zur Statur passt. Der Gurt muss möglichst
straff sitzen, um ein Umherfliegen bei einem
Unfall zu verhindern.
Für größere
Hunde sind Gurtsysteme nur bedingt geeignet,
da viele Produkte in Tests eine zu geringe
Haltekraft zeigen. Eine Transportbox bietet
hier meist ein höheres Sicherheitsniveau.
Sie sollte quer zur Fahrtrichtung im
Kofferraum direkt hinter der Rückbank
aufgestellt werden, damit die Aufprallkräfte
optimal verteilt werden. Der ACV rät, sie
vor dem Kauf im eigenen Fahrzeug
auszuprobieren und bei Bedarf mit Gurten zu
sichern.
Für kleine Hunde sind
erhöhte Autositze erhältlich, in denen der
Hund weich liegt und mit dem Geschirr
gesichert wird. Schondecken schützen Polster
vor Schmutz, ersetzen jedoch keine
Sicherung. Gleiches gilt für
Rücksitzbarrieren: Sie verhindern das
Vorrutschen, bieten aber keinen
ausreichenden Schutz bei einem Aufprall.
Ein Trennnetz oder -gitter im Kofferraum
stellt die einfachste Lösung dar. Bei
schweren Tieren oder älteren Fahrzeugen
sollte die Barriere durchgehend vom
Laderaumboden bis zum Dach montiert werden.
Zusätzlich empfiehlt es sich dringend, den
Hund mit einem Geschirr zu sichern, um ein
Herumgeschleudertwerden zu verhindern.
Wie können Katzen gesichert werden?
Katzen sollten grundsätzlich in einer
Transportbox befördert werden. Eine stabile
Kunststoffbox ist geflochtenen Körben
aufgrund der höheren Crashsicherheit
vorzuziehen und sollte angeschnallt werden,
um ein Umherfliegen bei einem Unfall zu
verhindern.
Alternativ kann eine
formstabile Softtasche verwendet werden, die
ebenfalls sicher zu fixieren ist.
Transportbehälter mit Öffnungen oben und an
der Seite erleichtern das Einsetzen des
Tieres und ermöglichen eine bessere
Orientierung.
Wie lässt sich die
Fahrt für Haustiere angenehm gestalten?
Eine Gewöhnung an den Transport im Auto
sollte möglichst vor der ersten Reise
erfolgen. Besonders Katzen lassen sich
ungern einsperren. Ein Kleidungsstück,
Handtuch oder eine Decke in der Box
erleichtert das Wohlfühlen, da es vertraut
riecht und Flüssigkeit aufsaugt, falls ein
Malheur passiert. Reicht der vertraute Duft
nicht aus, kann der Korb oder die Box mit
einem Tuch abgedeckt werden. Dunkelheit
wirkt beruhigend, dennoch muss eine
ausreichende Luftzufuhr gewährleistet
bleiben.
Besonders im Sommer ist es
lebensgefährlich, Tiere im Auto
zurückzulassen: Schon nach wenigen Minuten
können im Fahrzeuginneren Temperaturen von
über 50 Grad Celsius entstehen. Dies
verstößt gegen das Tierschutzgesetz und kann
für das Tier tödlich enden. Eine gute
Belüftung ist daher unerlässlich – auch wenn
das Fahrzeug nur kurz verlassen wird.
Grundsätzlich sollten Tiere niemals
unbeaufsichtigt im Auto zurückbleiben.
Bei längeren Fahrten sind regelmäßige
Pausen einzuplanen. Futter, Wasser und
Bewegung sollten angeboten und Unterlagen
bei Bedarf gewechselt werden. Beim
Aussteigen sollten Tiere stets angeleint
oder gesichert sein, um ein plötzliches
Entlaufen zu verhindern. Transportbehälter
stets vorsichtig öffnen, um ein Entweichen
zu verhindern.
Worauf muss bei Reisen
ins Ausland geachtet werden?
Vor Reisen
ins Ausland sind die Einreisebestimmungen
sowie mögliche zusätzliche Impfungen zu
prüfen. In vielen Ländern gelten
Vorschriften zur Leinen- und Maulkorbpflicht
oder Listen verbotener Hunderassen. Oft ist
zudem eine Kennzeichnung per Mikrochip und
bei Reisen innerhalb der EU ein
EU-Heimtierausweis erforderlich. Eine
Übersicht bietet das EU-Portal:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/pets-and-other-animals/index_de.htm.
Falls sich ein Tier nicht an das
Autofahren gewöhnt, sollte vor längeren
Fahrten unbedingt tierärztlicher Rat
eingeholt werden. Beruhigungsmittel können
in Ausnahmefällen hilfreich sein, wirken
jedoch oft stark dämpfend auf Kreislauf und
Wahrnehmung. Sie sollten daher nur nach
sorgfältiger tierärztlicher Abwägung
eingesetzt werden.
Gemeinde
lädt zum Marktcafé in Meiderich
Zu Kaffee und lecker Frühstück mit
Geselligkeit und Freundlichkeit lädt die
Evangelische Kirchengemeinde Meiderich jeden
zweiten Samstag zu den Marktzeiten in das
Gemeindezentrum, Auf dem Damm 8, ein. Den
nächsten Termin zum Schlemmen und Klönen
gibt es am 19. Juli 2025.
Geöffnet ist das Marktcafé der
Gemeinde ab 9.30 Uhr und somit zu der Zeit, in der manche
ihr Einkäufe am Meidericher Wochenmarkt machen. Nach
kurzem Fußweg lässt sich im Gemeindezentrum bei Kaffee,
Brot, Brötchen, Wurst- und Käseaufschnitt und Marmeladen
der Einkaufsstress vergessen.
Das Angebot
bereiten Ehrenamtliche zu, das Frühstück gibt´s zum
Selbstkostenpreis. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz
unter www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter
0203-4519622.

NRW-Kommunen:
Hundesteueraufkommen steigt 2024 auf
130 Millionen Euro
*
Einzahlungen waren um 2 % höher als im
Vorjahr.
* Rein rechnerisch flossen
7,16 Euro an Hundesteuer je Einwohner/-in in
die kommunalen Kassen.
* Unter den
kreisfreien Städten hatten Remscheid,
Solingen und Mülheim an der Ruhr die
höchsten Pro-Kopf-Einzahlungen.
In
die Kassen der Kommunen in
Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2024 fast
130 Millionen Euro an Hundesteuer geflossen.
Wie das StatistischesLandesamt mitteilt,
waren das 2 % mehr als im Vorjahr (2023:
127 Millionen Euro). Die genannten Daten
entstammen der vierteljährlichen
Kassenstatistik, deren Gegenstand die Ein-
und Auszahlungen der Kommunen sind.
Die Statistik enthält keine Informationen
zur Anzahl der Steuerpflichtigen, ihrer
Hunde und der Steuerlast je Hundehalter/-in.
Rein rechnerisch flossen 7,16 Euro
Hundesteuer pro Kopf in die Kassen der
Kommunen Auf NRW-Ebene lagen die
Einzahlungen 2024 rein rechnerisch bei
7,16 Euro pro Einwohner/-in.
Unter
den kreisfreien Städten wurden die höchsten
Einzahlungen aus der Hundesteuer pro Kopf
für die Städte Remscheid mit 10,25 Euro,
Solingen mit 10,14 Euro und Mülheim an der
Ruhr mit 9,48 Euro ermittelt. Die
niedrigsten Pro-Kopf-Werte hatten Aachen
(4,28 Euro), Düsseldorf (4,39 Euro) und
Leverkusen (4,49 Euro).
Daten der
Abbildung
https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/201_25.xlsx
XLSX, 21,13 KB
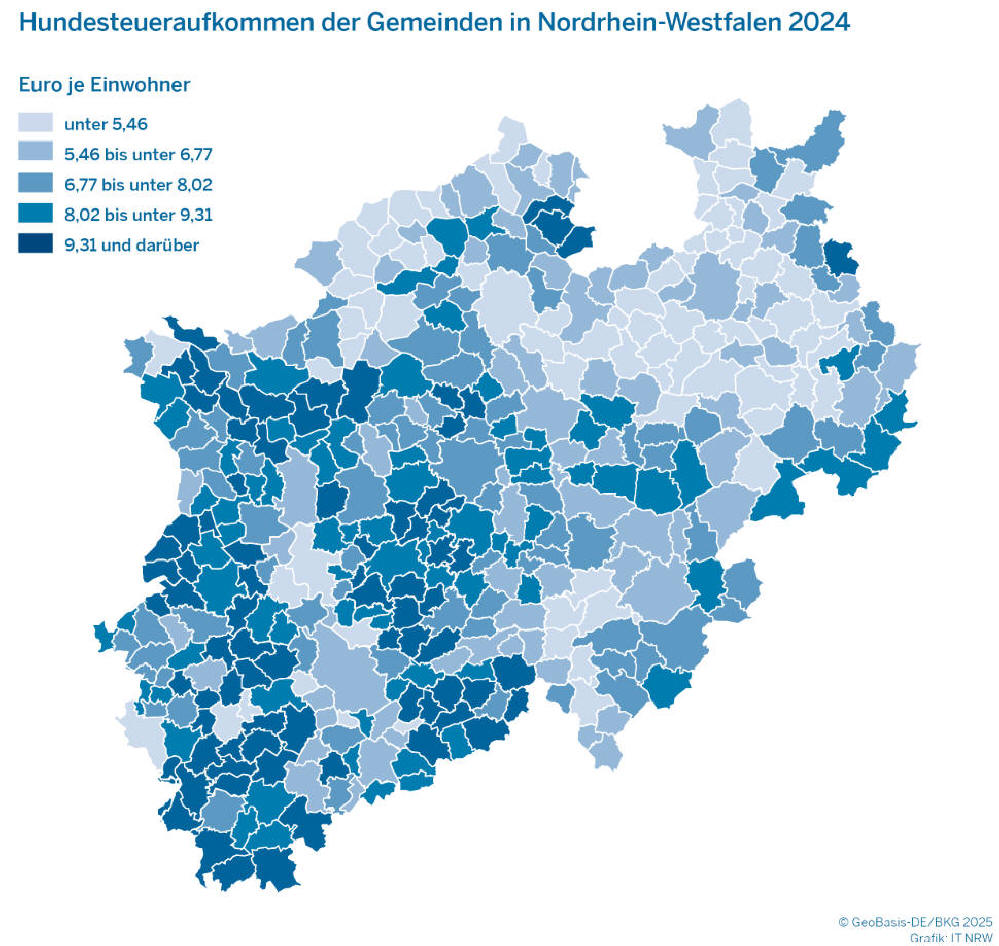
Unter den kreisangehörigen Gemeinden
hatten die höchsten Einzahlungen je
Einwohner/-in die Gemeinden Titz im Kreis
Düren mit 15,10 Euro, Hellenthal im Kreis
Euskirchen mit 14,64 Euro und Niederkrüchten
im Kreis Viersen mit 14,24 Euro. Die
niedrigsten Werte lagen für Ahlen im Kreis
Warendorf (0,96 Euro), Verl im Kreis
Gütersloh (2,05 Euro) und Augustdorf im
Kreis Lippe (2,85 Euro) vor.
Gemeinde
Bevölkerungsstand 2024 - Hundesteuer
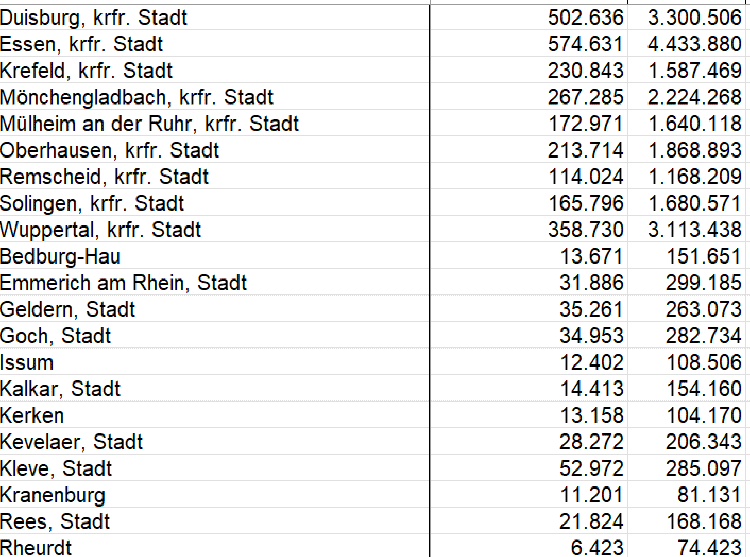
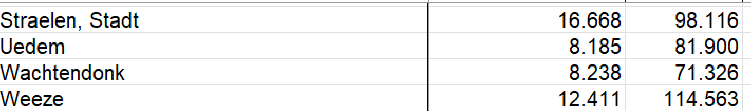
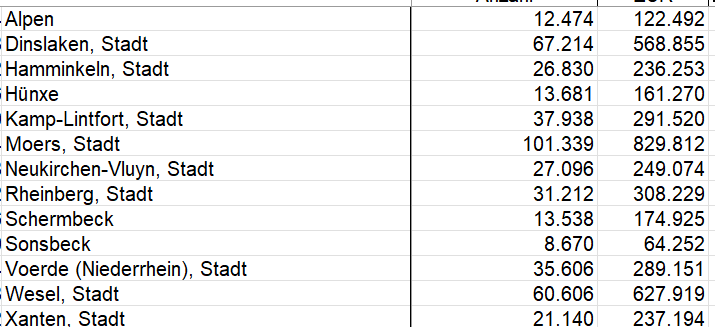
NRW: Zahl der zugelassenen
Wohnmobile um 8 % weiter gestiegen
* Durchschnittlich 110 Wohnmobile in NRW
je 10.000 Personen.
* Kreis Coesfeld
Spitzenreiter bei Wohnmobildichte.
Am Stichtag 1. Januar 2025 waren in
Nordrhein-Westfalen insgesamt 197.900
Wohnmobile zugelassen. Wie das Statistische
Landesamt anhand von Ergebnissen des
Kraftfahrt-Bundesamts mitteilt, ist die
Anzahl der Wohnmobile damit gegenüber dem
1. Januar 2024 um 8,1 % und gegenüber dem
1. Januar 2021 um 43,6 % gestiegen. Bezogen
auf die Gesamtbevölkerung in NRW waren
Anfang 2025 rein rechnerisch 110 Wohnmobile
je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner
zugelassen.
Damit lag NRW nach wie
vor etwas unterhalb des Bundesdurchschnitts
von 117 zugelassenen Wohnmobilen je 10.000
Personen. Wohnmobildichte in Kreisen höher
als in kreisfreien Städten – Kreis Coesfeld
war Spitzenreiter Anfang dieses Jahres waren
in allen Kreisen und kreisfreien Städten in
NRW mehr Wohnmobile zugelassen als noch ein
Jahr zuvor.
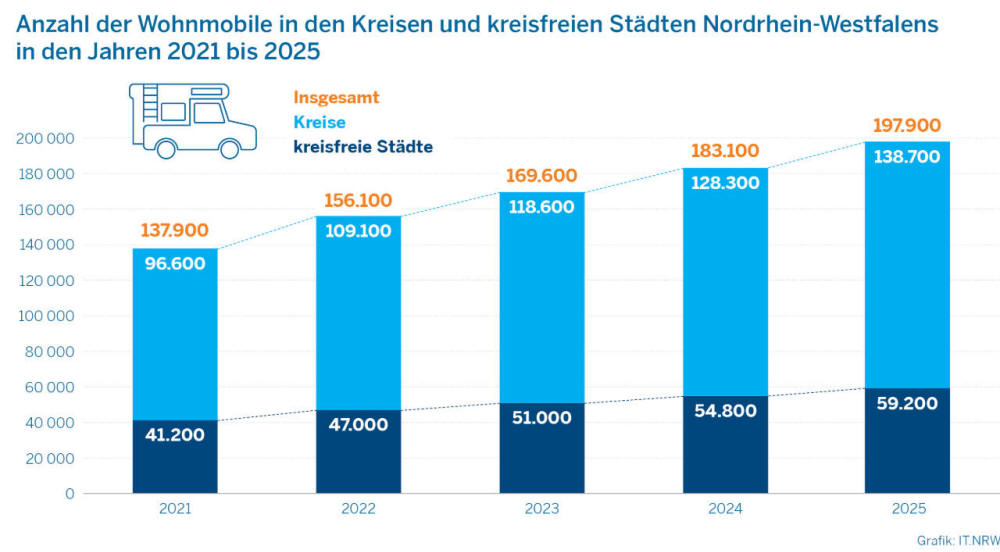
In den Kreisen lag die Wohnmobildichte
mit 129 Wohnmobilen je 10.000 Personen rund
57,6 % höher als in den kreisfreien Städten
mit 82 Wohnmobilen je 10.000 Personen. Am
1. Januar 2024 lag die Wohnmobildichte in
den Kreisen noch bei 119 Wohnmobilen und in
den kreisfreien Städten bei 74 Wohnmobilen
je 10.000 Personen.
Am höchsten war
die Wohnmobildichte nach wie vor im Kreis
Coesfeld mit rund 182 Wohnmobilen (1.1.2024:
168), am niedrigsten fiel sie mit rund 50
zugelassenen Wohnmobilen je 10.000
Einwohnerinnen und Einwohnern weiterhin in
der Stadt Gelsenkirchen aus (1.1.2024: 46).
Im Vergleich zum Vorjahr hatte die
Stadt Essen mit 19,1 % die größte Zunahme
bei der Wohnmobildichte zu verzeichnen. Dort
lag die Wohnmobildichte zum 1.1.2024 bei 62
Wohnmobilen je 10.000 Personen und stieg zum
1.1.2025 auf 74 Wohnmobile je 10.000
Personen.