






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 9. Kalenderwoche:
22. Februar
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Montag, 24. Februar 2025
Bundestagswahl: Bärbel Bas gewinnt Kreis 114, Özdemir Kreis
115, AfD dort zweitstärkste Kraft

Zu den Ergebnissen ...

Zu den gewählten Abgeordneten ...





CDU wird auch im
Ruhrgebiet stärkste Kraft – Wahlbeteiligung erneut gestiegen
Bei der gestrigen Wahl zum neuen Bundestag hat die CDU – wie im Bund
– auch im Ruhrgebiet die meisten Stimmen erhalten. Mit 26,2 Prozent
ist die CDU die stärkste Partei im Ruhrgebiet und liegt leicht unter
ihrem Bundesergebnis (28,5 %).
Zweitstärkste Kraft ist
die SPD mit 24,0 Prozent, die in den Ruhrgebietsstädten deutlich
besser abschneidet als im Bund (16,4 %). Die AfD kommt als
drittstärkste Kraft auf 18,8 Prozent und liegt unter ihrem
bundesweiten Ergebnis (20,8 %). Die Grünen kommen auf 10,5 Prozent,
gefolgt von den Linken mit 8,7 Prozent.
In 13 der 20
Ruhrgebiets-Wahlkreisen konnte die SPD das Direktmandat gewinnen. In
7 Wahlkreisen errang die CDU das Direktmandat. Im Ruhrgebiet haben
bei der gestrigen Bundestagswahl 80,1 Prozent der rund 3,66
Millionen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme
abgegeben.
Die Wahlbeteiligung war somit deutlich
stärker als bei den letzten beiden Wahlen (2021: 73,6 %, 2017: 76,2
%). Bundesweit lag die Wahlbeteiligung bei 82,5 Prozent. Die
insgesamt gültigen Stimmen (2.931.795) verteilen sich auf die
Parteien wie folgt:
Die CDU erreicht einen Stimmenanteil von
26,2 Prozent. Sie kann 4,1 Prozentpunkte mehr als im Jahre 2021
erzielen und verzeichnet Gewinne im gesamten Ruhrgebiet. Die SPD
erreicht mit 24,0 Prozent rund 10,3 Prozentpunkte weniger als im
Jahr 2021.
Die Verluste fallen für die Partei im
Ruhrgebiet im Vergleich zum Bundesergebnis deutlicher aus. Die AfD
erzielt 18,8 Prozent und gewinnt im Vergleich zur Bundestagswahl
2021 insgesamt 10,3 Prozentpunkte hinzu. Die Grünen kommen auf
insgesamt 10,5 Prozent der gültigen Stimmen in der Region. Damit
verzeichnet die Partei Verluste in Höhe von rund 3,7 Prozentpunkten.
Die Linke kommt, wie auch im Bund, im Ruhrgebiet auf rund
8,7 Prozent und legt etwa 4,8 Prozentpunkte zu. Die komplette
Wahl-Analyse aus dem RVR-Statistikteam u. a. mit Grafiken und
Ergebnissen für die Ruhrgebiets-Wahlkreise unter:
https://www.rvr.ruhr/daten-digitales/regionalstatistik/wahlen/
IHK zur Wahl: Vorfahrt für die Wirtschaft - Unternehmen
erwarten schnelles Handeln Tempo gefragt.
Eine neue
Regierung muss rasch loslegen, kommentiert die Niederrheinische IHK.
Die Unternehmen am Niederrhein fordern eine Wende in der
Wirtschaftspolitik. Das bedeutet: schneller entscheiden und Vorfahrt
für die Wachstum in der Wirtschaft.
„Wir erwarten von
der neuen Bundesregierung, dass sie die Hängepartie für unsere
Unternehmen endlich beendet. Sonst fallen wir im internationalen
Wettbewerb weiter zurück. Das muss die Politik verhindern. Wir
brauchen weniger Bürokratie, günstigere Energie und eine
funktionierende Infrastruktur. Und das schnell. Die Unternehmen
haben lange genug gewartet. Jetzt ist die Zeit für einen
wirtschaftspolitischen Ruck“, fordert Werner Schaurte-Küppers,
Präsident der Niederrheinischen IHK.
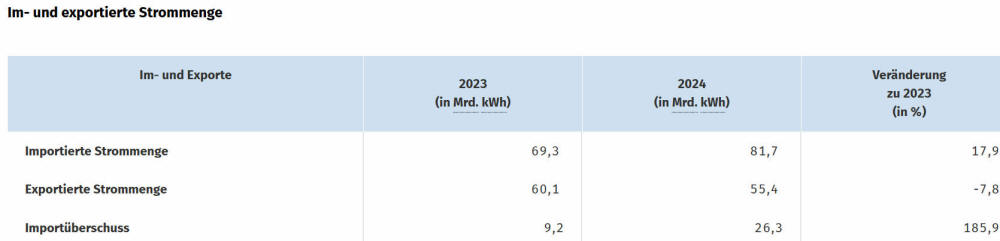
Foto: Niederrheinische IHK/Michael Neuhaus
Schließlich gehe
es vor allem in Duisburg um die Zukunft des Stahlstandortes. „Bei
uns am Niederrhein sitzt die Industrie, die am meisten Energie
benötigt. Wir könnten Vorbild für grünen Stahl sein. Unsere
Wirtschaft hat das Know-how, die Technologie und den
unternehmerischen Willen. Die Politik sollte diese Chance nutzen.“
Unternehmen ziehen Bilanz Die weltpolitische Lage trifft
die Wirtschaft am Niederrhein. Die IHK hat die Betriebe zu ihrer
Lage befragt. Vielen Unternehmen fehlt eine politische Richtschnur.
Mehr als 80 Prozent berichten, dass sich die Energiekosten erhöht
hätten. Die Arbeitskosten seien gestiegen. Top-Thema für die
IHK-Unternehmen: 95 Prozent wollen, dass die neue Regierung
Bürokratie abbaut.
Knapp zwei Drittel erwarten Investitionen
in Straßen, Brücken und Schienen. Ebenso viele wünschen sich, dass
das Geld durch Einsparungen im Haushalt kommt. Für mehr
Staats-Schulden gibt es eine Absage.
Neu in MEIN DUISBURG-App: Kultur in Duisburg erhält digitale
Plattform
Mit einer neuen Funktion in der MEIN
DUISBURG-App erhalten die vielfältigen Kulturangebote und
Kulturschaffenden in Duisburg eine digitale Plattform: Ab sofort
können Bürgerinnen und Bürger die App nutzen, um kulturelle Angebote
und Highlights in Duisburg einfacher zu entdecken. Gleichzeitig
erhalten Kulturschaffende eine neue Möglichkeit, ihre Angebote,
Veranstaltungen und sich selbst sichtbarer zu präsentieren.
Die neue Kultur-Plattform hat das Amt für bezirkliche
Angelegenheiten initiiert und mit der Duisburger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft (DVV), dem Entwickler und Betreiber der MEIN
DUISBURG-App, gemeinsam umgesetzt. Aus vielen Gesprächen mit
Kulturschaffenden, Vereinen und Institutionen in den Bezirken
entstand die Idee die Sichtbarkeit der vielfältigen Kulturszene zu
erhöhen.
Die neue Kultur-Funktion fördert die
Sichtbarkeit und schafft einen zentralen Anlauflaufpunkt für alle,
die Duisburgs Kultur ausleben und erleben möchten. Die neue Funktion
ist auf der Startseite der App zu finden. Über eine Karte werden
alle Kulturangebote und -anbieter angezeigt. So lässt sich auch die
direkte Umgebung schnell nach interessanten Angeboten und
Veranstaltungen filtern.
Nutzer der App, die bereits
mehr als 45.000 Mal heruntergeladen wurde, erhalten über diesen Weg
Informationen und Kontaktmöglichkeit zu Kulturschaffenden und ihren
Angeboten. Zum Beispiel hat die KleinkunstBühne Meiderich in ihrem
Profil die nächsten Kabarett-Aufführungen hinterlegt und bietet dort
auch eine Verlosung von Eintrittskarten an.
Die Angebote
finden sich dann auch in den anderen Rubriken der App unter „Events“
oder „Aktionen“, so dass die Kulturangebote an mehreren Stellen in
der App sichtbar werden. Auch das filmforum hat sein komplettes
Programm in der App hinterlegt und über sein Profil sogar den
Ticket-Shop angebunden. Die Kultur-Funktion in der App lebt davon,
dass möglichst viele Kulturschaffenden dort ihre Angebote sichtbar
machen.
Damit kann die MEIN DUISBURG-App zu einem
bedeutenden digitalen Kulturhub werden, der Kulturschaffende und
Kulturinteressierte effizient vernetzt. Interessierte
Kulturschaffende können sich auf der Webseite
https://partner.meinduisburg.app/provider-registration ein eigenes
Profil anlegen und Informationen, Bildern, Texten, Videos und
Terminen hinterlegen. Die MEIN DUISBURG-App kann sowohl für Apple
als auch Android kostenlos in den bekannten App-Stores
heruntergeladen werden.
IHK bietet Online-Lehrgang
zum Betrieblichen Klimamanager
Immer mehr Unternehmen
setzten auf Klimaneutralität. Um das komplexe Feld zu überblicken,
bildet die Niederrheinische IHK Betriebliche Klimamanager aus. Fach-
und Führungskräfte erhalten Infos zur Klimaentwicklung und zum
Emissionsverhalten. Darauf aufbauend lernen die Teilnehmenden, wie
sie eine CO2-Bilanz erstellen.
Ziel ist es, ein
leistungsfähiges Klimamanagement für ihren Betrieb zu konzipieren,
umzusetzen und weiterzuentwickeln. Mit diesen Kompetenzen beraten
sie zu den Chancen und Risiken der gewählten Klimastrategie.
Der Online-Lehrgang findet vom 24. März bis 16 Juni statt, immer
montags und mittwochs von 14 bis 18 Uhr. IHK-Ansprechpartnerin ist
Sabrina Giersemehl, 0203 2821-382, giersemehl@niederrhein.ihk.de.
Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter
www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen.
Inflation für 5 von 9 Haushaltstypen bei oder unter 2
Prozent, auch staatlich beeinflusste Preise verhinderten noch
stärkeren Rückgang
Die Inflationsrate in Deutschland ist
im Januar 2025 gegenüber Dezember 2024 von 2,6 auf 2,3 Prozent
gesunken und liegt damit nahe beim Inflationsziel der Europäischen
Zentralbank (EZB) von zwei Prozent.
Ähnlich ist das Muster,
wenn man auf die Inflationsraten verschiedener Haushaltstypen
blickt, die sich nach Einkommen und Personenzahl unterscheiden: Vier
von neun Haushaltstypen hatten im Januar Inflationsraten etwas
oberhalb des EZB-Ziels, während sie bei fünf Haushaltstypen unter
oder bei zwei Prozent lagen, zeigt der neue Inflationsmonitor des
Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der
Hans-Böckler-Stiftung.*
Insgesamt reichte die Bandbreite
der haushaltsspezifischen Inflationsraten im Januar von 1,7 bis 2,4
Prozent. Das ist ein relativ geringer Unterschied. Zum Vergleich:
Auf dem Höhepunkt der Inflationswelle im Herbst 2022 waren es 3,1
Prozentpunkte. Während Haushalte mit niedrigen Einkommen während des
akuten Teuerungsschubs der Jahre 2022 und 2023 eine deutlich höhere
Inflation schultern mussten als Haushalte mit mehr Einkommen, war
ihre Inflationsrate im Januar 2025 wie in den Vormonaten
unterdurchschnittlich: Der Warenkorb von Paaren mit Kindern sowie
der von Alleinlebenden mit jeweils niedrigen Einkommen verteuerte
sich um je 1,7 Prozent.
Dabei wirkte sich aus, dass
sowohl aktuelle Preisrückgänge bei Energie als auch der moderate
Anstieg bei Nahrungsmitteln im Warenkorb dieser Haushalte ein
relativ hohes Gewicht haben, weil beides Güter des Grundbedarfs
sind. Auch die Kernrate, also die Inflation ohne die
schwankungsanfälligen Posten Nahrungsmittel (im weiten Sinne) und
Energie, sank zwischen Dezember und Januar spürbar von 3,1 auf 2,8
Prozent.
Im Jahresverlauf 2025 dürfte sich die
Inflationsrate weiter normalisieren und bei gesamtwirtschaftlich
zwei Prozent einpendeln, so die Prognose des IMK. Gleichzeitig
schwächelt die Wirtschaft im Euroraum, in Deutschland stagniert sie
sogar. Daher hält Dr. Silke Tober, IMK-Expertin für Geldpolitik und
Autorin des Inflationsmonitors, weitere Zinsschritte für
erforderlich.
„Da die Leitzinsen trotz der fünf
Zinssenkungen seit Juni 2024 noch auf einem Niveau sind, das die
Wirtschaft dämpft, sollte die EZB die geldpolitischen Zügel zügig
weiter lockern“, schreibt sie. In der Pflicht sieht die Ökonomin
aber auch die künftige Bundesregierung. Diese müsse für eine
wirtschaftliche Belebung „die Investitionen ankurbeln und die
Energiepreise senken“.
Letzteres sei auch noch aus einem
anderen Grund sehr sinnvoll, analysiert die Geldpolitik-Expertin.
Denn vor allem staatlich beeinflusste Preise haben verhindert, dass
die Inflation zum Jahresbeginn 2025 noch stärker zurückging – und
sie waren mit verantwortlich dafür, dass der etwas anders berechnete
europäische Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) sogar stabil
blieb.
Zu diesen „staatlich bedingten Preiserhöhungen“
gehörten laut Tober unter anderem die Preisanhebung beim
Deutschlandticket, bei den Netzentgelten und beim CO2-Preis. Um „in
der aktuell noch angespannten Phase der Desinflation keine staatlich
induzierten Erhöhungen des Preisniveaus zu bewirken und die
Verteilungswirkung zu Lasten einkommensschwacher Haushalte zu
kompensieren“ sollten Erhöhungen „einer Lenkungssteuer wie der
CO2-Preis“ an anderer Stelle von gezielten Entlastungen begleitet
sein: „Hier bietet sich eine Verringerung des Strompreises an“, so
Tober.
Das IMK berechnet seit Anfang 2022 monatlich
spezifische Teuerungsraten für neun repräsentative Haushaltstypen,
die sich nach Zahl und Alter der Mitglieder sowie nach dem Einkommen
unterscheiden.
Die längerfristige Betrachtung illustriert,
dass Haushalte mit niedrigem bis mittlerem Einkommen von der starken
Teuerung nach dem russischen Überfall auf die Ukraine besonders
stark betroffen waren, weil Güter des Grundbedarfs wie
Nahrungsmittel und Energie in ihrem Budget eine größere Rolle
spielen als bei Haushalten mit hohen Einkommen. Diese wirkten lange
als die stärksten Preistreiber, zeigt ein längerfristiger Vergleich,
den Tober in ihrem neuen Bericht ebenfalls anstellt: Insgesamt lagen
die Verbraucherpreise im Januar 2025 um 20,5 Prozent höher als fünf
Jahre zuvor.
Damit war die Teuerung fast doppelt so
stark wie mit der EZB-Zielinflation von kumuliert 10,4 Prozent in
diesem Zeitraum vereinbar. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke
verteuerten sich sogar um 34,6 Prozent, Energie war trotz der
Preisrückgänge in letzter Zeit um 37,1 Prozent teurer als im Januar
2020. Deutlich weniger stark, um 16,7 Prozent, haben sich
Dienstleistungen verteuert.
Auf dem Höhepunkt der
Inflationswelle im Oktober 2022 betrug die Teuerungsrate für
Familien mit niedrigen Einkommen 11 Prozent, die für ärmere
Alleinlebende 10,5 Prozent. Alleinlebende mit sehr hohen Einkommen
hatten damals mit 7,9 Prozent die mit Abstand niedrigste
Inflationsrate. Erschwerend kommt hinzu, dass Haushalte mit
niedrigeren Einkommen wenig finanzielle Polster besitzen und sich
die Güter des Grundbedarfs, die sie vor allem nachfragen, kaum
ersetzen oder einsparen lassen.
Im Januar 2025 verteuerten
sich die spezifischen Warenkörbe von Haushalten mit niedrigen bis
mittleren Einkommen hingegen etwas weniger stark als der
Durchschnitt, weil zuletzt vor allem die Preise für Dienstleistungen
anzogen, die mit steigendem Einkommen stärker nachgefragt werden.
Daher folgten im Vergleich der neun Haushaltstypen auf die Familien
und Alleinlebenden mit niedrigen Einkommen (je 1,7 Prozent
Inflation) die Inflationsraten von Alleinlebenden und
Alleinerziehenden mit jeweils mittleren Einkommen (je 1,9 Prozent)
sowie die von Paarfamilien mit Kindern und mittleren Einkommen (2,0
Prozent).


Am oberen Rand des Vergleichs lagen Alleinlebende mit sehr hohen
Einkommen (2,4 Prozent) und Familien mit hohen Einkommen (2,2
Prozent), bei denen sich beispielsweise höhere Preise für
Gaststätten- und Hotelbesuche stärker auswirkten. Dazwischen liegen
Alleinlebende mit höheren Einkommen und Paare ohne Kinder mit
mittleren Einkommen.
Online-Vortrag der VHS zum Demokratiebegriff
In Deutschland sorgt man sich um den Fortbestand der Demokratie.
Umso dringlicher ist die Frage, was die politisch-weltanschaulichen
Kräfte der Gegenwart eigentlich unter Demokratie verstehen. Der
Historiker Prof. Dr. Volker Reinhardt beschäftigt sich in seinem
Online-Vortrag am Montag, 24. Februar, von 20 bis 21.30 Uhr mit
bedeutenden Demokratietheorien der Frühen Neuzeit.
Professor Reinhardt deutet aktuell geführte Auseinandersetzungen mit
dem Schwerpunkt auf wichtige Ideengeber wie Girolamo Savonarola,
Niccolò Machiavelli, Jean-Jacques Rousseau und Friedrich Schiller.
Titel des Vortrags: „Debatten über Demokratie – Argumente contra und
pro zwischen Renaissance und Aufklärung“.
Die Teilnahme
an dieser Gemeinschaftsveranstaltung der Volkshochschule (VHS)
Duisburg, der Vereinigung „Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V.“
und weiterer Partner ist frei. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
bekommen nach Anmeldung den Zugangslink zur Veranstaltung zugesandt.
Anmeldungen sind unter Angabe des Kursnamens per E-Mail an
info@vhsduisburg.de möglich.
Handarbeiten und
Basteln in der Bezirksbibliothek Meiderich
In der
Bezirksbibliothek Meiderich, Von-der-Mark-Straße 71, treffen sich
auch im März wieder ein Bastel- und ein Handarbeitskreis. Wer
Interesse am gemeinsamen Stricken, Häkeln und Sticken hat oder gerne
kreativ mit Papier, Tonkarton und anderen Materialien gestaltet, ist
hier richtig. Materialien für das eigene Projekt sollten mitgebracht
werden. Anleitungen, Bücher zum Thema und eine Grundausstattung an
Klebestiften, Scheren, Tonpapier und -karton stehen zur Verfügung.
Der Handarbeitskreis trifft sich an jedem ersten und
dritten Donnerstag im Monat. Der nächste Termin ist am der 6. März
um 16 Uhr. Gebastelt wird immer am zweiten Donnerstag im Monat ab 16
Uhr. Hier ist der nächste Termin der 13. März. Die Teilnahme ist
kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Für
Fragen steht das Team der Bibliothek persönlich oder telefonisch
unter 0203/4499366 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten der Bibliothek
sind dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und von 14 bis
18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.
Ausstellung „Schulkunst“ in der Meidericher Bibliothek
In der Bezirksbibliothek Meiderich, Von-der-Mark-Straße 71, wird am
Donnerstag, 6. März, um 9 Uhr die 31. Ausstellung „Schulkunst“
eröffnet. Gezeigt werden vielfältige Arbeiten, die Schülerinnen und
Schüler der weiterführenden Schulen im Stadtbezirk Meiderich/Beeck
im Kunstunterricht erstellt haben.

Die Musik-AG des Max-Planck-Gymnasiums begleitet die
Auftaktveranstaltung musikalisch. Organisiert wird die Ausstellung
von der Initiative KIM, Kunst in Meiderich. Darin haben sich
weiterführende Schulen des Bezirks, der Verein Aksus und die
Bezirksbibliothek zusammengeschlossen.
Die Ausstellung ist
bis zum 6. Mai während der Öffnungszeiten (dienstags bis freitags
von 10.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10
bis 13 Uhr) zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.
Kinderprogramm in der Hamborner Bibliothek
In der
Hamborner Bibliothek im Rathauscenter Schreckerstraße finden auch im
März viele Kinderveranstaltungen statt. Kinder ab fünf Jahren sind
am Samstag, 1. März, um 10 Uhr zum Vorlesespaß mit Frau Cengiz
eingeladen. Nach einer spannenden Geschichte wird noch gebastelt. Am
gleichen Tag um 11 Uhr können Grundschulkinder der zweiten bis
vierten Klasse sich bei den Duisburger UmweltKids treffen.
Beim Thema „Wertstoffprofi“ geht es um das richtige Sortieren
von Müll und warum dies so wichtig für die Umwelt ist. Die beliebte
Geschichtenzeit für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren findet am
Freitag, 14. März, um 16.30 Uhr statt. Hier sind alle richtig, die
Geschichten mögen, gerne zuhören oder auch lesen. Die Teilnahme ist
kostenfrei.
Mehr Informationen zu diesen und weiteren
Terminen und die Anmeldung finden sich auf
www.stadtbibliothekduisburg.de. Fragen beantwortet das Team der
Bibliothek gerne persönlich oder telefonisch unter 0203 2835373. Die
Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und
von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.
Sofia Andruchowytsch liest in der Zentralbibliothek
abgesagt
Die ukrainische Autorin Sofia Andruchowytsch
sollte am Montag, 24. Februar, in der Zentralbibliothek, Steinsche
Gasse 26, aus dem Buch „Die Geschichte von Sofia“ lesen.
Die
geplante Lesung in der Zentralbibliothek fällt krankheitsbedingt
aus. Karten die online gekauft wurden, werden automatisch erstattet.
Tickets die über eine Vorverkaufsstelle gekauft wurden, können dort
umgetauscht werden. Wir bitten um Verständnis.

(C) Alexander Chekmenev
Sofia Andruchowytsch führt in diesem
Roman alle Fäden der großen Trilogie zusammen und zeigt
eindrucksvoll, dass wir die Gegenwart der Ukraine nur verstehen
können, wenn wir ihre Geschichte kennen. Alexander Kratochvil
begleitet den Abend als Übersetzer. Weitere Informationen und der
Online-Ticketshop finden sich online auf
www.stadtbibliothek-duisburg.de. Karten sind auch an den bekannten
Vorverkaufsstellen erhältlich.
Filip Alilovic – Gitarrenkonzert
Nach dem sehr erfolgreichen Auftakt im Januar setzt
Filip Alilovic seine Gastspielreihe im Kreativquartier Ruhrort fort.
Filip Alilovics Kompositionen sind durchdrungen von gefühlvollen
Klängen, die das Publikum in ihren Bann ziehen. Dabei schwingt stets
der Hauch folkloristischer Einflüsse aus den Gefilden Südost-Europas
mit. Seine Werke sind unter Kennern der klassischen Gitarre
bekanntes Repertoire.
In den vielen Jahren seines kreativen
Schaffens wurden bis dato 200 seiner Solowerke, mehrere
kammermusikalische Werke, sowie auch symphonische Gitarrenkonzerte
veröffentlicht. Zudem hat er viele Werke anderer Komponisten für die
Sologitarre arrangiert.

Filip Alilovic (C) Dirk Leiss - Gitarrenkonzert Montag, 24. Februar
2025, 19 Uhr.
Das PLUS am Neumarkt, Neumarkt 19, 47119
Duisburg-Ruhrort. Eintritt frei(willig) - Hutveranstaltung
Impro-Predigten, Chor- und
Dudelsackmusik beim Gottesdienst der Nordgemeinden am Tulpensonntag
Am Tulpensonntag feiern die sechs Nordgemeinden im Evangelischen
Kirchenkreis Duisburg mit Chor- und Dudelsackmusik und mit kurzen
Improvisationspredigten zu Bibelstellen, die die Gläubigen vorgeben,
einen außergewöhnlichen Gottesdienst im Vorfeld des Rosenmontags.
Die Gemeinden laden herzlich zum Mitfeiern und Mitsingen am 2. März
im Obermeiderich Gemeindezentrum an der Emilstraße ein.

Los geht es um 11 Uhr mit live gespielter Dudelsackmusik (u.a. „Mull
of Kintyre“) auf dem Kirchplatz. Im Gottesdienst, der um 11.11 Uhr
beginnt, ist das Instrument auch zu hören – mit „Amazing Grace“ und
weiteren Liedern, die mit den Stimmen des Chores zusammen erklingen
(wie „You raise me up“. Wer Ohrstöpsel braucht und vergisst, bekommt
Gehörschütz am Eingang.
Besonders ist zudem, dass es keine
klassische Predigt geben wird: Pfarrerin Sarah Süselbeck und Pfarrer
im Ruhestand Dr. Stephan Kiepe-Fahrenholz werden sechs Mal je zwei
Minuten improvisiert predigen. Worüber, bestimmten die
Gottesdienstbesucherinnen und -besucher. Sie können vor 11.11 Uhr
eine ihre Wunsch-Bibelstelle auf einen Zettel schreiben.
Diese werden gesammelt und dann lottomäßig im Gottesdienst gezogen
und dienen als Grundlage für die spontane Zwei-Minuten-Predigt. Bis
nach der Ziehung ein Lied gesungen wird, haben Predigerin und
Prediger Zeit, die passenden Inhalte und Worte für ihre
Kurzpredigten zu finden. Nach dem Gottesdienst öffnet das
Kirchencafé und eventuell gibt es draußen noch Karnevalsschlager zu
hören und zum Mitsingen.
„Das gute Gefühl, gebraucht zu werden“
Ehrenamtliches Engagement wichtiger denn je – auch in der
Evangelischen Rheingemeinde Duisburg
„Ehrenamtliches
Engagement muss Spaß machen, darf nicht in Stress ausarten oder gar
zur Belastung werden“, sagt Maria Hönes. Es müsse „auf jeden Fall
sinnstiftend“ sein, meint die Ehrenamtskoordinatorin der
Evangelischen Rheingemeinde Duisburg und „für das gute Gefühl
sorgen, gebraucht zu werden und helfen zu können.“
Beispiele für das gute Miteinander von Ehrenamtlichen der Gemeinde
in den Stadtteilen Wanheim und Wanheimerort hat sie reichlich.
Gemeinschaft, Geborgenheit, Ideenaustausch und Anregungen, auch mal
was Neues auf den Weg zu bringen, sind Stichpunkte, die ihr spontan
einfallen. Die Worte „Anpacken und Zupacken“ folgen sofort. Maria
Hönes spricht über eine neue Idee und strahlt: „In Wanheimerort etwa
wollen wir ein Repair-Café der etwas anderen Art ins Leben rufen,
keine Anlaufstelle, wo man was zum Reparieren hinbringen kann,
sondern eine schnelle mobile Eingreiftruppe, die dort erscheint, wo
was im Argen liegt.“
Kürzlich bekam sie den Anruf einer
alleinstehenden älteren Dame. Die berichtete fast verschämt, dass
sie nicht in der Lage sei, eine Glühbirne auszuwechseln und ob Maria
Hönes nicht jemanden hätte, der ihr helfen könne. Hatte sie, und der
dankbaren Dame ging im wahren Sinn des Wortes wieder ein Licht auf.
Das machte in der Gemeinde schnell die Runde. So wurde Maria Hönes'
Idee des etwas anderen Repair-Cafés konkretisiert. Einige
handwerklich versierte Männer haben sich sofort bereiterklärt, da
mitzumachen, freut sich die Ehrenamtskoordinatorin.
Aber
Verstärkung für die kreative Gemeinschaft der Ehrenamtlichen wird
weiterhin gesucht und benötigt. Denn ohne sie läuft in vielen
Bereichen der Gesellschaft gar nichts oder zumindest nur wenig, und
das gelte, so Maria Hönes, für zahlreiche Vereine, Organisationen
und Institutionen, halt auch für die Evangelische Kirche. Sie nennt
die Nähstube, in der ehrenamtliche Frauen sticken, stürmen und
Lieblingskleider retten, das Kirchen-Café, bei dem stets Leckeres
auf den Tisch des Hauses kommt, das Ein- und Abräumen vor und danach
sowie natürlich das Spülen des Geschirrs.
Selbst das
könne Spaß machen, lacht sie. So hat ihr eine Ehrenamtliche nach
einer Veranstaltung mal zugerufen: „Mit der Spülmaschine bin ich
schon auf Du und Du.“ Ehrenamtliche seien zudem ein „Wundermittel
gegen die Einsamkeit“. Das spüren viele Menschen, wenn sie Besuch
aus der Gemeinde bekommen, und das nicht nur an Geburtstagen,
sondern auch an den 364 Tagen davor und danach.
„Und
gerade für den Besuchsdienst suchen wir noch Frauen und Männer, die
sich mal ein Stündchen Zeit für ihre Mitmenschen nehmen.“ Auch in
anderen Bereich wäre man für „Nachwuchs“ dankbar. Maria Hönes nennt
die Oldie-Disco, den Tanztee oder die Singnachmittage. Wer Ideen für
neue Kurs-, Freizeit- oder Bildungsangebote hat, ist ebenfalls
herzlich willkommen. Und „Küsterhelfer“ sind auch gefragt. Die
unterstützen oder vertreten Küster Frank Rohde und tragen dazu bei,
den reibungslosen Ablauf der Gottesdienste und kirchlichen
Veranstaltungen zu gewährleisten.
„Zu tun gibt es bei
uns immer was“, weiß Maria Hönes, und das verdeutliche auch das
pulsierende, ein- und mitnehmende Gemeindeleben. Wer sich
ehrenamtlich betätigen möchte, kann gerne Kontakt mit Maria Hönes
aufnehmen (Tel.: 0203 / 7701 34 – Gemeindehaus Vogelsangplatz –
E-Mail: maria.hoenes@ekir.de.) Übrigens, auch bei den Ehrenamtlichen
selbst ist eine gute Gemeinschaft und regelmäßiger Austausch
selbstverständlich, etwa bei den lockeren Mitarbeitendentreffs mit
leckeren Snacks, Informationen und gemütlichem Beisammensein. Reiner
Terhorst

Die Leckereien, die Maria Hönes hier in den Händen hat, haben
Ehrenamtliche gebacken und zubereitet. Der Verkaufserlös dient der
Finanzierung weiterer Gemeindeangebote. Foto: Reiner Terhorst

Fünf Jahre Corona: Zahl der kommunalen Beschäftigten
in NRW im Bereich der Gesundheitsdienste um ein Drittel angestiegen
Bei den Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind Ende Juni
2023 rund 34 Prozent mehr Personen im Bereich Gesundheitsdienste
beschäftigt gewesen als vor Beginn der Corona-Pandemie. Zu den
kommunalen Gesundheitsdiensten zählen u. a. die Gesundheitsämter.
Wie das Statistische Landesamt anlässlich des Beginns der
Corona-Pandemie vor fünf Jahren mitteilt, waren im Jahr 2023 in
diesem Bereich 6 960 Personen tätig; 2019 waren es 5 190 gewesen. In
den Vor-Corona-Jahren war die Zahl der Beschäftigten im Bereich
kommunale Gesundheitsdienste nahezu konstant. In der Hochphase der
Pandemie 2021 ist sie dann sprunghaft auf 9 310 Personen gestiegen
und anschließend wieder gesunken.
Kontinuierliche
Zuwächse bei dauerhaft Beschäftigten
Im Detail gab es nach Beginn
der Corona-Pandemie kontinuierliche Zuwächse bei der Zahl der
dauerhaft Beschäftigten in den kommunalen Gesundheitsdiensten in
NRW. 2023 waren im genannten Bereich 6 240 Personen tätig, das war
fast ein Viertel mehr als vor der Corona-Pandemie (2019: 5 005).
2021 hatte diese Zahl noch bei 5 590 Personen gelegen.
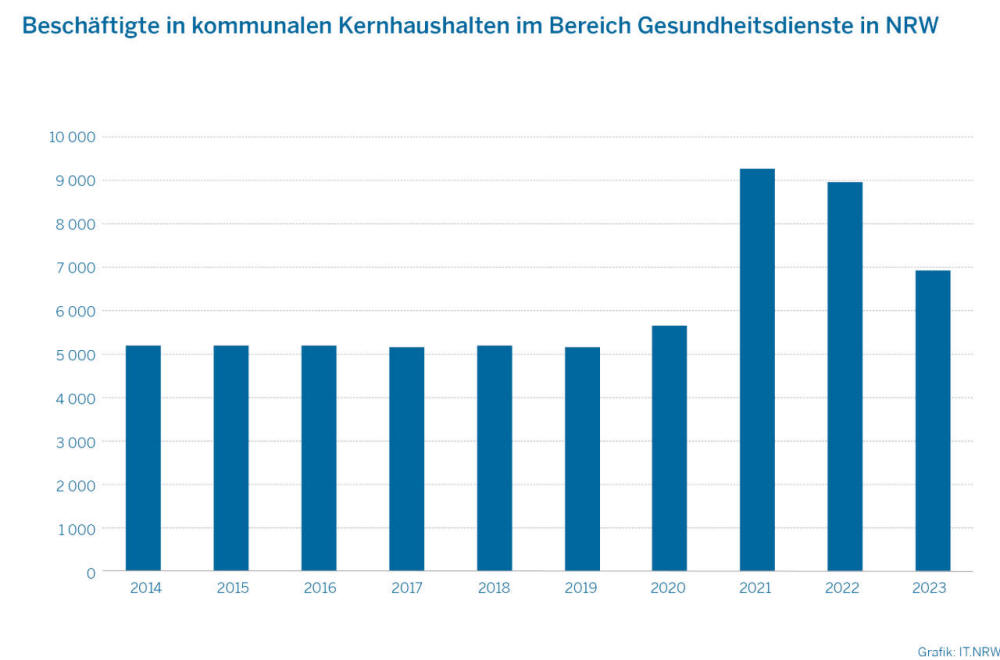
Zahl der befristet Beschäftigten war in der Hochphase der
Pandemie 22-mal höher als 2019
Auch die Zahl der Beschäftigten
mit Zeitverträgen war im Jahr 2023 mit 685 Tätigen weiterhin höher
als 2019 (damals: 170). Ganz anders hatte es jedoch in der Hochphase
der Pandemie ausgesehen: 2021 waren 3 685 Personen befristet
beschäftigt gewesen, das waren 22-mal so viele wie 2019 vor der
Pandemie.
Das Statistische Landesamt weist darauf hin,
dass insgesamt 2,3 Prozent aller Beschäftigten in kommunalen
Kernhaushalten Ende Juni 2023 im Bereich Gesundheitsdienste tätig
waren. Im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte der Anteil bei 1,9 Prozent
gelegen. Während der Hochphase der Pandemie im Jahr 2021 hatte das
Personal im Bereich Gesundheitsdienste 3,2 Prozent aller kommunalen
Beschäftigten gestellt.
NRW: Stärkste Reallohnentwicklung
seit 15 Jahren
Die effektiven
Bruttomonatsverdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
Nordrhein-Westfalen waren im Jahr 2024 real – also preisbereinigt –
um 2,7 Prozent höher als im Jahr 2023. Dies war der höchste Anstieg
der Reallöhne der letzten 15 Jahre. Wie das Statistische Landesamt
mitteilt, war der im Vergleich zu den beiden Vorjahren gemäßigte
Anstieg der Verbraucherpreise im Jahr 2024 (+2,2 Prozent)
hauptverantwortlich für den außergewöhnlich starken Reallohnzuwachs.
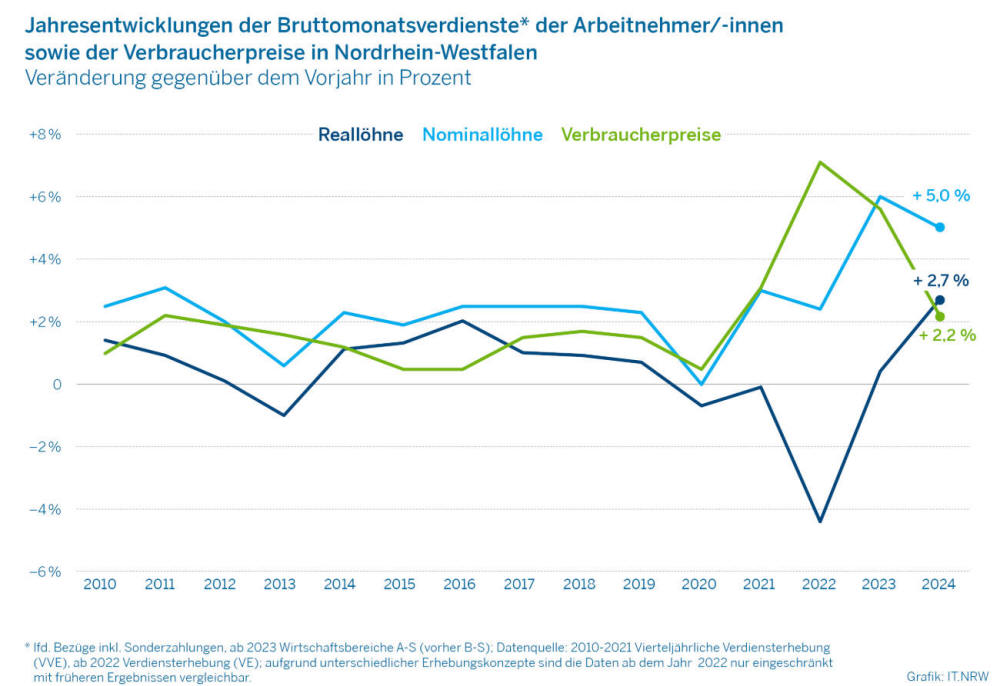
Allerdings war mit einem Plus von 5,0 Prozent auch ein
ungewöhnlich hoher Anstieg der Nominallöhne zu verzeichnen, der
jedoch etwas niedriger als im Jahr zuvor (2023: 6,0 Prozent)
ausfiel. Das überdurchschnittliche Nominallohnwachstum der
vergangenen beiden Jahre ist maßgeblich auf die Zahlung von
Inflationsausgleichsprämien sowie relativ hohen Tariflohnerhöhungen
und tariflichen Einmalzahlungen zurückzuführen.
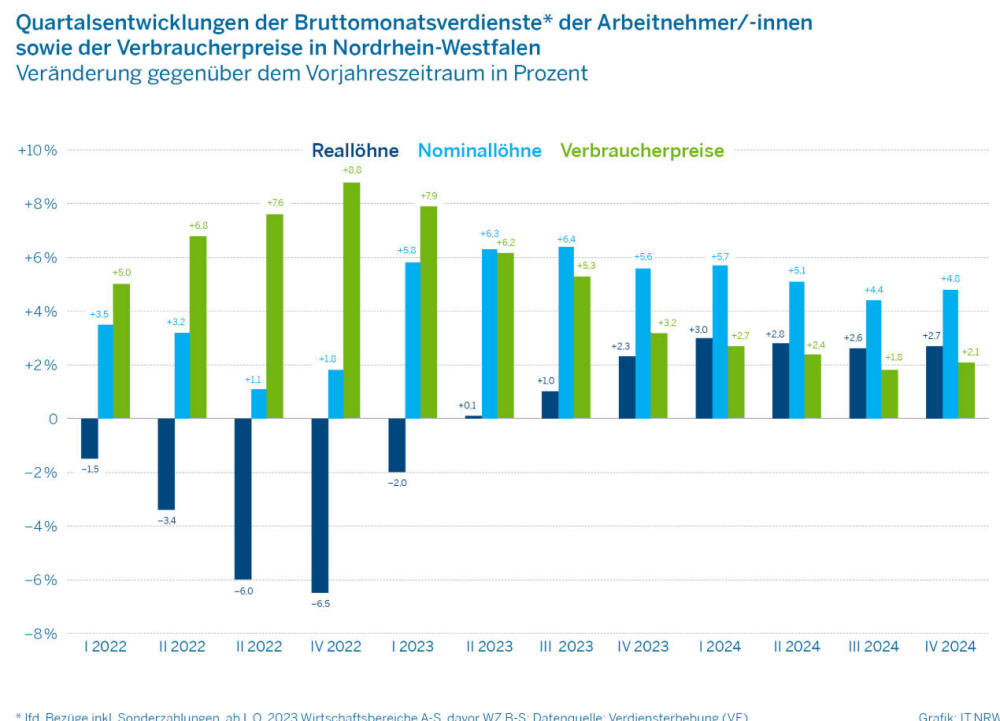
Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im
Dezember 2024: +0,2 % zum Vormonat
Auftragsbestand im
Verarbeitenden Gewerbe, Dezember 2024 +0,2 % real zum Vormonat
(saison- und kalenderbereinigt) -0,6 % real zum Vorjahresmonat
(kalenderbereinigt) Reichweite des Auftragsbestands 7,5 Monate
Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden
Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) im Dezember 2024 gegenüber November 2024 saison- und
kalenderbereinigt um 0,2 % gestiegen. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat Dezember 2023 lag der Auftragsbestand im Dezember
2024 kalenderbereinigt 0,6 % niedriger.
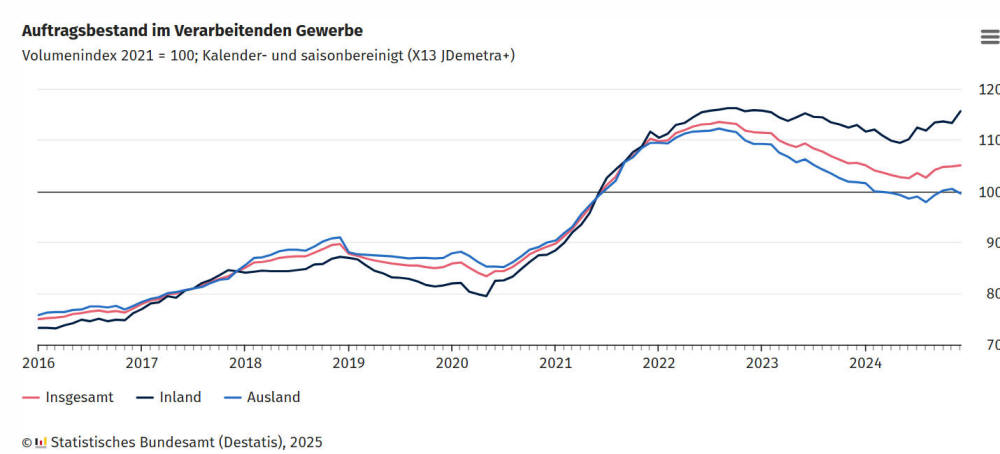
Der Anstieg des Auftragsbestands im Dezember 2024 ist wesentlich
auf die Entwicklung im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe,
Züge, Militärfahrzeuge; saison- und kalenderbereinigt +3,0 % zum
Vormonat) zurückzuführen. Ein hohes Volumen an Großaufträgen trug zu
dem Wachstum in diesem Bereich bei. Auch der Anstieg des
Auftragsbestands im Maschinenbau (+0,4 %) wirkte sich positiv aus.
Negativ beeinflussten das Gesamtergebnis hingegen die
Rückgänge im Bereich Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
(-0,5 %) und in der Automobilindustrie (-0,4 %). Die offenen
Aufträge aus dem Inland stiegen im Dezember 2024 gegenüber
November 2024 um 2,0 %. Der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland
fiel hingegen um 0,9 %. Bei den Herstellern von Investitionsgütern
sowie Konsumgütern nahm der Auftragsbestand jeweils um 0,3 % zu.
Im Bereich der Vorleistungsgüter sank der Auftragsbestand um
0,5 %. Reichweite des Auftragsbestands auf 7,5 Monaten gestiegen Im
Dezember 2024 stieg die Reichweite des Auftragsbestands im Vergleich
zum November 2024 von 7,3 Monaten auf 7,5 Monate. Bei den
Herstellern von Investitionsgütern stieg die Reichweite von
9,9 Monaten auf 10,1 Monate und bei den Herstellern von
Vorleistungsgütern von 4,1 Monaten auf 4,2 Monate.
Bei
den Herstellern von Konsumgütern blieb die Reichweite konstant bei
3,6 Monaten. Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe
bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch
produzieren müssten, um die vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie
wird als Quotient aus aktuellem Auftragsbestand und mittlerem Umsatz
der vergangenen zwölf Monate berechnet.