






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 23. Kalenderwoche:
7. Juni
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Pfingsmontag, 9. Juni 2025
Historische Eisenbahn-Sonderfahrten auf der Walsumbahn am
Pfingstmontag
Am Pfingstmontag, den 09.06.2025 wird das Rheinische
Industriebahn-Museum Köln e.V. von Duisburg Hbf aus über die Strecke
der sog. Walsumbahn nach Voerde-Emmelsum Pendelfahrten mit einem
historischen Sonderzug durchführen. Das Besondere an diesen
Sonderfahrten ist (neben dem Einsatz unserer historischen Fahrzeuge)
dass wir nahezu ausschließlich Eisenbahnstrecken ohne planmäßigen
Personenverkehr befahren.
Hierbei durchfährt der Sonderzug zunächst den großen
Rangierbahnhof Oberhausen West (recht bedeutend für die
Stahlindustrie im Duisburger Norden) im Oberhausener Stadtteil
Lirich. Dies ist eine Perspektive, die man als Fahrgast im regulären
öffentlichen Nahverkehr eher selten zu Gesicht bekommt.

Der historische Sonderzug im Dezember 2024 in Köln
Weiter führt der Weg über Oberhausen-Buschhausen
und Duisburg-Hamborn nach Duisburg-Walsum. Hier war für alle Züge
vom 23.06.2023 an erst einmal „Endstation“, weil aufgrund von
Starkregenereignissen die hinter Walsum befindliche Emscherbrücke so
stark beschädigt wurde dass ein Neubau unumgänglich wurde. Dieser
ist seit Mitte April diesen Jahres endlich abgeschlossen und somit
kann unser Sonderzug dann weiter nach Spellen bzw. zum Hafen
Emmelsum durchfahren.
Nach kurzem Aufenthalt geht es von
dort wieder zurück nach Duisburg. Die Politik strebt derzeit die
mittelfristige Reaktivierung der Walsumbahn für den öffentlichen
Personenverkehr an. Hierzu wurde im Jahre 2023 ein Beschluss beim
Aufgabenträger, dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, gefasst, um die
Reaktivierung weiter zu forcieren. Wir möchten die Eisenbahn auf
dieser Strecke allerdings schon jetzt wieder „erlebbar“ machen.

So sieht der „Silberling“ von innen aus – Reisen wie
damals...
Der Sonderzug wird gebildet aus einer bzw. zwei
Diesellokomotiven sowie mehreren „Donnerbüchsen“ (für die älteren
unter uns auch als DIE Holzklasse bekannt) und einem „Silberling“,
welche derzeit für planmäßige Ersatzverkehre in teilmodernisierter
Form in der Region wieder zum Einsatz kommen. Für das leibliche Wohl
auf der Fahrt sorgt unser Barwagen.
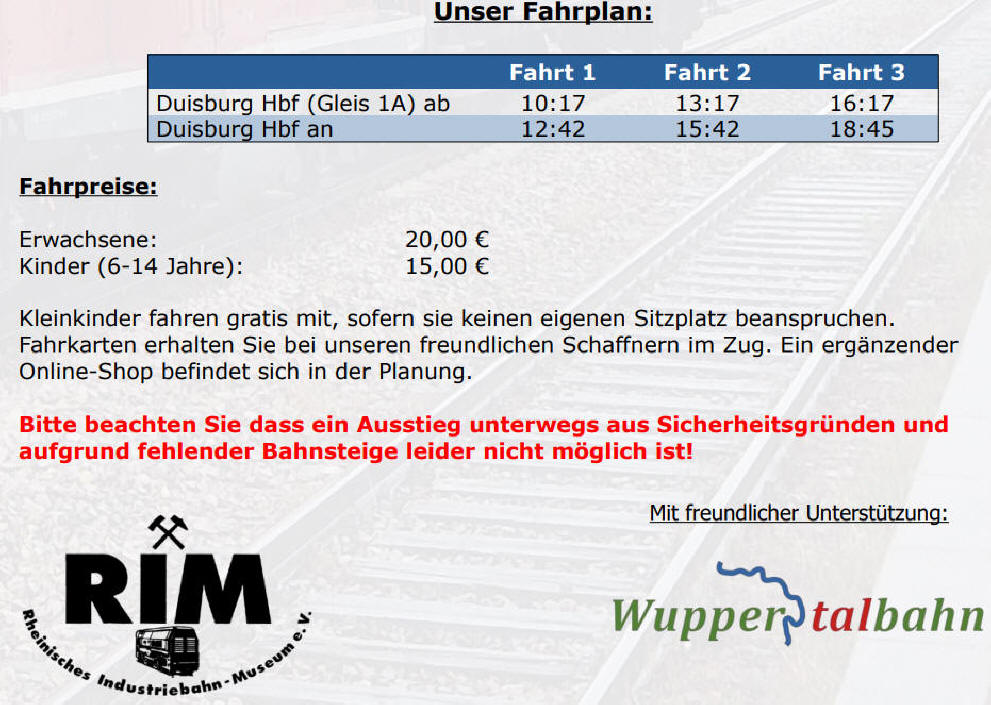
RVR vergibt 200.000 Euro für interkulturelle Projekte im
Ruhrgebiet
Der Regionalverband Ruhr (RVR) fördert auch 2025
interkulturelle Projekte im Ruhrgebiet mit insgesamt 200.000 Euro.
Die detaillierte Projektliste wurde jetzt vom Ausschuss für Kultur,
Sport und Vielfalt genehmigt. Insgesamt erhalten 34 Vorhaben
Fördersummen zwischen rund 2.000 und 13.000 Euro.
Einzelförderungen unter 5.000 Euro wurden bereits im Vorfeld durch
RVR-Regionaldirektor Garrelt Duin bewilligt, alle weiteren von einer
interfraktionellen Arbeitsgruppe ausgewählt. Die höchste
Einzelförderung erhält der Verein für die solidarische Gesellschaft
der Vielen e.V.
Mit 13.000 Euro unterstützt der Förderfonds
Interkultur das fünfte "Fest der Vielen". Durch die Vorarbeiten zur
Internationale Gartenausstellung IGA 2027 im Ruhrgebiet wird das
Fest nicht mehr auf der gewohnten Fläche im Rheinpark in Duisburg
stattfinden können, einem der Zukunftsgärten der IGA. Stattdessen
soll es drei eintägige Festivals in wechselnden Locations im
Ruhrgebiet geben.
Die Duisburger Ausgabe, die jetzt
gefördert wird, wird unter dem Motto "Fest der Vielen – Roots &
Routes" Sounds der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter der 1970er und
1980er auf die Bühne bringen. Unterstützt werden auch zahlreiche
kleinere Vorhaben – so zum Beispiel die "Kreative Mühle" in Essen.
In dem Familientreff nehmen ukrainische Eltern mit ihren Kindern
gemeinsam an kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen teil.
Sie wird mit 2.090 Euro gefördert.
Für das Online-Projekt
"Tell Tessy Empowerment" stehen 3.290 Euro bereit. Im Rahmen des
Projekts werden Online-Workshops für Zugewanderte und Flüchtlinge im
Kreis Wesel angeboten, darunter Sprachförderung, Bewerbungstraining,
berufliche/schulische Orientierung oder Unterstützungsmöglichkeiten.
Der Förderfonds Interkultur Ruhr ist eine gemeinsame
Initiative des Regionalverbands Ruhr (RVR) und des
NRW-Kulturministeriums. Er unterstützt Projekte mit einem
Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit Geflüchteten.
Das
Netzwerk Interkultur Ruhr dient dem Austausch zwischen
interkulturellen Initiativen und Organisationen im Ruhrgebiet.
Daneben werden künstlerische Projekte und Koproduktionen in
verschiedenen Städten der Region realisiert. idr
Antragstellung
und weitere Informationen:
http://www.interkultur.ruhr
Frühen Hilfen: Informationscafé zum Thema Elterngeld
Die Frühen Hilfen in Duisburg laden am Freitag, 6.
Juni, von 9.30 bis 11.30 Uhr, zum Informationscafé in die Zentrale
Anlaufstelle auf der Schwanenstraße 5-7 in der Duisburger Innenstadt
ein (Eingang Steinsche Gasse 2). Tanja Ruthert vom Jugendamt gibt
interessierten Eltern und jenen, die es bald werden, umfassende und
hilfreiche Informationen rund um das Thema Elterngeld.
Eine
Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich. Die Frühen
Hilfen Duisburg bieten ein vielfältiges Beratungsangebot zu allen
Themen rund um Schwangerschaft und Geburt sowie Informationen für
Eltern mit ihren Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren an. Sämtliche
Angebote der Frühen Hilfen in Duisburg sind kostenlos. Für weitere
Auskünfte steht Ihnen das Team der Frühen Hilfen unter 0203/283-8342
zur Verfügung.
„Hitzeschutz jetzt!“ -
BDP unterstützt Hitzeaktionstag 2025 und appelliert in
Richtung Bundesregierung, Deutschland hitzeresilient zu
machen
Die Psychologie kann beim Umgang mit den massiven
und weitreichenden Folgen des Klimawandels einen relevanten Beitrag
bei der Entwicklung von Aktionsplänen und dem Schutz der Bevölkerung
leisten.
Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und
Psychologen (BDP) setzt sich als Mitglied des breiten Bündnisses aus
Akteuren aus dem Gesundheitswesen und weiteren Organisationen für
die Verbesserung des gesundheitlichen Hitzeschutzes ein. Der
Klimawandel ist real und er schreitet voran. Und auch wir in
Deutschland müssen uns auf immer stärkere und bedrohlichere
meteorologische Szenarien einstellen, bei denen laut der Deutschen
Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V. (KLUG) Hitze das größte
klimabedingte Gesundheitsrisiko darstellen wird.
Gerade für
ältere und gesundheitlich vorbelastete Menschen bedeuten Hitzewellen
eine besonders starke physische wie auch psychische Belastung. Jedes
Jahr sterben in Deutschland mehrere tausend Menschen an den Folgen.
Hitzeperioden führen in der gesamten Bevölkerung zu einer
eingeschränkten Produktivität und haben Auswirkungen auf das
Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen.
„Trotz dieser
massiven Gesundheitsrisiken sind Deutschland und das deutsche
Gesundheits- und Sozialsystem unzureichend auf Hitzeperioden
vorbereitet. Gleichzeitig ist die Kompetenz der Bevölkerung
unzureichend, Hitzegefahren zu erkennen und sich und besonders
gefährdete Personen entsprechend zu schützen“, beschreibt KLUG die
aktuelle Lage in Deutschland.
Der BDP stimmt dieser
Einschätzung zu. Das Bündnis engagiert sich seit vielen Jahren für
eine wissenschaftlich fundierte Erforschung der Folgen des
Klimawandels sowie die Entwicklung von effektiven Strategien für
mehr Hitzeresilienz unter Berücksichtigung der gesundheitlichen
sowie auch wirtschaftlichen Aspekte. Für einen wirksamen
gesundheitlichen Hitzeschutz der gesamten Bevölkerung in Deutschland
braucht es die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen auf
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene.
In diesem
Zusammenhang unterstützt der BDP den Forderungskatalog des
Bündnisses. Der Anstieg an Arztbesuchen, Krankenhauseinweisungen und
Notfalldiensteinsätzen führt bereits jetzt zu einer Überlastung des
Gesundheitssystems. Mit Blick auf zukünftige Szenarien im
Zusammenhang mit Hitzeperioden hält der Verband die Einbeziehung der
psychosozialen Notfallversorgung der Bevölkerung für einen
effektiven Katastrophen- und Zivilschutz für absolut erforderlich
und arbeitet bereits jetzt an entsprechenden politischen Positionen.
Im aktuellen Koalitionsvertrag findet sie keine
Berücksichtigung. Neben Hitzeaktionsplänen und strukturellen
Maßnahmen ist eine bevölkerungsbezogene Strategie in Bezug auf
Resilienz und Anpassungsfähigkeit im Hinblick auf klimabewusste
Verhaltensänderungen erforderlich. Auch hier braucht es die
Einbeziehung der psychologischen Expertise in politische
Entscheidungsprozesse sowie in die strategische Klimakommunikation
und Kampagnenarbeit.
Doch auch hier gibt es keine Erwähnung
der Psychologie im aktuellen Koalitionsvertrag. Im Zusammenhang mit
den Bemühungen um einen bewussteren Umgang mit der Klimakrise
engagiert sich der BDP zudem seit längerem in unterschiedlichen
Organisationen und Bündnissen wie der Global Psychology Alliance
(GPA) und in der European Federation of Psychologists‘ Associations
(EFPA), dem europäischen Dachverband europäischer
Psychologenvereinigungen.
Gleichzeitig unterstützt der
Verband als Mitglied oder zeichnende Organisation die Arbeit von
Organisationen wie Psychologists/Psychotherapists for Future (Psy4F)
oder der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) und hat
kürzlich die Stellungnahme des Deutschen Komitees für
Nachhaltigkeitsforschung mit gezeichnet.
Im letzten Jahr hat
der Verband im BDP-Bericht 2024 „Psychologische Strategien im
Klimawandel: Strategien und Konzepte“ die zentrale Rolle der
Psychologie bei der Bewältigung des Klimawandels und seiner Folgen
in den Fokus genommen.
Trauercafé am
15. Juni im Malteser Hospizzentrum St. Raphael
Der
Verlust eines geliebten Menschen schmerzt und reißt eine große Lücke
in das Leben von Verwandten und Freunden. Die geschulten und
erfahrenen Mitarbeitenden des Malteser Hospizzentrum St. Raphael
bieten unterschiedliche Beratungsangebote für Hinterbliebene. Die
Trauerberatung ist eine Hilfestellung, den schwierigen Übergang in
ein anderes „Weiter-Leben“ während der Trauerphase zu begleiten und
neue Wege zu finden.
Das Trauercafé findet einmal im Monat
im Malteser Hospizzentrum St. Raphael, Remberger Straße 36, 47259
Duisburg, statt. Der nächste Termin ist am 15. Juni von 15.00 bis
16.30 Uhr. Menschen, die nahe stehende Angehörige oder Freunde
verloren haben, können sich hier für die bevorstehenden Wochen
stärken und ihre Erfahrungen mit anderen Betroffenen austauschen.
Begleitet wird das Trauercafé von den geschulten und erfahrenen
Mitarbeitenden des Malteser Hospizzentrum St. Raphael. Eine
Anmeldung für das Trauercafé ist nicht notwendig.
Lediglich 44 Prozent der
Beschäftigten in der Privatwirtschaft erhalten Urlaubsgeld – in
tarifgebundenen Betrieben ist der Anteil mit 72 Prozent deutlich
höher
In den letzten Jahren sind Reisen und Unterkünfte
fast überall deutlich teurer geworden. Für viele Beschäftigte ist
deshalb das zumeist im Juni oder Juli ausgezahlte Urlaubsgeld ein
wichtiger Faktor, um sich den wohlverdienten Jahresurlaub leisten zu
können. Allerdings erhält mit 44 Prozent noch nicht einmal die
Hälfte aller Beschäftigten in der Privatwirtschaft Urlaubsgeld.
Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Online-Befragung des
Internet-Portals Lohnspiegel.de, das vom Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung
betreut wird. Für die Analyse wurden die Angaben von mehr als 67.000
Beschäftigten aus dem Zeitraum von Anfang Mai 2024 bis Ende April
2025 ausgewertet.
Ob Beschäftigte Urlaubsgeld erhalten oder
nicht, hängt von mehreren Faktoren ab. Der mit Abstand wichtigste
ist, ob im Betrieb ein Tarifvertrag gilt: In tarifgebundenen
Betrieben der Privatwirtschaft erhalten 72 Prozent der Befragten
Urlaubsgeld, verglichen mit 34 Prozent in Betrieben ohne
Tarifvertrag.
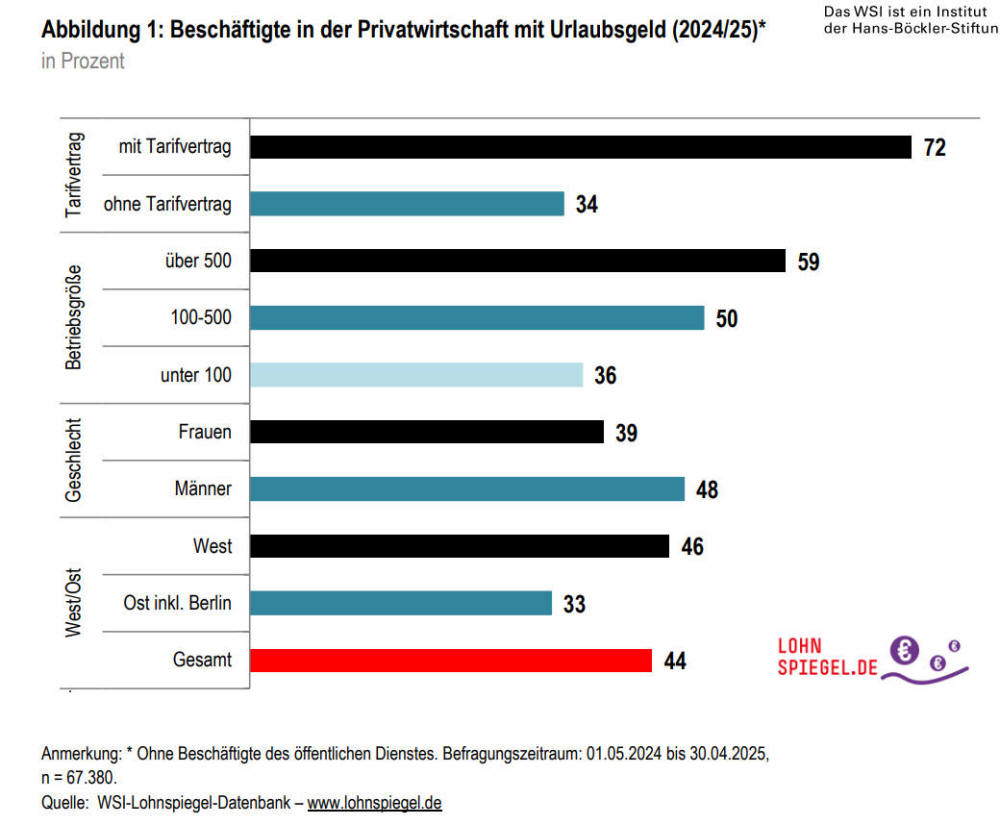
„Wer in einem Betrieb mit Tarifvertrag arbeitet, hat also
deutlich bessere Aussichten auf Urlaubsgeld. Zugleich ist in
tarifgebundenen Betrieben in der Regel auch das Grundgehalt höher
als ohne Tarifvertrag“, sagt WSI-Lohnexperte Dr. Malte Lübker.
„Tarifverträge lohnen sich also für die Beschäftigten nicht nur zur
Urlaubszeit, sondern das ganze Jahr über.“
Einfluss von
Beschäftigten- und Betriebsmerkmalen auf das Urlaubsgeld
Neben
der Tarifbindung gibt es eine Reihe weiterer Strukturmerkmale, die
die Zahlung von Urlaubsgeld beeinflussen (ebenfalls Abbildung 1 in
der pdf-Version). Ein wichtiges Merkmal ist z. B. die Betriebsgröße.
Demnach erhalten 59 Prozent der Arbeitnehmer*innen in
Großunternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten Urlaubsgeld gegenüber
lediglich 36 Prozent in kleineren Betrieben mit weniger als 100
Beschäftigten.
Auch der regionale Standort der Unternehmen
spielt eine wichtige Rolle: So ist die Wahrscheinlichkeit, in
Westdeutschland Urlaubsgeld zu erhalten, mit 46 Prozent der
Beschäftigten deutlich höher als in Ostdeutschland mit 33 Prozent.
Sowohl bei der Betriebsgröße als auch bei dem regionalen Standort
spielt wiederum auch die Tarifbindung eine wichtige Rolle, da
größere Unternehmen wesentlich häufiger tarifgebunden sind und die
Tarifbindung in Ostdeutschland immer noch unter dem westdeutschen
Niveau liegt.
Schließlich haben Frauen mit 39 Prozent
deutlich seltener Aussicht auf Urlaubsgeld als Männer mit 48
Prozent. Dies lässt sich im Wesentlichen auf eine für Frauen
ungünstige Verteilung der Beschäftigtenzahlen nach Betriebsgrößen
und Berufsgruppen zurückführen. „Die Zahlen machen deutlich, dass
eine höhere Tarifbindung ein wichtiger Faktor ist, um die
Ungleichheit am Arbeitsmarkt zu reduzieren“, sagt Prof. Dr. Bettina
Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin des WSI.
Große
Unterschiede in der Höhe des tariflichen Urlaubsgeldes
Wie hoch
das tarifliche Urlaubsgeld ausfällt, hängt von den genauen
Regelungen in den einzelnen Tarifverträgen ab. Diese unterscheiden
sich zum Teil erheblich: Die Spannbreite reicht von 186 Euro für die
Beschäftigten in der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern bis zu
2.820 Euro für die Angestellten der Holz und Kunststoff
verarbeitenden Industrie im Tarifbezirk Westfalen-Lippe.
Dies zeigt eine aktuelle Auswertung des WSI-Tarifarchivs für
ausgewählte Tarifbranchen. Die Angaben beziehen sich jeweils auf
Beschäftigte in der mittleren Vergütungsgruppe (ohne
Berücksichtigung von Zulagen/Zuschlägen, bezogen auf die Endstufe
der Urlaubsdauer). In den meisten Tarifbereichen ist die Höhe des
Urlaubsgeldes vom Tarifentgelt abhängig, in einigen Bereichen wird
hingegen lediglich ein pauschaler Betrag bezahlt.
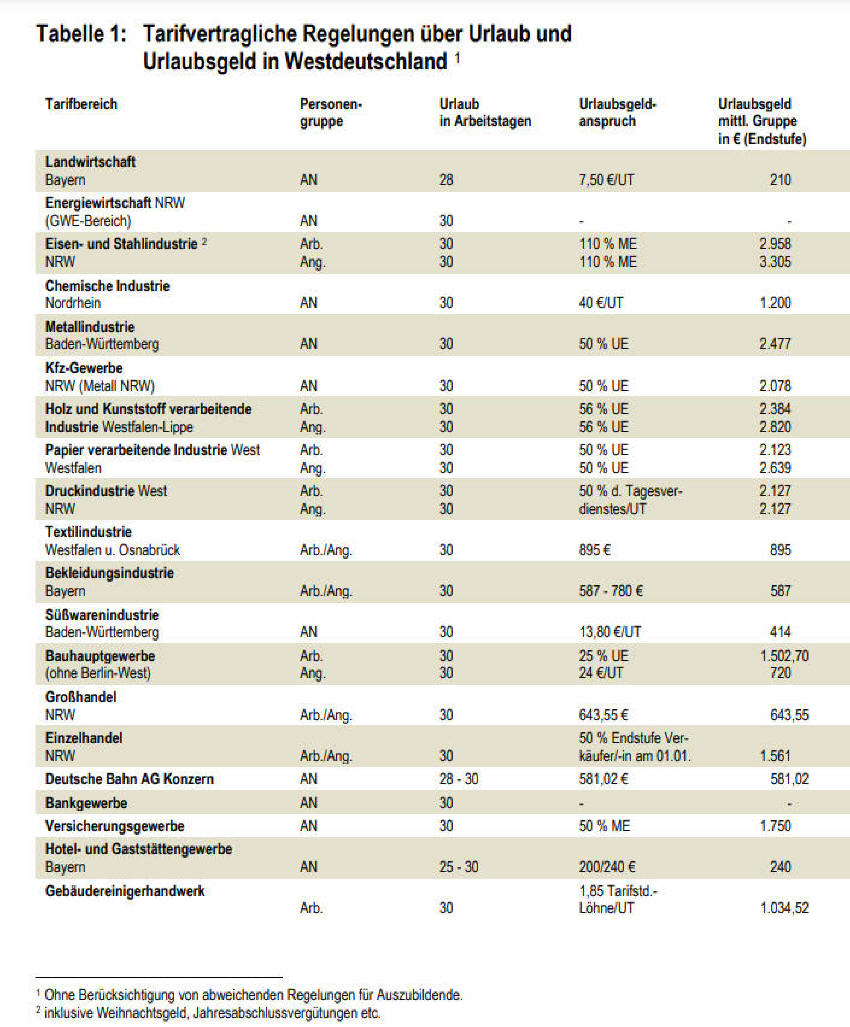
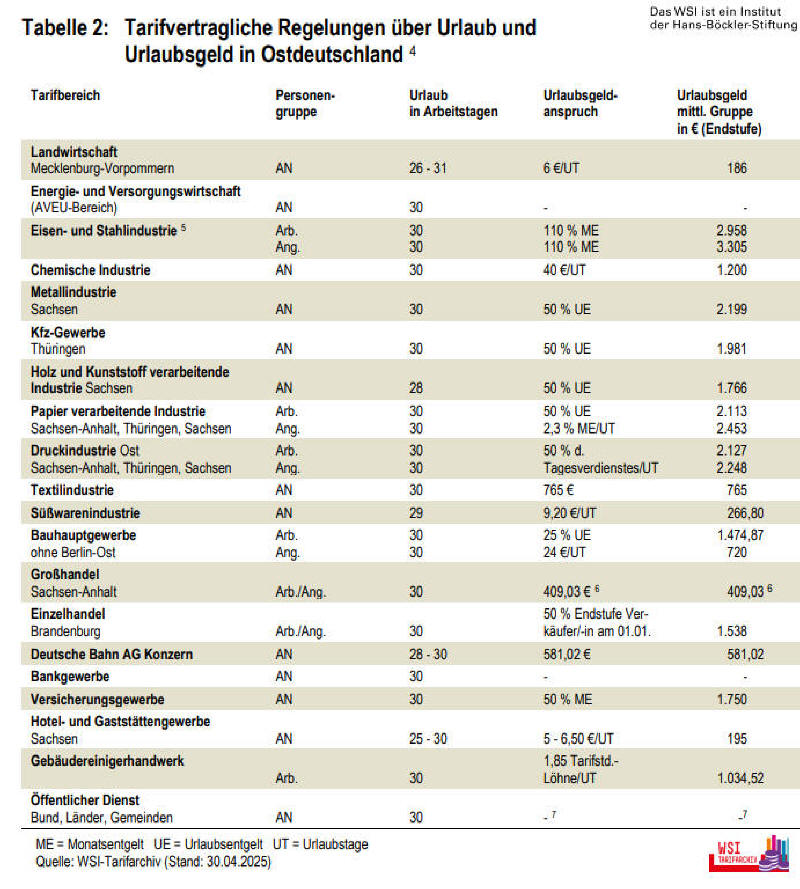
„Überall dort, wo vergleichsweise hohe Tariflöhne gezahlt
werden, fällt auch das Urlaubsgeld deutlich üppiger aus“, sagt der
Leiter des WSI-Tarifarchivs, Prof. Dr. Thorsten Schulten. „In den
klassischen Niedriglohnbranchen wird hingegen in der Regel nicht nur
ein niedrigeres Urlaubsgeld gezahlt. Die Chance, überhaupt eine
entsprechende Sonderzahlung zu erhalten, ist aufgrund der
niedrigeren Tarifbindung auch deutlich geringer“, so Schulten.
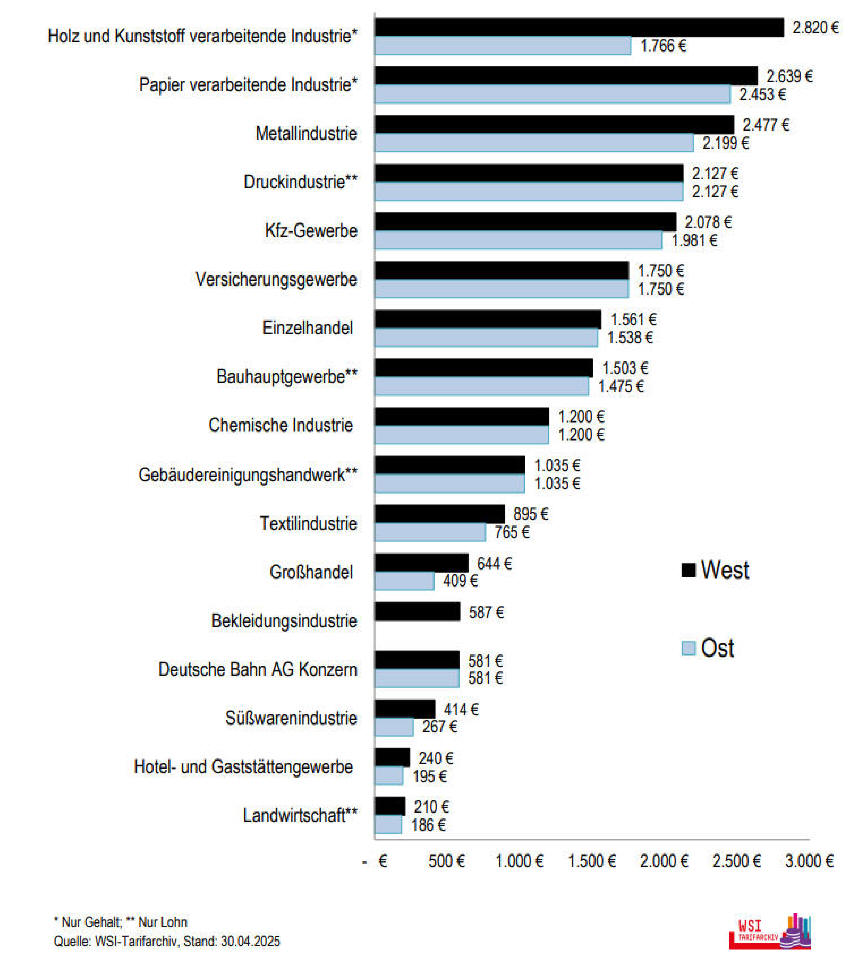
Zu den Branchen mit relativ niedrigem Urlaubsgeld gehört neben
der Landwirtschaft auch das Hotel- und Gaststättengewerbe. In Bayern
erhalten Tarifbeschäftigte dort 240 Euro extra, in Sachsen sind es
195 Euro. Mit Beträgen zwischen 1.000 und 2.500 Euro sind die
Sonderzahlungen demgegenüber z. B. in der Papier verarbeitenden
Industrie, in der Metallindustrie, in der Druckindustrie, im
Kfz-Gewerbe, im Versicherungsgewerbe, im Einzelhandel, im
Bauhauptgewerbe und in der Chemischen Industrie erheblich höher.
In einigen Branchen oder Großunternehmen, in denen bundesweite
Tarifverträge gelten, gibt es auch beim Urlaubsgeld keine
Ost-West-Unterschiede mehr. Hierzu zählen etwa das
Versicherungsgewerbe, das Gebäudereinigungshandwerk und die Deutsche
Bahn AG. Auch in der Druckindustrie und der Chemischen Industrie
gibt es ein einheitliches Urlaubsgeld.
In Branchen, in denen
regional differenzierte Tarifverträge abgeschlossen werden, bestehen
hingegen auch bei der Höhe des Urlaubsgeldes regionale Unterschiede.
Besonders ausgeprägt sind die Unterschiede in der Holz und
Kunststoff verarbeitenden Industrie.
Im öffentlichen Dienst
gibt es kein gesondertes Urlaubsgeld mehr, da dies seit der
Tarifreform des Jahres 2005 zusammen mit dem Weihnachtsgeld als
einheitliche Jahressonderzahlung im November ausgezahlt wird. Auch
im Bankgewerbe und in einigen Branchentarifverträgen der
Energiewirtschaft gibt es kein tarifliches Urlaubsgeld. Eine
Besonderheit gilt in der Eisen- und Stahlindustrie: Dort ist die
Höhe der jährlichen Sonderzahlungen auf insgesamt 110 Prozent einer
Monatsvergütung festgelegt – wobei offengelassen wird, wie sich dies
auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verteilt.
In 11 von 17 hier
untersuchten Branchen mit tariflichem Urlaubsgeld hat sich dieses
gegenüber dem Vorjahr erhöht. Steigerungen gab es insbesondere in
jenen Branchen, in denen das Urlaubsgeld als Prozentsatz der
Tarifentgelte festgelegt wird und in denen Tarifverhandlungen
stattfanden. Am stärksten wurde das Urlaubsgeld mit 8,1 Prozent für
die Arbeiter*innen im Bauhauptgewerbe angehoben. In den übrigen
Branchen stieg das Urlaubsgeld zwischen 3,0 und 5,5 Prozent.
Neben einem Plus an Geld begründen Tarifverträge auch einen Anspruch
auf mehr Urlaubstage: Während Beschäftigten nach dem
Bundesurlaubsgesetz nur 20 Tage Jahresurlaub zustehen (bei einer 5
Tage Woche), liegt der Standard in Tarifverträgen – mit wenigen
Ausnahmen – bei 30 Tagen bezahltem Urlaub pro Jahr (vgl. Tabellen 1
und 2).
Große Begegnung und leise
Töne beim Ökumenischen Pfingst-Gottesdienst im Landschaftspark
Auch in diesem Jahr laden evangelische und katholische
Kirchengemeinden aus dem Duisburger Norden wieder zum
Open-Air-Gottesdienst am Pfingstmontag in die Gießhalle im
Landschaftspark Nord ein.
Die ökumenische Feier am 9. Juni steht
unter der poetischen Überschrift „Gott ist in den leisen Tönen“.
Pfarrer Frank Hufschmidt predigt zur Bibelstelle 1. Könige
19,11-13 unter der Überschrift „Leise Töne“ und das ökumenische
Vorbereitungsteam unter der Leitung von Christa Scholten-Herbst wird
mit Fächern überraschen, die die Aufschrift „Gott ist in den leisen
Tönen“ tragen – es darf gebastelt werden. Die passenden,
harmonischen Töne zum ökumenischen Gottesdienst finden wieder der
Chor „Unisono“ und die Band St. Hildegard unter der Leitung von
Markus Kämmerling.
Der Gottesdienst beginnt um 12 Uhr,
Einlass ist um 11.30 Uhr. Am Eingang werden die Besucherinnen und
Besucher mit festlicher Posaunenmusik empfangen. In den letzten
Jahren kamen jeweils rund 500 Menschen zu diesem
Gemeinschaftserlebnis zur Gießhalle.

Ökumenischer Pfingst-Gottesdienst im Landschaftspark 2022 (Foto:
Bartosz Galus).
Kirchenkneipe in Neudorf -
Gemeinde lädt zum Auspannen ein
Am Freitag, 13. Juni
2025 gibt es in der Evangelischen Kirchengemeinde Hochfeld-Neudorf
eine gute Gelegenheit zum Auspannen und zum gemütlichen
Wochenausklang: Um 18 Uhr geht es in Gemeinschaft mit anderen beim
Klönen um Gott und die Welt, denn im Gemeindezentrum an der
Gustav-Adolf-Str. 65 öffnet wieder die Kirchenkneipe. Engagierte,
die die Aktion vorbereiten, laden herzlich zum Klönen ein. Infos zur
Gemeinde gibt es im Netz unter
www.hochfeld-neudorf.de
Zweitägiges Gemeindefest rund um den Kirchturm am
Ostacker – mit Abschied von Pfarrer Klemm
Zum
traditionellen Gemeindefest rund um den Turm der Markuskirche am
Ostackerweg 75 lädt die Evangelische Kirchengemeinde Ruhrort-Beeck
auch in diesem Jahr ein. Das Fest steigt am Samstag, 14. Juni 2025
um 15 Uhr, wenn es im Biergarten Getränke, Gegrilltes, Kaffee und
Waffeln gibt und von der Bühne Musik von den „Stellwerkern“,
„Monster Of Liedernachspieling“, „Green Lemonade“ den „Wahren
Freuenden“ Gute-Laune-Musik zum Tanzen, Hören und Mitsingen
erklingt.
Am Sonntag, 15. Juni geht es mit dem
Open-Air-Gottesdienst um 10.30 Uhr weiter, bei dem Pfarrer Rüdiger
Klemm festlich in den Ruhestand verabschiedet wird. Ab 11.30 Uhr
übernehmen die Jüngeren die Gemeindewiese mit Spiel und Spaß in
Beschlag und das Bühnenprogramm mit Tanz und Tombola startet.
Zum Genuss kommen internationale Leckereien und natürlich
Kaffee, Kuchen und Waffeln hinzu. Der Erlös wird für die Suppenküche
der Gemeinde, die Erneuerung der Bestuhlung im Café und die
Umgestaltung des Kirchplatzes verwendet. Ein Teil des Erlöses geht
an das Frauenhaus Duisburg, der andere zur Erhaltung der
Markuskirche. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.ruhrort-beeck.ekir.de.
Pfarrerin Esther Immer am
Service-Telefon der evangelischen Kirche in Duisburg
„Zu welcher Gemeinde gehöre ich?“ oder „Wie kann ich in die Kirche
eintreten?“ oder „Holt die Diakonie auch Möbel ab?“: Antworten auf
Fragen dieser Art erhalten Anrufende beim kostenfreien
Servicetelefon der evangelischen Kirche in Duisburg.
Es ist
unter der Rufnummer 0800 / 12131213 auch immer montags von 18 bis 20
Uhr besetzt, und dann geben Pfarrerinnen und Pfarrer Antworten auf
Fragen rund um die kirchliche Arbeit und haben als Seelsorgende ein
offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das Service-Telefon ist am Montag,
9. Juni 2025 von Esther Immer, Pfarrerin in der Evangelischen
Kirchengemeinde Obermeiderich und Seelsorgerin den Evangelischen
Diensten Duisburg, besetzt.

Stromerzeugung im 1. Quartal 2025 mehrheitlich aus
fossilen Quellen
Insgesamt 1,9 % weniger Strom ins Netz
eingespeist als im Vorjahresquartal –Stromimporte steigen um 14,9 %,
Exporte sinken leicht um 3,0 %
Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien sinkt um 17,0 %, konventionelle Stromerzeugung
steigt um 19,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal Stromerzeugung aus
Windkraft sinkt im Vorjahresvergleich um 29,2 %, demgegenüber 15,3 %
mehr Kohlestrom.
Im 1. Quartal 2025 wurden in Deutschland
119,4 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert und in das
Stromnetz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,9 % weniger Strom
als im 1. Quartal 2024 (121,7 Milliarden Kilowattstunden). Etwas
mehr als die Hälfte des inländisch erzeugten Stroms (50,5 %) stammte
aus konventionellen Energieträgern.
Insgesamt stieg die
Stromerzeugung aus diesen fossilen Quellen gegenüber dem
Vorjahresquartal um 19,3 % auf 60,2 Milliarden Kilowattstunden. Im
1. Quartal 2024 hatte der Anteil der Stromerzeugung aus fossilen
Quellen noch bei 41,5 % gelegen.
Demgegenüber sank die
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im 1. Quartal 2025 im
Vergleich zum Vorjahresquartal um 17,0 % auf 59,1 Milliarden
Kilowattstunden und einen Anteil von 49,5 % an der gesamten
inländischen Stromproduktion (1. Quartal 2024: 58,5 %).
Damit war die Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern im
1. Quartal 2025 erstmals seit dem 1. Quartal 2023 höher als die
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.
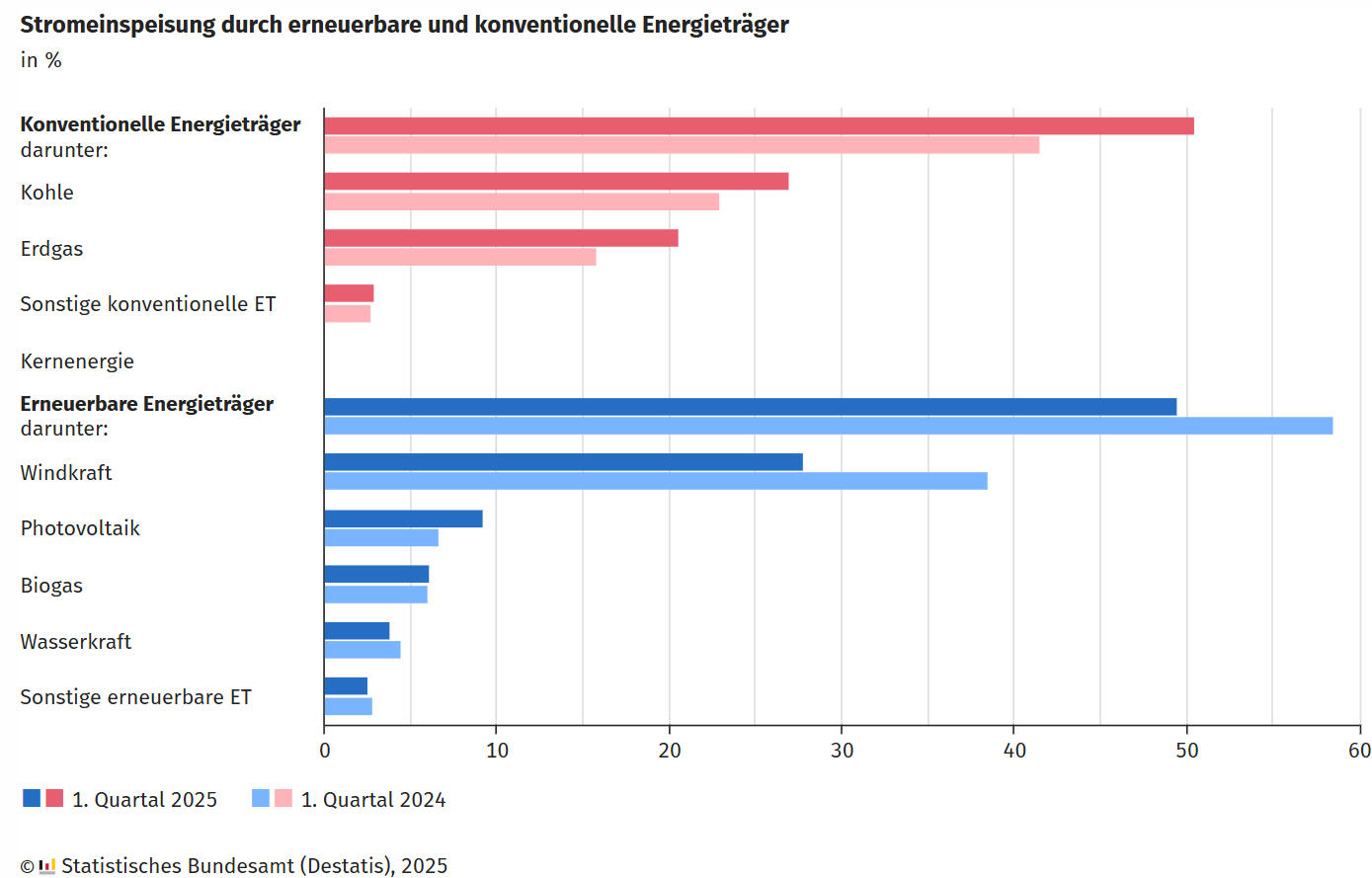
Windarmes Quartal führt zu Rückgang der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien Der Rückgang der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien im 1. Quartal 2025 lag vor allem an einer
deutlichen Abnahme der Stromerzeugung aus Windkraft. Im Vergleich
zum Vorjahresquartal sank die Stromproduktion aus Windkraft um
29,2 % auf 33,2 Milliarden Kilowattstunden, wodurch ihr Anteil am
gesamten inländisch produzierten Strommix auf 27,8 % fiel
(1. Quartal 2024: 38,5 %).
Maßgebliche Ursache für den
Rückgang war ein außergewöhnlich windarmes erstes Quartal.
Einen ähnlich niedrigen Anteil von Windenergie an der Stromerzeugung
in einem 1. Quartal hatte es zuletzt 2021 mit 24,2 % gegeben.
Trotzdem war Windkraft im 1. Quartal 2025 weiterhin der wichtigste
Energieträger zur Stromerzeugung.
Im Gegensatz zur
Windenergie stieg die Stromerzeugung aus Photovoltaik im Vergleich
zum Vorjahresquartal um 34,6 % auf 11,0 Milliarden Kilowattstunden.
Damit erhöhte sich ihr Anteil am gesamten Strommix auf 9,2 %
(1. Quartal 2024: 6,7 %). Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern
steigt – Kohle nur knapp hinter Windkraft
Die niedrigere
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wurde im 1. Quartal
2025 überwiegend durch den Betrieb konventioneller Kraftwerke
ausgeglichen. Bei den fossilen Energien stieg die Stromerzeugung aus
Erdgas im Vergleich zum Vorjahresquartal besonders stark um 27,5 %
auf 24,6 Milliarden Kilowattstunden.
Damit erreichte Erdgas
einen Anteil von 20,6 % an der gesamten inländischen Stromerzeugung
(1. Quartal 2024: 15,8 %). Auch die Stromproduktion aus Kohle legte
spürbar zu: Sie stieg gegenüber dem 1. Quartal 2024 um 15,3 % auf
32,3 Milliarden Kilowattstunden. Damit machte Kohle 27,0 % am
Energiemix bei der Stromerzeugung aus (1. Quartal 2024: 23,0 %) und
lag nur knapp unter dem Anteil der Windenergie.
Mehr
Stromimporte als -exporte im 1. Quartal 2025 Im 1. Quartal 2025
verzeichnete Deutschland einen Anstieg der Stromimporte um 14,9 %
gegenüber dem Vorjahresquartal. Insgesamt wurden 19,3 Milliarden
Kilowattstunden Strom importiert (1. Quartal 2024: 16,8 Milliarden
Kilowattstunden). Die Stromexporte gingen dagegen um 3 % zurück auf
16,2 Milliarden Kilowattstunden (1. Quartal 2024: 16,7 Milliarden
Kilowattstunden).
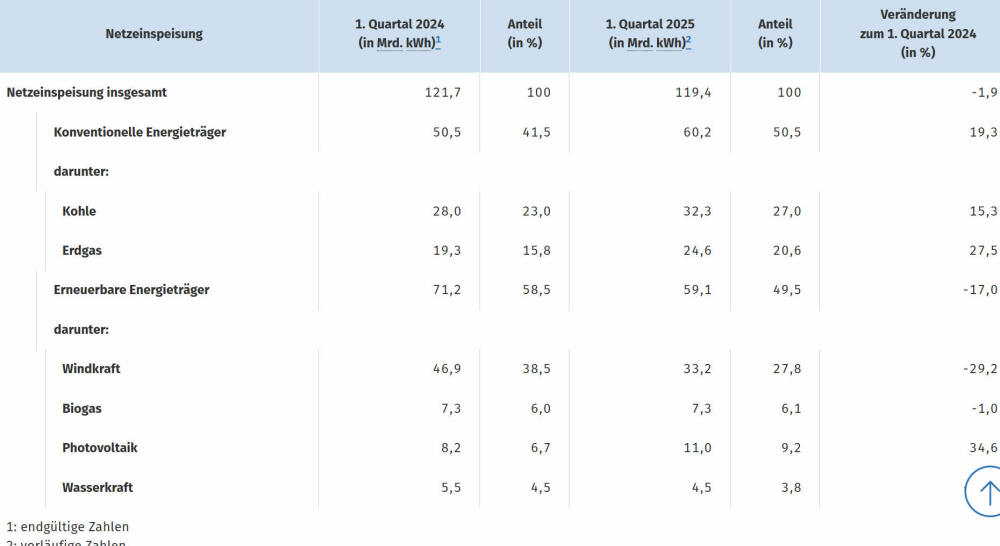
Fast 2,5 Stunden mehr Zeit für Freizeitaktivitäten an
Wochenenden als unter der Woche
• Personen ab 10 Jahren
verbringen an Wochenenden und Feiertagen im Schnitt gut 7,5 Stunden
mit Freizeitaktivitäten, an Werktagen knapp 5,5 Stunden
• Männer
wenden mehr Zeit für Freizeitaktivitäten auf als Frauen
• Rund
ein Drittel der Freizeit wird mit Fernsehen verbracht
Ob
drinnen oder draußen, ob aktiv oder entspannt: Viele Menschen in
Deutschland genießen am langen Pfingstwochenende ihre Freizeit. Im
Schnitt verbringen Personen ab 10 Jahren an Wochenenden und
Feiertagen 7 Stunden und 45 Minuten am Tag mit Freizeitaktivitäten.
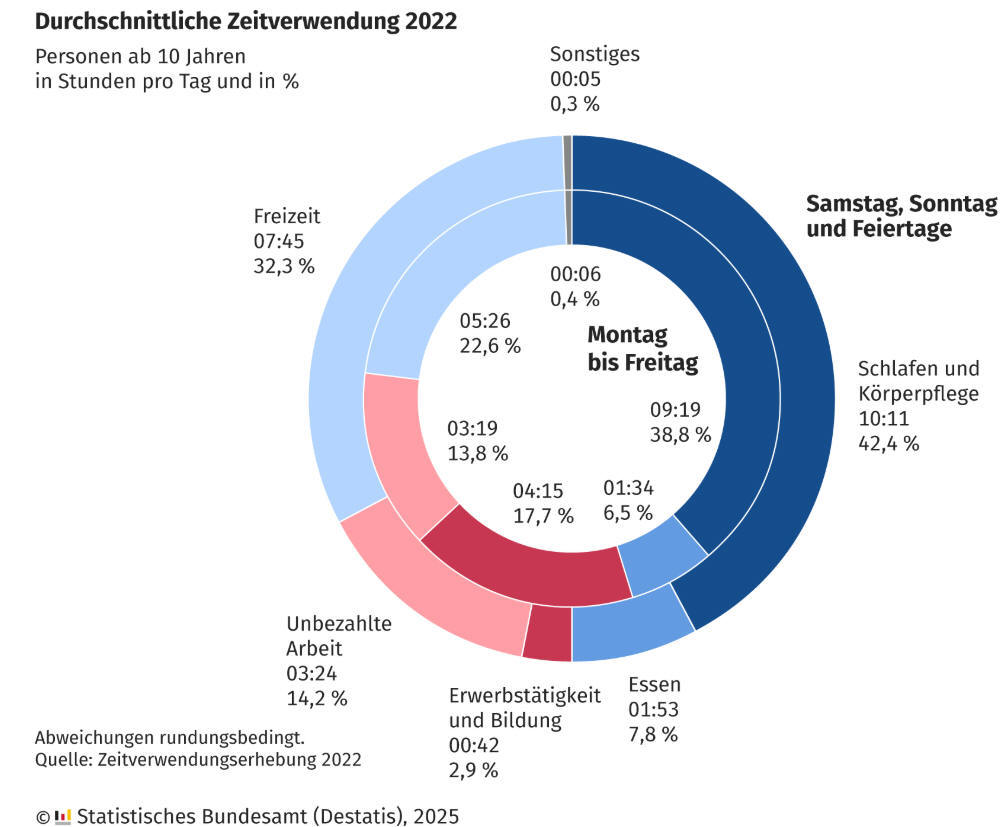
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach revidierten
Ergebnissen der Zeitverwendungserhebung 2022 mitteilt, sind das fast
2,5 Stunden mehr als unter der Woche (5 Stunden und 26 Minuten
montags bis freitags). Zu den Freizeitaktivitäten zählen unter
anderem die Mediennutzung (etwa Fernsehen oder Lesen), Sport, Hobbys
sowie die Pflege sozialer Kontakte. Bei den Zeitangaben ist zu
berücksichtigen, dass es sich um Durchschnittswerte beispielsweise
über Jung und Alt, Männer und Frauen, Erwerbstätige und
Nichterwerbstätige handelt.
Männer und Jungen wenden mehr
Zeit für Freizeit auf als Frauen und Mädchen
Männer und Jungen
ab 10 Jahren verbringen an Wochenenden und Feiertagen im Schnitt
8 Stunden und 5 Minuten mit Freizeitaktivitäten. Frauen und Mädchen
ab 10 Jahren wenden hingegen mit 7 Stunden und 23 Minuten weniger
Zeit dafür auf.
Auch unter der Woche verbringen Männer und
Jungen mit 5 Stunden und 38 Minuten durchschnittlich mehr Zeit mit
Freizeitaktivitäten als Frauen und Mädchen mit 5 Stunden und
17 Minuten. Der Unterschied ist unter der Woche mit durchschnittlich
21 Minuten jedoch deutlich geringer als an Wochenenden und
Feiertagen mit 42 Minuten.
Rund ein Drittel der Freizeit
wird mit Fernsehen verbracht Betrachtet man sowohl Werktage als auch
Wochenend- und Feiertage zusammen, verbringen Personen
ab 10 Jahren im Schnitt 6 Stunden und 9 Minuten am Tag mit
Freizeitaktivitäten. Dabei wird rund ein Drittel dieser Zeit
(2 Stunden und 7 Minuten) mit Fernsehen und Streaming verbracht.
Für soziale Kontakte und Geselligkeit wie Gespräche und
Telefonate einschließlich der Nutzung sozialer Medien, Besuch
empfangen, private Treffen oder Ausgehen in Cafés wird im Schnitt
1 Stunde und 15 Minuten pro Tag aufgewendet. Mit kulturellen
Tätigkeiten wie Lesen, Musik hören, Kino oder Ausflüge werden im
Schnitt 53 Minuten pro Tag verbracht. Jeweils gut eine halbe Stunde
wird für Sport sowie die Nutzung von Computern und Smartphones (ohne
Kommunikation) aufgewendet.