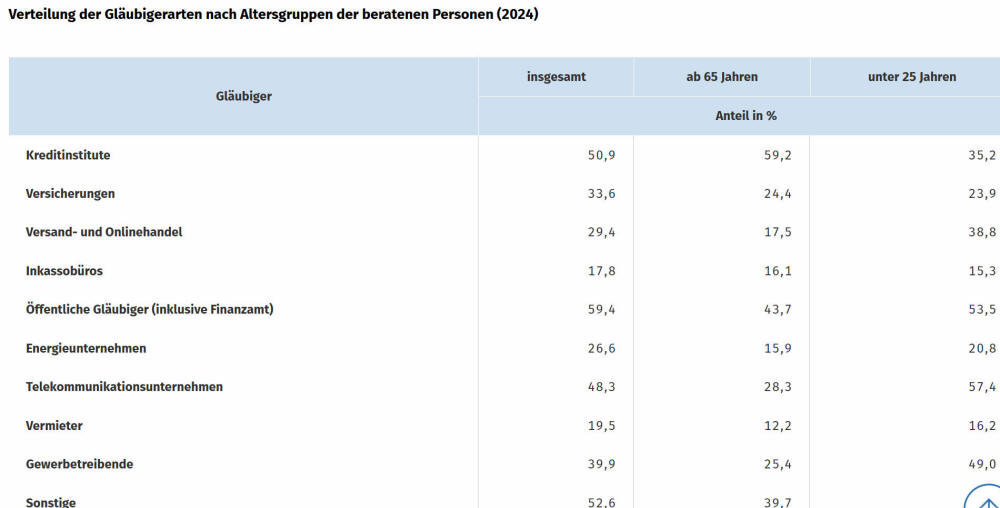|
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 25. Kalenderwoche:
18. Juni
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 19. Juni 2025
Reger Reiseverkehr rund um Fronleichnam
Stauprognose für den 18. bis 22. Juni / Ferienende in
Bayern und Baden-Württemberg

© imago images/Wolfgang Maria Weber
Auf den deutschen
Autobahnen droht ab Mitte der Woche zeitweise dichter Verkehr.
Anlass ist der Feiertag Fronleichnam am Donnerstag, der in mehreren
Bundesländern arbeitsfrei ist, darunter Bayern, Baden-Württemberg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, Teile
Sachsens und Thüringens.
Viele nutzen die Gelegenheit für einen
Kurzurlaub. Der ADAC rechnet bereits ab Mittwochnachmittag mit einem
deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Fernstraßen.
Außerdem enden in Bayern und Baden-Württemberg die zweiwöchigen
Pfingstferien, weshalb sich am Samstag besonders viele Urlauber auf
dem Heimweg befinden werden. Der Rückreiseverkehr erreicht dann
seinen Höhepunkt. Vor allem auf den Routen in Richtung Norden muss
mit Staus gerechnet werden.
Auch am Sonntagnachmittag wird es
auf den Autobahnen voll werden. Dann kehren zahlreiche Kurzurlauber
zurück. Besonders betroffen sind erneut die Fernstraßen im Süden
sowie die Autobahnen rund um die Ballungsräume.
Der Mittwoch
vor Fronleichnam (29./30. Mai) zählte 2024 zu den zehn staureichsten
Tagen des Jahres. Auch diesmal dürfte der Mittwoch der
verkehrsreichste Tag der Woche werden. Vergleichsweise ruhig wird
hingegen der Freitag bleiben.
Besonders belastete Strecken
(in beiden Richtungen):
Fernstraßen zur und von der Nord- und
Ostsee
A1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen –
Hamburg
A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg
A1/A3/A4 Kölner Ring
A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt –
Oberhausen
A4 Görlitz – Dresden – Chemnitz
A5 Basel –
Karlsruhe – Heidelberg
A6 Nürnberg – Heilbronn – Mannheim
A7
Flensburg – Hamburg / Füssen – Ulm – Würzburg
A8 Salzburg –
München – Stuttgart – Karlsruhe
A9 München – Nürnberg – Leipzig
A10 Berliner Ring
A24 Hamburg – Berliner Ring
A61
Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen
A81 Singen – Stuttgart –
Heilbronn
A93 Kufstein – Inntaldreieck
A95/B2
Garmisch-Partenkirchen – München
A96 Lindau – München
A99
Umfahrung München
Auch im benachbarten Ausland gerät der
Reiseverkehr zeitweise ins Stocken. In Österreich und der Schweiz
ist Fronleichnam ebenfalls ein Feiertag. Insbesondere auf den
klassischen Urlauberrouten wie der Brenner-, Inntal-, und
Tauernautobahn,- sowie der Schweizer Gotthard-Route besteht
Staugefahr.
Auch Rückreisende aus Kroatien müssen auf den
Fernstraßen Richtung Deutschland mit Verzögerungen rechnen. An den
Grenzübergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93)
kann es bei der Einreise nach Deutschland zu längeren Wartezeiten
kommen.
Chance für Straßen, Schienen, Schleusen
NRW braucht Sondervermögen der Bundesregierung
Duisburg – einer der wichtigsten Logistik-Standorte in
Europa. Mit dem größten Binnenhafen der Welt. Eine marode
Infrastruktur zeigt sich hier besonders schnell. Staus und gesperrte
Brücken belasten die Wirtschaft an Rhein und Ruhr. Beim
Verkehrspolitischen Talk der IHK NRW mit Minister Oliver Krischer in
Duisburg ging es darum, wie die Mobilität schnell verbessert werden
kann. Denn die Unternehmer blicken voller Sorge auf die Situation.
„Unsere Brücken in Nordrhein-Westfalen bröckeln. An Rhein
und Ruhr gibt es besonders viele davon. Damit unsere Region ein
Hotspot für Logistik bleibt, muss mehr Geld fließen in Straßen,
Schienen und Schleusen“, betonte Werner Schaurte-Küppers, Präsident
der Niederrheinischen IHK.
Schaurte-Küppers sieht das
Sondervermögen der Bundesregierung als Chance für NRW: „Die
Bundesregierung sollte dort investieren, wo das Geld am dringendsten
benötigt wird. Und wo es am besten Wirkung entfalten kann: bei uns
in NRW. Der Güterverkehr leidet unter der schlechten Infrastruktur.
Auch für Dienstleister und Kunden sind Staus und Umwege unzumutbar.
Sie verlieren Zeit und Geld. Diese Verschwendung ist unnötig.“
In der Diskussion machten Experten deutlich: Die Logistik
befindet sich im Wandel. Grün, innovativ und smart zu werden, ist
das Ziel der Branche. Damit das gelingt, muss die Basis stimmen.
„Am Niederrhein und in NRW gibt es viel zu tun bei der
Verkehrs-Infrastruktur. Unsere Unternehmen stehen bereit, den
NRW-Verkehrsminister bei seinen Initiativen in Berlin zu
unterstützen“, so der IHK-Präsident.
Verkehrsminister Oliver
Krischer machte deutlich, dass das Sondervermögen alleine nicht
ausreiche. Es brauche einfache, pragmatische Zugänge zu den Mitteln,
konkrete Bedarfe müssten frühzeitig benannt werden, um
handlungsfähig zu sein. Zudem warb Krischer für einen dauerhaften
Infrastrukturfonds, um langfristig planen und investieren zu können.
Projekte in den Schubladen gebe es genug – jetzt komme es auf den
politischen Willen und die schnelle Umsetzung an.
Forderungen der IHKs in NRW an Landesregierung
Beim
Verkehrspolitischen Talk in Duisburg überreichte Ralf Stoffels,
Präsident von IHK NRW, die Forderungen der Wirtschaft an Minister
Krischer. Das Land müsse die Verkehrsnetze stärken. Neben einer
verlässlichen Finanzierung brauche es auch schnellere Verfahren für
Planung und Genehmigung. Um Kommunen bei Großprojekten zu
unterstützen, soll eine eigene Planungs- und Projektgesellschaft
entstehen. Etwas Ähnliches gibt es bereits auf Bundesebene. Darüber
hinaus heißt es: mehr Anreize für Unternehmen schaffen, damit sie
investieren. Verkehrsträger stärker vernetzen. Und Möglichkeiten
schaffen, Wasserstoff und Strom zu laden.

Beim Verkehrspolitischen Talk von IHK NRW in Duisburg diskutierten
Ralf Stoffels (Präsident IHK NRW, r.) und Werner Schaurte-Küppers
(Präsident Niederrheinische IHK, M.) mit NRW-Verkehrsminister Oliver
Krischer (l.), wie Straßen, Schienen und Schleusen schnell
verbessert werden können. Journalistin Désirée Rösch führte durch
die Veranstaltung. Foto: Niederrheinische IHK/Bettina Engel-Albustin
Die DVG weicht für Straßenbauarbeiten in Homberg vom Linienweg
ab
Von Montag, 23. Juni, circa 6 Uhr, bis voraussichtlich
Freitag, 18. Juli, Betriebsende, müssen die Busse der Linie 923 der
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) in Duisburg-Homberg eine
Umleitung fahren. Grund hierfür sind Straßenbauarbeiten auf der
Hochfeldstraße, weshalb diese gesperrt wird.
Linie 923: In
Fahrtrichtung Dubliner Straße fahren die Busse ab der Haltestelle
„Zollstraße“ eine örtliche Umleitung über die Rheindeichstraße und
Lauerstraße. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle
„Stadtbad Homberg“ wird auf die Rheindeichstraße vor die Zufahrt zur
Hochfeldstraße verlegt. Die Haltestelle „Margarethenstraße“
entfällt.
Die DVG bittet die Fahrgäste die
Ersatzhaltestellen „Stadtbad Homberg“ und „Verbandstraße“ zu nutzen.
Die Haltestelle „Verbandstraße“ wird auf die Lauerstraße hinter die
Kreuzung Hochfeldstraße verlegt. In Gegenrichtung wird die Umleitung
sinngemäß gefahren.
Aakerfährbrücke:
Informationstafeln eingeweiht
An den denkmalgeschützten Brückenköpfen der Aakerfährbrücke
in Duisburg-Duissern wurden neue Informationstafeln eingeweiht. Die
Tafeln befinden sich unterhalb der historischen Brückenköpfe und
erinnern an die zwischen 1902 und 1904 gebaute erste feste
Ruhrquerung an dieser Stelle.

Informationstafeln zum Denkmal „Brückenköpfe“ der Aakerfährbrücke
eingeweiht. Mit den Tafeln wird die historische Bedeutung und
Entwicklung der Aakerfährbrücke sichtbar. Die Brückenköpfe sind die
letzten baulichen Erinnerungen an die ursprünglich erbaute
Aakerfährbrücke aus dem Jahr 1904. Foto Ilja Höpping / Stadt
Duisburg
Die Brückenköpfe sind die letzten baulichen
Erinnerungen an das ursprüngliche Brückenbauwerk aus dem Jahr 1904,
das 1997 durch die heutige Konstruktion ersetzt wurde. Die
Aakerfährbrücke ersetzte die 1359 erstmalig erwähnte Fährverbindung
(„Aakerfähre“) zwischen den Orten Meiderich und Duisburg.
Als die Hafenanlagen und die Eisenbahnlinien mit dem ungeheuren
Wachstum der Industrie im 19. Jahrhundert erweitert wurden, war ein
hochwasserfreier, fester Flussübergang erforderlich. Die
Brückenbaugesellschaft Harkort aus Duisburg baute eine dreibogige
Eisenfachwerkbrücke mit angehängter, leicht parabolisch überhöhter
Fahrbahn nach Plänen des Berliner Architekten Bruno Möhring – nach
damals modernstem Verfahren.
Die Auflager auf den massiven
Flusspfeilern und die Vorlandbrücken erhielten einen Betonkern mit
einer Werksteinummantelung. Jeweils am Übergang der Vorlandbrücken
zur Bogenbrücke flankierten grotesk gestaltete Pfeilerköpfe mit
Adlermotiv den Weg. Mit nur geringen Schäden überstand die
Aakerfährbrücke, als eine der wenigen historischen Brücken dieser
Art den Zweiten Weltkrieg und wurde noch bis 1995 genutzt.

Bezirksbürgermeisterin Elvira Ulitzka und Mitglieder der
Bezirksvertretung Mitte haben die Informationstafeln eingeweiht. Sie
sollen allen Bürgerinnen und Bürgern die Geschichte der Brücke
näherbringen und auch Radfahrenden auf dem Ruhrtalradweg spannende
Informationen bieten. Die Schilder wurden vom Duisburg-Neudorfer
Ulrich Petersen (Dritter von rechts in blauer Jacke) angefertigt und
hergestellt.
Masterplan 2.0 Bürgerbeteiligung der Smart City Initiative
Der Masterplan Digitales Duisburg wird auf neue Beine
gestellt. Bei der Entwicklung eines „Masterplans 2.0“ der Smart City
Initiative wird anders als bei seinem Vorgänger nicht nur die
Digitalisierung, sondern vor allem auch der Mensch im Mittelpunkt
stehen. Dabei spielen Themen wie Partizipation, Bürgerbeteiligung
und Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle.
Der unreflektierte
Umgang mit Technologie wird zunehmend kritisch hinterfragt,
gleichzeitig rücken Zielsetzungen wie die resiliente Stadt,
Versorgungssicherheit und regionale Autarkie in den Fokus. Um bei
diesen Themen die Duisburgerinnen und Duisburger mit ins Boot zu
holen, startete die Stadt im Frühjahr eine hybride
Bürgerbeteiligung.
Bis Ende Mai hatten Duisburgerinnen und
Duisburger die Möglichkeit, sich an einem interaktiven Workshop und
an einer Onlinebefragung der Smart City Initiative zu beteiligen.
Ziel war und ist es, Interessierte aktiv in die zukünftige
Entwicklung der Stadt einzubinden und ihre Meinungen, Wünsche und
Ideen in Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen.
Ergänzend zum Workshop zu den vier Themenbereichen Ökologische
Nachhaltigkeit, Resilienz, Digitale Infrastruktur und Lebenswerte
Stadt, konnte man sich online an der Diskussion beteiligen und Ideen
einbringen. Die erste Analyse der Ergebnisse zeigt interessante
Trends: Während bei den Workshop-Teilnehmenden sichtbare und
konkrete Veränderungen im öffentlichen Raum im Fokus standen, legte
die Online-Community mehr Wert auf langfristige Visionen und
Nachhaltigkeitsaspekte.
Quer durch alle Themenbereiche
wurden verschieden Schwerpunkte genannt, darunter die Stärkung des
Radverkehr, ein Ausbau des ÖPNV und die Prüfung alternative
Verkehrskonzepte. Viele Teilnehmende wünschen sich einen weiteren
Ausbau der digitalen Infrastruktur. Auch die Krisenvorsorge stand im
Fokus. So äußerten viele ihre Sorge über Stromausfälle oder
Extremwetter.
Besonders positiv bewertet wurde die Mein
Duisburg App, die als wichtiger Baustein für viele der genannten
Themen gesehen wird. Ebenso wurde die Einführung des konzernweiten
Mängelmelders als sinnvolle Maßnahme begrüßt. Die Ergebnisse fließen
nun in die weiteren Planungen der Smart City Initiative ein, um
Duisburg zukunftsfähig und lebenswert zu gestalten.
Einwohnerzahl im Ruhrgebiet bleibt stabil bei rund 5,13 Millionen
5.125.628 Menschen lebten Ende 2024 im Ruhrgebiet.
Damit bleibt die Bevölkerungszahl in der Region stabil. Im Vergleich
zum Vorjahr war nur ein minimaler Einwohnerrückgang von 525 oder
0,01 Prozent zu verzeichnen. Das zeigen die aktuellen Zahlen des
Statistischen Landesamtes IT.NRW. In Nordrhein-Westfalen wuchs die
Bevölkerung leicht um 0,1 Prozent auf 18.034.454.
Im Ranking
der größten Städte gibt es keine Veränderungen: Dortmund (603.462)
ist die bevölkerungsreichste Kommune im Ruhrgebiet, gefolgt von
Essen (574.682). Die beiden Städte liegen im NRW-Vergleich hinter
Köln und Düsseldorf auf den Plätzen drei und vier. Die Zahlen von
IT.NRW stammen aus der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf
Basis des letzten Zensus von 2022.idr
Vortrags- und
Diskussionsabend zur Luftqualität in Duisburg
Das
Umweltamt der Stadt lädt während der Umweltwochen am Donnerstag, 26.
Juni, von 18.30 bis 21 Uhr zu einem öffentlichen Vortrags- und
Diskussionsabend in die Volkshochschule im Stadtfenster, Steinsche
Gasse 26, ein. Dabei dreht es sich um das Thema Luftqualität in
Duisburg.
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist
erforderlich. 1961 forderte der spätere Bundeskanzler Willy Brandt:
„Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden.“ Ist dem
heute so? 2021 hat die Weltgesundheitsorganisation neue Leitlinien
für die Luftqualität herausgegeben und Ende 2024 folgte eine neue
EU-Richtlinie zur Verbesserung der Luft.
Was bedeutet das
alles für Duisburg?
Welche Schadstoffe sind besonders relevant?
Welche Anforderungen kommen auf uns zu?
Die Vortragenden
Peter Heise und Thomas Rahne vom Umweltamt geben Antworten auf diese
und weitere Fragen. Dr. Stefan Schumacher vom Institut für Energie &
Umwelt, Technik & Analytik e.V. (IUTA) stellt zudem ein Projekt zur
Entwicklung eines Messsystems vor, das dazu dient, die
Schadstoffbelastung in Innenräumen zu erfassen. Für die Erprobung
werden noch Teilnehmende gesucht. Kurs-Anmeldung über:
www.vhs-duisburg.de/kurssuche/kurs/251SZ1226
Eröffnung der Zentralen Anlaufstelle „Frühe Hilfen“
Nach zehn Jahren im Glaspavillon auf der Kuhstraße haben
die Frühen Hilfen nun die Räumlichkeiten des ehemaligen „Kleinen
Prinzen“ bezogen und ihre neue und zentrale Anlaufstelle
eingerichtet. Das Team der Frühen Hilfen berät Schwangere und
Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in der Duisburger
Innenstadt und vermittelt Familienhebammen an Eltern und
Alleinerziehende, besonders Mütter und Väter in belastenden
Lebenslagen.
Eltern mit Säuglingen können die Anlaufstelle
auch als lebensnahe und praktische „Versorgungsstation“ nutzen, um
ihr Baby zu stillen oder zu wickeln. Oberbürgermeister Sören Link
wird gemeinsam mit Paul Bischof, Dezernent für Kinder, Jugend und
Familie sowie Philipp Thelen, stellv. Leiter des Jugendamtes, am
Mittwoch, 25. Juni 2025, um 15 Uhr an der Schwanenstraße 5-7
(Eingang Steinsche Gasse 2) die Räumlichkeiten offiziell eröffnen
und über die Besonderheit dieser Anlaufstelle im Rahmen der Frühen
Hilfen informieren.
Innenhafen-Führung mit
Panoramablick über Duisburg am 21. Juni
Zwei
Blickwinkel im Wechsel bietet die Führung durch den Duisburger
Innenhafen mit anschließendem Besuch auf der Aussichtsplattform des
Museums Küppersmühle. Der Blick vom Dach des einstigen
Kai-Speichers, der heute eines der schönsten und renommiertesten
Museen für zeitgenössische Kunst beherbergt, ist atemberaubend und
reicht bei klarem Wetter beinahe bis nach Köln.
Bei dieser
außergewöhnlichen Führung am 21.6. sind noch einzelne Plätze frei.
Die Tour dauert rund anderthalb Stunden und beginnt um 12:30 Uhr am
Haupteingang des Museums Küppersmühle. Anmeldungen sind entweder
über die Website www.duisburg-tourismus.de, in der Tourist
Information auf der Königstraße oder direkt vor Ort gegen Barzahlung
beim Tourguide möglich.

Innenhafen Küppersmühle C Duisburg Kontor Tanja Evers
Erneute Förderung für
Graduiertenkolleg - Maßgeschneiderte Behandlung durch KI
Durch die Digitalisierung in der Medizin entsteht eine große Menge
klinischer Daten. Das Graduiertenkolleg Wissens- und datenbasierte
Personalisierung von Medizin am Point of Care, kurz: WisPerMed,
macht sie für Ärzt:innen in einer neuen Form nutzbar. Die Deutsche
Forschungsgemeinschaft fördert das Programm unter der Leitung der
Universität Duisburg-Essen für weitere viereinhalb Jahre. Sprecher
ist Prof. Dr. Felix Nensa vom Institut für Künstliche Intelligenz in
der Medizin der Medizinischen Fakultät.

GRK-Sprecher Prof. Dr. Felix Nensa arbeitet mit dem „Patient
Dashboard“ an einem radiologischen Befundarbeitsplatz. © UDE /
Bettina Engel-Albustin
Ziel des seit 2021 laufenden
Graduiertenkollegs (GRK) der Universitätsmedizin Essen und der FH
Dortmund ist es, die personalisierte Medizin mithilfe von KI
unmittelbar dort voranzutreiben, wo ein:e Patient:in versorgt wird
(Point of Care). Am Beispiel des malignen Melanoms werden in den
Projekten am Universitätsklinikum Essen hierfür neue Werkzeuge
entwickelt.
Personalisierte Medizin meint in diesem Fall
beide Seiten: Statt des Prinzips „eine Behandlung für alle“ wird die
medizinische Entscheidung datenbasiert und jeweils abgestimmt auf
die biologische, gesundheitliche und persönliche Situation einer
bzw. eines Erkrankten getroffen. Zum anderen werden aber auch die
individuellen Präferenzen der behandelnden Mediziner:innen
miteinbezogen. Denn sie müssen bei der Nutzung der Werkzeuge die
Informationen schnell und intuitiv verstehen.
„Es gibt eine
Wissens-Explosion in der Medizin, vor allem in der Onkologie; es
entstehen immer mehr Daten. Ärzt:innen haben weder Zeit noch
Kapazitäten, alles selbst zu filtern und zu verarbeiten“, erklärt
GRK-Sprecher Prof. Dr. Felix Nensa, Experte für Radiologie mit
Schwerpunkt KI. „Wir möchten ihnen daher ergänzendes Wissen zur
Verfügung stellen und neues Wissen aus Daten generieren, ohne sie in
ihrer Entscheidungsfreiheit zu beschränken. Das ist eine riesige
Chance, gerade in der Krebsmedizin.“
Im GRK WisPerMed
forschen zurzeit 13 Professor:innen und 13 Doktorand:innen an einem
adaptiven System, KI in medizinische Entscheidungsprozesse zu
integrieren. Unter anderem durch Machine Learning-Methoden werden
Daten intelligent verknüpft und systematisch ausgewertet: solche aus
den Leitlinien zur Diagnostik, aus der Therapie und Nachsorge,
sämtliches verfügbares Wissen aus Studien, aus Patientendatenbanken
und alle relevanten Daten zur erkrankten Person.
Die KI
könnte dann eine Behandlungsempfehlung generieren und
prognostizieren, ob ein Tumor Resistenzen oder eine Therapie schwere
Nebenwirkungen entwickeln könnte. Ärzt:innen können dabei immer
nachvollziehen, auf welcher Basis die Empfehlung getroffen wurde, um
die Ergebnisse zu kontrollieren.
Visualisiert werden die
Ergebnisse der KI in einem Dashboard – abgestimmt auf die
persönlichen Arbeitsweisen und Fachbereiche der Behandelnden. Dafür
arbeiten die Mediziner:innen mit anderen Disziplinen der UDE
zusammen, wie der Informatik und der Sozialpsychologie.
In
der nun anstehenden Förderphase wird die Forschung auf den gesamten
Behandlungspfad der Patient:innen ausgeweitet. Anstatt wie bisher
einzelne Entscheidungsunterstützungen für spezifische Probleme zu
adressieren, zielt der neue Ansatz darauf ab, Prozesse von der
Erstdiagnose über die Behandlung bis zur Nachsorge ganzheitlich zu
erfassen, zu unterstützen und zu optimieren.
Indem
Patientendaten und klinisches Wissen an verschiedenen Schnittstellen
des Gesundheitssystems nahtlos integriert werden, sollen
Technologien entstehen, die sowohl den individuellen Anforderungen
von medizinischem Fachpersonal gerecht werden als auch die
Versorgungskontinuität und das Behandlungserlebnis der Patient:innen
verbessern.
Reformplan für die Finanzkontrolle
Schwarzarbeit - Mehr Kontrollen, faire Löhne
Rund zwei
Millionen Beschäftigte in Deutschland erhalten trotz gesetzlichem
Anspruch keinen Mindestlohn. Besonders betroffen sind
Minijobber:innen, Werkvertragsbeschäftigte, Leiharbeiter:innen,
Scheinselbstständige sowie illegal Beschäftigte, zum Beispiel im
Baugewerbe. Viele kennen ihre Rechte nicht oder trauen sich nicht,
sie einzufordern.
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit deckt
bei Kontrollen in mehr als jedem vierten Betrieb Verstöße auf. Doch
gerade in unübersichtlichen Subunternehmerketten stößt sie an ihre
Grenzen. Das Institut Arbeit und Qualifikation erarbeitet daher
einen umfassenden Reformvorschlag.
Der Bundestag will den
Mindestlohn effektiver durchsetzen – mit mehr Personal bei der
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) und dem verstärkten Einsatz
digitaler Datenanalyse. Ausgewertet werden sollen unter anderem
Lohn- und Beschäftigtendaten der Rentenversicherung,
Entgeltmeldungen der Bundesagentur für Arbeit sowie Umsatz- und
Steuerdaten der Finanzbehörden.
Doch neue Gesetze und
zusätzliches Personal allein genügen nicht, um Lohnverstöße
aufzudecken. Das sagt Prof. Dr. Gerhard Bosch vom Institut Arbeit
und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen (UDE). Er
betont: „Die FKS braucht eine digitale und strategische
Neuausrichtung.“ Sie habe zwar bereits ein eigenes Arbeitsgebiet für
organisierte Kriminalität, erstellt aber meistens nur regionale
Täterprofile. Übergreifende kriminelle Netzwerke können so kaum
erkannt werden.
Bosch und Frederic Hüttenhoff,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am IAQ, haben deshalb Empfehlungen
für eine Reform der FKS herausgearbeitet: Bausteine sind dabei eine
bundesweite, datengestützte Risikoanalyse sowie eine verpflichtende,
digitale und manipulationssichere Arbeitszeiterfassung. Außerdem
soll die Zusammenarbeit mit der Zollfahndung ausgebaut und
überregionale Ermittlungen in regionalen Zentren gebündelt werden.
Auch die Ausbildung soll reformiert werden – etwa durch
spezialisierte Ausbildungs- und Studiengänge für die beiden
Ermittlungsdienste, FKS und Zollfahndung. Um betroffene Beschäftigte
besser zu schützen, schlagen die Autoren zudem vor, Kronzeug:innen,
falls sie illegal beschäftigt waren, ein dauerhaftes
Aufenthaltsrecht in Deutschland zu gewähren und Betroffene direkt
über ihre Lohnansprüche zu informieren.
Allein im vergangenen
Jahr deckten die Ermittlungen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und
der illegalen Beschäftigungen einen Schaden von rund 766 Millionen
Euro auf. Die Dunkelziffer ist noch viel größer. „Mit den richtigen
Strukturen kann die FKS ein deutlich wirksameres Instrument zur
Durchsetzung fairer Arbeitsbedingungen werden“, so Hüttenhoff.
Demnach sollen die vorgeschlagenen Maßnahmen Verstöße wirksamer
aufdecken, die organisierte Kriminalität besser bekämpfen und die
betroffenen Beschäftigten stärker unterstützen.
Studie zur Datenweitergabe - Vertrauen verstärkt Offenheit
Mailadresse, Wohnort, aktueller Standort oder Bankverbindung – um
digitale Dienste wie Video-Streaming, Soziale Medien oder
Bezahlsysteme zu nutzen, müssen Menschen oft persönliche Daten
preisgeben. Allerdings sind nicht alle gleichermaßen bereit dazu.
Eine nun veröffentlichte Studie unter Federführung der Universität
Duisburg-Essen* zeigt: Wer persönliche Daten preisgibt, lässt sich
dabei stark durch Empfehlungen von Freunden und Bekannten sowie
durch „grüne“ Versprechen – wie die CO2-Emissionen zu kompensieren –
beeinflussen.
Allzu oft wird der digitale Alltag zur
Datenschutzfrage: Was bin ich bereit, wem preiszugeben? „Weltweit
sind Menschen zunehmend daran gewöhnt, ihre Privatsphäre zumindest
teilweise aufzugeben, um an der digitalen Welt teilzuhaben.
Gleichzeitig sind die Menschen oft besorgt darüber, dass sie von
Webdienstanbietern erkannt werden und ihre Privatsphäre vollständig
verlieren,“ erklärt Prof. Dr. Conrad Ziller die Ausgangslage seiner
nun veröffentlichten Studie.
„Die Bereitschaft, persönliche
Daten weiterzugeben, wird beeinflusst von einer Vielzahl
individueller Motive, Einstellungen und Erfahrungen sowie von der
Art, wie die Daten von diesen Diensten verwendet werden“, erklärt
der Politikwissenschaftler der Universität Duisburg-Essen. Die
aktuelle Studie nimmt dabei zwei bisher wenig beachtete Aspekte in
den Fokus: sozialen Einfluss und die wahrgenommene Nachhaltigkeit
eines Dienstes – etwa in Bezug auf CO₂-Emissionen. Die Daten dazu
stammen von einem groß angelegten deutschen Online-Experiment von
2023.
Die Ergebnisse zeigen, dass soziale Empfehlungen – vor
allem von Freunden und Bekannten – die Bereitschaft zur
Datenfreigabe deutlich erhöhen. Nachhaltigkeitsmerkmale spielen
hingegen nur für diejenigen eine Rolle, die sich ohnehin aktiv für
Umweltschutz interessieren. Sie sind eher bereit, persönliche Daten
weiterzugeben, wenn sich Unternehmen verpflichten, die
CO2-Emissionen zu kompensieren, die bei der Verarbeitung und
Speicherung von Daten entstehen.
Ziller sieht dabei vor allem
die Gefahr, dass Anbieter Umwelt- oder Sozialbotschaften nutzen
könnten, um von problematischen Datenschutzpraktiken abzulenken.
Deshalb müssten Politik und Verbraucherschutz früher ansetzen:
Nachhaltigkeitsversprechen sollten klar von datenschutzrelevanten
Informationen getrennt und Nutzer:innen gezielt über deren Einfluss
auf Entscheidungen aufgeklärt werden. So ließe sich verhindern, dass
sogenannte „Ausstrahlungseffekte“ die Wahrnehmung verzerren.
Ein Beispiel ist eine klimafreundliche Mobilitäts-App, die mit
CO₂-neutralen Fahrten, Ökostrom und Baumpflanzungen wirbt.
Umweltbewusste Nutzer:innen vertrauen solchen Diensten oft stärker –
und übersehen dabei, dass die App umfassend Bewegungsdaten erhebt,
obwohl das für den ökologischen Zweck gar nicht nötig ist. Gerade
deshalb müsse, so Ziller, klarer kommuniziert und reguliert werden,
wo Datenschutz endet und Marketing beginnt.
*Alle Autoren
wurden zu Mitgliedern der Global Young Faculty VII der
Universitätsallianz Ruhr ernannt. Dieses Netzwerk, dessen
Förderzeitraum mittlerweile ausgelaufen ist, hatte das Ziel,
herausragende Nachwuchswissenschaftler:innen der Metropole Ruhr
interdisziplinär zu vernetzen, um dadurch gemeinsam an
Zukunftsthemen zu arbeiten und neue Impulse für ihre Forschung zu
gewinnen.

Besuch eines Schwimmbads im Mai 2025 um 5,7 % teurer als
ein Jahr zuvor
Für einen Besuch im Hallen- oder Freibad
müssen Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich mehr bezahlen als
zu Beginn der vergangenen Freibadsaison. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, hat sich der Besuch eines Schwimmbads
im Mai 2025 um 5,7 % gegenüber dem Mai 2024 verteuert.
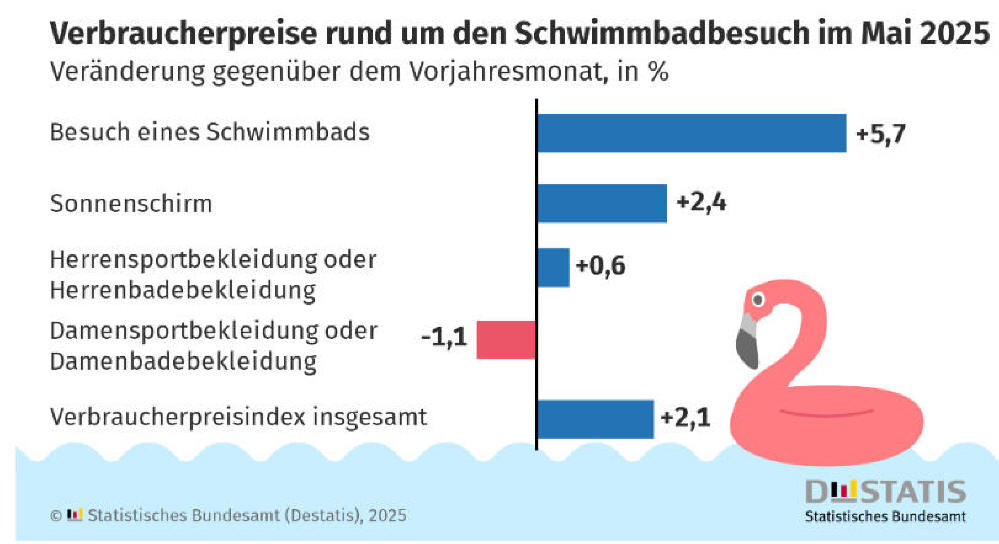
Unterschiedlich haben sich dagegen die Preise für ausgewählte
Dinge entwickelt, die man neben dem Ticket für einen Badetag
braucht: Der Sonnenschirm hat sich im selben Zeitraum um 2,4 %
verteuert, während die Preise für Sport- oder Badebekleidung für
Herren leicht anstiegen (+0,6 %). Sport- oder Badebekleidung für
Damen hingegen hat sich um 1,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat
verbilligt. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen
im selben Zeitraum um 2,1 %.
10 Minuten zum nächsten Natur-
oder Freibad Der Weg zum Freibadvergnügen ist in Deutschland
unterschiedlich weit. Das nächste Natur- oder Freibad ist mit dem
Auto im Durchschnitt in zehn Minuten zu erreichen, wie der Deutschlandatlas für
das Jahr 2024 zeigt. In einzelnen ländlichen Regionen hingegen muss
man mehr als 20 Minuten mit dem Auto einplanen, darunter in wenig
besiedelten Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, im
nördlichen Sachsen-Anhalt und in Teilen von Rheinland-Pfalz.
Insgesamt gibt es nach Angaben der Deutschen
Gesellschaft für das Badewesen in Deutschland gut
2 800 Freibadangebote und etwa 570 Naturbäder.
Mehr Menschen
beginnen Ausbildung als Fachangestellte für Bäderbetriebe
Für
Sicherheit und im Notfall Erste Hilfe sorgt in den Bädern das
Fachpersonal. Gut 600 Menschen begannen im Jahr 2023 eine Ausbildung
zu Fachangestellten für Bäderbetriebe, gemeinhin Bademeisterin oder
Schwimmmeister genannt. Das waren etwas mehr (+3,0 %) als ein Jahr
zuvor. Mehr als zwei Drittel (67,6 %) der neuen Auszubildenden waren
Männer. Binnen zehn Jahren hat die Zahl der Menschen, die diese
Ausbildung begonnen haben, um mehr als ein Viertel (27,5 %)
zugenommen.
Ältere Menschen tragen besonders hohe Schuldenlast
• Ältere Personen haben deutlich höhere Schulden im
Verhältnis zum Einkommen als jüngere
• Personen ab 65 Jahren am
häufigsten bei Kreditinstituten verschuldet, unter 25 Jahren bei
Telekommunikationsunternehmen
Personen, die 2024 die Hilfe
einer Schuldnerberatungsstelle in Anspruch nahmen, waren
durchschnittlich mit 32 976 Euro verschuldet. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatten ältere Menschen dabei
im Durchschnitt deutlich mehr Schulden als jüngere.
Bei den
unter 25- Jährigen betrugen die durchschnittlichen Verbindlichkeiten
rund 11 269 Euro, bei Personen ab 65 Jahren etwa 46 847 Euro. Am
häufigsten nahmen Menschen im Alter zwischen 35 und 45 Jahren eine
Schuldnerberatung in Anspruch. Diese Altersgruppe stellte im Jahr
2024 mit etwas über einem Viertel (28 %) den größten Anteil der
beratenen Personen.
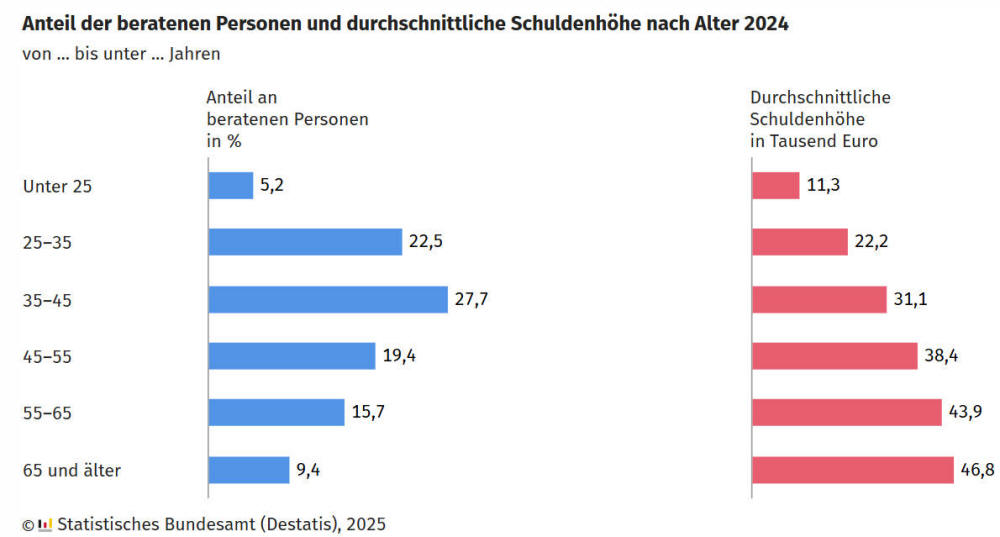
Deutlich höhere Überschuldungsintensität im Alter
Durch die
unterschiedlichen Schuldenhöhen zeigten sich auch Unterschiede bei
der Überschuldungsintensität, also dem Verhältnis zwischen
monatlichem Nettoeinkommen und den Verbindlichkeiten: So bräuchten
Personen unter 25 Jahren im Jahr 2024 bei Verwendung ihres gesamten
monatlichen Nettoeinkommens durchschnittlich knapp ein Jahr
(11 Monate) zur Schuldentilgung.
Personen ab 65 Jahren wären
erst nach etwas mehr als drei Jahren (38 Monate) schuldenfrei. Im
Durchschnitt aller beratenen Personen lag der Wert bei 25 Monaten.
Diese Unterschiede erklären sich einerseits durch die
durchschnittlich höhere Schuldenlast und andererseits durch ein
geringeres monatliches Einkommen im Alter. Diese Kombination kann
die Entschuldung im Alter besonders erschweren.
Art der
Gläubiger unterscheidet sich nach Altersgruppen
Neben der
Schuldenhöhe unterschied sich auch die Art der Gläubiger deutlich
zwischen den Altersgruppen. Im Jahr 2024 war bei den unter
25-Jährigen mit 57 % mehr als jede zweite Person bei
Telekommunikationsunternehmen verschuldet, die durchschnittliche
Schuldenhöhe betrug dabei rund 1 559 Euro.
Bei Personen ab
65 Jahren war es mit einer durchschnittlichen Schuldenhöhe von
616 Euro nur etwa jede vierte Person (28 %). Im höheren Alter
standen hingegen Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten im
Vordergrund: Mehr als die Hälfte der Personen ab 65 Jahren (59 %)
war dort verschuldet.
Hier fiel die durchschnittliche
Schuldenhöhe mit 23 790 Euro deutlich höher aus als bei
Telekommunikationsunternehmen, da Bankkredite in der Regel mit
höheren Beträgen verbunden sind als Telekommunikationsverträge. Bei
den unter 25-Jährigen lagen die Verbindlichkeiten bei
Kreditinstituten im Vergleich bei durchschnittlich 2 677 Euro.