






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 26. Kalenderwoche:
23. Juni
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Dienstag, 24. Juni 2025
Technischer Defekt sorgt für Störung der Straßenbeleuchtung
im gesamten Stadtgebiet
In einigen Straßenzügen im
gesamten Duisburger Stadtgebiet blieb die Straßenbeleuchtung am
späten Sonntagabend dunkel. Der Grund hierfür ist ein technischer
Defekt in der Fernsteuerung dieser Laternen. Das Beleuchtungsnetz in
der Stadt ist mit dem Sonnenuntergang gekoppelt, so dass die
Straßenbeleuchtung erst dann eingeschaltet wird, wenn sie benötigt
wird.
Hierfür wird ein Signal über das Stromnetz an die
einzelnen Laternen gesendet. Zahlreiche Empfänger in diesen Laternen
sind zeitgleich von einem technischen Defekt betroffen, so dass die
Beleuchtung derzeit in einigen Straßenzügen in Duisburg nicht
eingeschaltet werden kann. Die Netze Duisburg, die für die
Betriebsführung der Straßenbeleuchtung zuständig sind, haben mit dem
Austausch der defekten Empfänger begonnen und suchen derzeit noch
nach der genauen Ursache für den Defekt.
Der vollständige
Austausch der defekten Empfänger in den Straßenlaternen kann mehrere
Tage in Anspruch nehmen, so dass es auch in den kommenden Tagen in
einigen Straßen im Stadtgebiet in den Abend- und Nachtstunden dunkel
bleiben wird. Die Netze Duisburg arbeiten mit Hochdruck an der
vollständigen Fehlerbehebung.
Ausbildung bei
der Stadt Duisburg: 318 Stellen für 2026
Der Rat der
Stadt Duisburg hat in seiner gestrigen Sitzung die Einrichtung von
318 Ausbildungsstellen in über 20 verschiedenen Berufen für das
Ausbildungsjahr 2026 beschlossen. „318 Chancen auf eine starke
Zukunft – das bietet die Stadt Duisburg im neuen Ausbildungsjahr.
Wir haben für jedes Interesse den passenden Einstieg. Wer bei der
Stadt Duisburg ins Berufsleben startet, kann sich auf eine
gutbezahlte Ausbildung mit krisensicheren und vielfältigen
Perspektiven freuen“, so Oberbürgermeister Sören Link.
Auszubildenden, Aufstiegsbeamtinnen und -beamten sowie Studierenden
werden wieder viele interessante Stellen angeboten. Dazu zählen
unter anderem die klassischen Verwaltungsberufe wie etwa
Verwaltungsfachangestellte und Verwaltungswirte, Kaufleute für
Büromanagement oder der Bachelor-Studiengang für den gehobenen
Verwaltungsdienst. Zudem werden Ausbildungsberufe im
gewerblichtechnischen Bereich, wie beispielsweise die
Fachangestellten für Bäderbetriebe, angeboten.
Eine Vielzahl
an weiteren Möglichkeiten, bieten auch die modernen dualen
Studiengänge wie etwa Soziale Arbeit oder Verwaltungsinformatik. Die
benötigten Schulabschlüsse unterscheiden sich je nach
Ausbildungsberuf und reichen vom Hauptschulabschluss bis hin zum
Abitur. Chancengleichheit, Vielfalt und Begegnung auf Augenhöhe sind
zentrale Werte der Stadt Duisburg.
Die freie Entfaltung der
Fähigkeiten und Talente der Auszubildenden, unabhängig von
geschlechtsspezifischen Erwartungen oder kultureller Herkunft, steht
ebenfalls im Fokus. Zudem wird großen Wert auf eine qualitativ gute
Ausbildung sowie ein dynamisches und abwechslungsreiches
Arbeitsumfeld gelegt. Auf die zukünftigen Mitarbeitenden warten
zudem zahlreiche Benefits, wie flexible Arbeitszeiten, eine
überdurchschnittlich hohe Ausbildungsvergütung,
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Beste Übernahmeperspektiven für
alle Nachwuchskräfte und ein krisensicherer Arbeitsplatz mit
Karrierechancen in einem großen Team mit mehr als 6.000
Beschäftigten runden die Vorzüge der Stadt Duisburg als Arbeitgeber
ab. Das Bewerbungsverfahren startet am Montag, 14. Juli. Alle
Informationen zu den Berufsbildern und zum Bewerbungsprozess sowie
die Möglichkeit sich online zu bewerben, gibt es auf der städtischen
Internetseite unter www.duisburg.de/ausbildung.
DVG weicht für
Wasseranschlussarbeiten in Rumeln vom Linienweg ab
Von Mittwoch, 25. Juni, circa 6 Uhr, bis voraussichtlich Freitag,
18. Juli, Betriebsende, müssen die Busse der Linie 924 der
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) in Duisburg-Rumeln eine
Umleitung fahren. Grund hierfür sind Wasseranschlussarbeiten auf der
Bonertstraße, weshalb diese voll gesperrt wird.
Linie 924:
In Fahrtrichtung Winkelhausen fahren die Busse ab der Haltestelle
„Pregelstraße“ eine örtliche Umleitung über die Kapellener Straße
und Düsseldorfer Straße. Ab da gilt der normale Linienweg. Die
Haltestelle „Wagnerstraße“ entfällt. Die Haltestelle „Rumeln Markt“
wird auf die Kapellener Straße in Höhe der Hausnummer 27 verlegt.
In Gegenrichtung wird die Umleitung sinngemäß gefahren. Die
Haltestelle „Wagnerstraße“ entfällt. Die Haltestelle „Rumeln Markt“
wird auf die Kapellener Straße in Höhe der Hausnummer 27 verlegt.
Neues Tierheim für Duisburg: Stadt lädt Bürgerinnen
und Bürger zu Infoveranstaltung ein
Die Stadt Duisburg
plant den Neubau eines modernen Tierschutzcampus an der Essenberger
Straße in Asterlagen – und lädt die Bürgerschaft am Dienstag, 1.
Juli, zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein. Beginn
ist um 18.30 Uhr in der Erlöserkirche an der Beethovenstraße 18 in
Rheinhausen.
Ziel der Veranstaltung ist es, Anwohnerinnen
und Anwohner sowie alle am Tierschutz Interessierten frühzeitig und
transparent über den aktuellen Stand der Planungen zu informieren.
Neben einem Überblick über das Projekt, den Bauverlauf und die
künftige Nutzung bietet der Abend Raum für Rückfragen und Anregungen
aus der Bevölkerung. Vorgestellt werden unter anderem die geplante
Gebäudestruktur und -nutzung, Maßnahmen zum Lärmschutz sowie die
Begrünung und Einbettung in die Umgebung.
Auch
Umweltverträglichkeit, Genehmigungsfragen und der Alltag im neuen
Tierheim stehen auf der Agenda. Oberbürgermeister Sören Link wird
die Veranstaltung eröffnen. Auch Fachleute aus Stadtverwaltung,
Planung, Bau und Tierschutz stehen für Fragen zur Verfügung.
Dazu gehören unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg, des Veterinäramts, der Stadtplanung
sowie das mit dem Entwurf beauftragte Architekturbüro. Die
Veranstaltung ist öffentlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Moderiert wird der Abend von Charlotte Schulze-Tenkhoff und Bülent
Aksen.
VHS-Herbstprogramm ist online
Ab
sofort können Interessierte online in den Weiterbildungsangeboten
der Volkshochschule Duisburg für den Herbst 2025 stöbern und sich
für Kurse, Seminare oder andere Veranstaltungen anmelden. Das
Herbstprogramm ist online unter www.vhs-duisburg.de abrufbar.
Die PDF-Version des gedruckten Programms wird in den nächsten
Tagen online gestellt. Das gedruckte Programm wird in der zweiten
Juliwoche in den Geschäftsstellen der VHS und weiteren Stellen in
der Stadt zur Mitnahme ausliegen. Das Herbstsemester beginnt am 1.
September. Ausgewählte Veranstaltungen finden auch vorher statt;
insbesondere das Sommerakademie-Programm.
Bürgerspaziergang mit dem Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Sören Link lädt Duisburgerinnen und Duisburger
regelmäßig ein, ihn bei seinem Spaziergang durch die Duisburger
Stadtteile zu begleiten. Der nächste Bürgerspaziergang findet am
Samstag, 12. Juli, von 13 bis 16 Uhr statt und führt nach
Duisburg-Meiderich.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger
erhalten an diesem Tag neben wissenswerten Informationen rund um
Meiderich auch spannende Einblicke in das vielfältige Vereinsleben
im Stadtteil. Interessierte können sich ab sofort bis Montag, 30.
Juni, per E-Mail an unterwegs.mit.dem.ob@stadt-duisburg.de anmelden.
Unbedingt erforderlich sind festes Schuhwerk und eine gute
Konstitution.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sollten mehr
Anmeldungen eingehen, werden die Plätze gelost. Eine
Anmeldebestätigung und genaue Informationen zum Treffpunkt bekommen
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer rechtzeitig vorher per E-Mail.
Mehr Verbraucherschutz bei Kreditverträgen: BMJV
veröffentlicht Gesetzentwurf zur Umsetzung der
Verbraucherkreditrichtlinie Verbraucherinnen und
Verbraucher sollen besseren rechtlichen Schutz erhalten, wenn sie
Kreditgeschäfte tätigen. Auch sogenannte Buy-now-pay-later-Modelle
sollen erstmals in die verbraucherschützenden Regelungen für
Kreditverträge einbezogen werden. Das sieht ein Gesetzentwurf vor,
den das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz heute
veröffentlicht hat.
Der Gesetzentwurf soll zugleich den
europäischen Binnenmarkt für Kredite zwischen Unternehmern und
Verbraucherinnen und Verbrauchern fördern. Er geht zurück auf die
Verbraucherkreditrichtlinie der Europäischen Union, die damit ins
deutsche Recht umgesetzt werden soll.
Bundesministerin der
Justiz und für Verbraucherschutz, Dr. Stefanie Hubig erklärt dazu:
„Heute kaufen, später zahlen‘, das klingt für viele erstmal
praktisch. Doch hinter schnell abgeschlossenen Kreditverträgen kann
sich ein echtes Risiko verbergen. Schlimmstenfalls führen solche
Verträge in die Schuldenfalle. Deshalb haben wir auf EU-Ebene
beschlossen, den Verbraucherschutz bei Kreditverträgen zu stärken.

Foto: Photothek Media Lab / Dominik Butzmann
Diesen Beschluss setze ich nun in deutsches Recht um. Mir
ist wichtig, dass wir die europäischen Regeln möglichst einfach und
bürokratiearm umsetzen. Unser Ziel ist klar: Mehr Schutz für
Verbraucherinnen und Verbraucher bei Kreditverträgen – ohne
vermeidbaren bürokratischen Ballast.“
Der am 23. Juni 2025
vorgelegte Entwurf dient der Umsetzung der überarbeiteten
EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Die EU-Verbraucherkreditrichtlinie
ist bis zum 20. November 2025 in nationales Recht umzusetzen und ab
dem 20. November 2026 von den Mitgliedstaaten anzuwenden.
Die vorgeschlagenen Änderungen weiten den Verbraucherschutz
erheblich aus. So werden bislang unregulierte Kreditformen erstmals
in die Regelungen zu Verbraucherkrediten einbezogen. Fortan fallen
beispielsweise Buy-now-pay-later-Modelle und unentgeltliche Kredite
unter die Regelungen.
„Buy now, pay later“ bedeutet, dass
bei einem Kauf das Geld erst zu einem späteren Zeitpunkt
(beispielsweise 14 oder 30 Tage nach dem Kauf) vom Konto abgebucht
wird. Es handelt sich dabei um einen Zahlungsaufschub und damit um
einen Kurzzeitkredit. Außerdem sollen die Vorgaben für die
Kreditwürdigkeitsprüfung verschärft werden, die verpflichtend vor
dem Vertragsabschluss durchzuführen ist.
Insbesondere
erfolgt eine Angleichung an die Maßstäbe, die bei Darlehensverträgen
für Immobilien gelten. Die Verbraucherkreditrichtlinie verfolgt
einen Vollharmonisierungsansatz, der es den EU-Mitgliedstaaten
grundsätzlich nicht erlaubt, strengere oder weniger strenge
Verbraucherschutzvorschriften vorzusehen. Soweit Umsetzungsspielraum
vorhanden ist, hat BMJV diesen grundsätzlich für eine möglichst
bürokratiearme Regulierung genutzt, etwa bei dem Umfang
vorvertraglicher Informationspflichten.
Auch bei der Form
des Vertragsschlusses wurde der Spielraum der Richtlinie genutzt,
sodass Allgemein-Verbraucherdarlehen künftig in Textform statt
bislang in Schriftform abgeschlossen werden können. Der
Gesetzentwurf sieht grundsätzlich keine nationalen Verschärfungen
oder Erweiterungen über die zwingenden europäischen Vorgaben vor
(kein sogenanntes Goldplating).
Der Referentenentwurf wurde
heute an die Länder und Verbände versandt und auf der Internetseite
des BMJV veröffentlicht. Die interessierten Kreise haben nun
Gelegenheit, bis zum 18. Juli 2025 Stellung zu nehmen. Die
Stellungnahmen werden auf der Internetseite des BMJV veröffentlicht.
Der Gesetzentwurf sowie weitere Informationen zum Gesetzentwurf sind
hier abrufbar.
Stadtwerke Solar-Lounge auf
Wochenmarkt in Duisburg-Huckingen
Immer mehr Bürger
beteiligten sich daran, ihre Energiewende in den eigenen vier Wänden
umzusetzen. Unterstützt werden sie dabei von den Stadtwerken
Duisburg, die mit zahlreichen Angeboten und Beratungen mit Rat und
Tat allen Interessierten zur Seite stehen. Der lokale
Energiedienstleister hat dafür auch ein ganz besonderes Mini-Haus
entwickelt, mit dem die Energiewende erlebbar und zugleich portabel
ist: Die Stadtwerke Solar-Lounge.
Das kleine Haus ist auf
einem Anhänger montiert und wird auch in diesem Jahr wieder auf den
Duisburger Wochenmärkten stehen und die die Duisburgerinnen und
Duisburger mit Informationen zum Thema Photovoltaikanlagen,
Batteriespeicher und Wärmepumpen versorgen. Am Donnerstag, 26. Juni,
steht die Solar-Lounge der Stadtwerke Duisburg auf dem Wochenmarkt
Huckingen, Mündelheimer Straße/Im Wittfeld, in der Zeit von 8 bis 13
Uhr. Auf dem Dach des Mini-Hauses glitzert eine Photovoltaik-Anlage
in der Sonne.
Die Solar-Lounge zeigt, welche Möglichkeiten
es gibt, sich möglichst unabhängig zu Hause aufzustellen und seine
eigene Energiewende zu schaffen. Die verbauten Komponenten machen
außerdem deutlich, welche vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten es
gibt und wie diese perfekt auf den individuellen Verbrauch eines
Haushaltes abgestimmt werden können.
Zwei Energieberater der
Stadtwerke Duisburg informieren Interessenten über alles
Wissenswerte rum um Photovoltaik-Anlagen und viele weitere
Energiethemen. Dabei können Besucher des Wochenmarktes den beiden
Experten der Stadtwerke auch alle ihre Fragen zu Elektromobilität,
Wallboxen, Balkonkraftwerke und natürlich auch zu möglichen
Förderprogrammen stellen. Alle Informationen zu diesen Themen
finden Interessierte auch im Internet unter
www.stadtwerke-duisburg.de/pv

Stadtwerke-Solarlounge: Am
Donnerstag, 26. Juni, steht sie auf dem Wochenmarkt Huckingen,
Mündelheimer Straße/Im Wittfeld, 8 bis 13 Uhr.
Rundgang zur Neugestaltung des Biegerparks
Am
vergangenen Samstag luden die beiden Ratskandidaten Sabrina Hofmann
(Huckingen, Hüttenheim,Mündelheim, Ungelsheim, Serm) und Jannik
Neuhaus (Huckingen, Großenbaum) interessierte Bürgerinnen und Bürger
zu einem öffentlichen Rundgang durch den Biegerpark in
Duisburg-Huckingen ein.

Ziel der Veranstaltung war es, die geplante Neugestaltung des
beliebten Naherholungsgebiets vorzustellen und dabei den direkten
Austausch mit den Menschen vor Ort zu suchen. Zahlreiche Bürgerinnen
und Bürger nutzten die Gelegenheit, um sich direkt vor Ort über die
geplanten Maßnahmen und Gestaltungsideen zu informieren.
Der
Rundgang führte zu fünf thematisch gestalteten Stationen, die
exemplarisch für die künftige Entwicklung des Parks stehen. Sabrina
Hofmann betonte: „Der Biegerpark soll ein Ort werden, an dem sich
Menschen gerne aufhalten – mit Respekt für Natur, Umwelt und
Miteinander.“
Auf dem geführten Spaziergang entlang von fünf
thematischen Stationen – „Kein Müll“, „Auenrundweg“, „Tiere und
Pflanzen“, „Biegerzimmer“ und „Sonne und Schatten“ – erhielten die
Teilnehmenden Einblicke in die ökologischen, bildungspädagogischen
und gestalterischen Neuerungen des beliebten Naherholungsgebiets in
DuisburgHuckingen.
Jannik Neuhaus: „Solche Rundgänge sind
wichtig, um gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern über Ideen,
Chancen und Herausforderungen zu sprechen. Der Baustart ist für
August 2025 vorgesehen. Die Fertigstellung soll 2026 erfolgen –
währenddessen bleiben Spielplatz und Biergarten größtenteils
nutzbar. „Wir möchten zeigen, dass gute Politik auch zwischen Wiesen
und Bäumen stattfinden kann – transparent, ansprechbar und
bürgernah“, so Hofmann und Neuhaus abschließend.

21. Fachtagung des Arbeitskreises Prävention Duisburg: Das
Handy als Tatort?
Die Frage, ob und - gegebenenfalls - wie ein Handy auch zum Tatort
wird, steht im Mittelpunkt der 21. Fachtagung des aus 14
Institutionen bestehenden Arbeitskreises Prävention Duisburg in der
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV), Wuhanstr.
10, 47051 Duisburg.
Die Tagung richtet sich an alle
Fachkräfte aus Duisburg, die im professionellen Setting mit Kindern
und Jugendlichen ab dem Grundschulalter arbeiten (Schulen,
Jugendzentren, Jugendamt, freie Träger und andere).
Auf der
Veranstaltung können Sie die Vielfältigkeit des Netzwerkes näher
kennen zu lernen. Behandelt werden die Themen: „Mach dein Handy
nicht zur Waffe!“ – Kriminalprävention, „Medien und Essstörungen“,
„Prävention von Cyberkriminalität/Sozialkompetenztraining“, „Von
Gaming bis Social Media – ein Überblick zur Mediensucht“,
„Entwicklungsmöglichkeiten von Sexualität und Geschlecht im Kontext
sozialer Medien“, „Cybergrooming, Dickpics, Sexting… Wo beginnt
sexualisierte Gewalt im Netz?“.
Während des „Speed-Datings“
stehen Ihnen als Ansprechpersonen die Tagungskoordinatorin Martina
Jungeblodt vom Gesundheitsamt der Stadt Duisburg sowie
Vertreterinnen und Vertreter der weiteren Institutionen
(Frauenberatungsstelle, pro familia OV Dbg. e.V., Mabilda e.V.,
Jungs e.V., Kinderschutzbund OV Dbg. e.V., Mercator-Gymnasium,
Justus von LiebigSchule, Gesamtschule Duisburg-Süd, Lebenslust e.V.,
AWO, Suchthilfeverbund Duisburg e.V., AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis
Wesel e.V. sowie der Polizei) zur Verfügung.
Insbesondere
nach dem „Speed-Dating“ ergibt sich zwischen 10 und 10.30 Uhr die
Möglichkeit zu Gesprächen mit den Tagungsteilnehmenden und einem
Foto mit den Arbeitskreisakteurinnen und -akteuren.
Neue Studie untersucht „Realexperimente“ - IMK:
Kein empirischer Beleg dafür, dass weniger Feiertage das Wachstum
stärken
In der Empirie gibt es keine Belege dafür, dass die Abschaffung von
Feiertagen die Wirtschaftsleistung erhöht. Das zeigt die Analyse von
konkreten Fällen, in denen in Deutschland beziehungsweise in
einzelnen Bundesländern in den vergangenen 30 Jahren arbeitsfreie
Feiertage gestrichen oder neu eingeführt wurden. In gut der Hälfte
der Fälle entwickelte sich die Wirtschaft sogar danach in jenen
Bundesländern besser, in denen arbeitsfreie Feiertage beibehalten
wurden oder neu hinzukamen.
Das ergibt eine neue Kurzstudie
des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der
Hans-Böckler-Stiftung.* „Die Gleichung: Wenn Feiertage wegfallen,
steigt das Wachstum, geht offensichtlich nicht auf. Denn sie ist zu
simpel und wird einer modernen Arbeitsgesellschaft nicht gerecht –
so wie viele aktuelle Ideen zur Arbeitszeitverlängerung“, sagt Prof.
Dr. Sebastian Dullien,wissenschaftlicher Direktor des IMK und
Ko-Autor der Untersuchung. „Die Forderung nach einem solchen Schritt
zur Wachstumsförderung ist deshalb nicht zielführend.“
Üblicherweise wird die These einer positiven wirtschaftlichen
Wirkung gestrichener Feiertage damit begründet, dass in Monaten mit
besonders vielen Feiertagen (oder wenig Arbeitstagen, wie durch die
regelmäßig kurze Monatslänge im Februar) weniger produziert wird als
in anderen Monaten. So kalkuliert etwa das arbeitgebernahe Institut
der Deutschen Wirtschaft mit einer vermeintlichen zusätzlichen
Wirtschaftsleistung von 5 bis 8,6 Milliarden Euro pro gestrichenem
Feiertag, oder etwa 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
Betrachtet man allerdings reale Fälle, in denen die Zahl der
Feiertage verändert wurde, sieht das Bild anders aus. Das IMK
betrachtet sechs solcher „Realexperimente“ seit 1990. Dabei wurden
in manchen Bundesländern gesetzliche Feiertage gestrichen oder neu
eingeführt, in anderen nicht. Hier kann man im Jahr der Einführung
oder Streichung die Wirtschaftsleistung dieser Länder mit jener der
Bundesrepublik insgesamt und ähnlich strukturierten (benachbarten)
Bundesländern vergleichen.
Dullien und die IMK-Forscher*innen
Dr. Ulrike Stein und Prof. Dr Alexander Herzog-Stein betrachten in
ihrer Studie: Erstens die Abschaffung des Buß- und Bettages in allen
Bundesländern außer Sachsen ab dem Jahr 1995, zweitens die einmalige
Ausdehnung des Reformationstages auf alle Bundesländer 2017,
drittens den erneuten Wegfall des arbeitsfreien Reformationstages in
vielen Bundesländern im Folgejahr, viertens die Einführung des
Internationalen Frauentages als gesetzlicher Feiertag in Berlin
2019, fünftens die Einführung des Weltkindertages in Thüringen im
selben Jahr und sechstens die Einführung des Internationalen
Frauentags als gesetzlicher Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern 2023.
Basis für die Analyse sind die Daten des Statistischen Bundesamts
zum jährlichen nominalen Bruttoinlandsprodukt auf Ebene der
Bundesländer.
Würde die einfache Gleichung aufgehen: „Weniger
Feiertage = Mehr Wirtschaftsleistung“, dann müsste man 1995 ein
niedrigeres Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Sachsen als in
anderen Bundesländern sehen, ebenso in Berlin und Thüringen 2019 und
in Mecklenburg-Vorpommern 2023.
2017 müsste das
Bruttoinlandsprodukt in jenen Bundesländern, die den Reformationstag
erstmals als gesetzlichen Feiertag begingen, langsamer gewachsen
sein als im Rest der Republik, 2018 dann in jenen Ländern stärker,
in denen der Reformationstag nicht mehr gesetzlicher Feiertag war.
Sachsen 1995: Beibehaltung des Buß- und Bettages
Tatsächlich
hat sich das Bruttoinlandsprodukt 1995 in Sachsen aber stärker
entwickelt als im Rest Deutschlands. Nominal wuchs die
Wirtschaftsleistung im Bundesschnitt um 3,4 Prozent, im ostdeutschen
Freistaat dagegen um 9,7 Prozent. Dabei stellen die Forschenden
natürlich in Rechnung, dass Mitte der 1990er Jahren noch der
wirtschaftliche Aufholprozess in Ostdeutschland lief. Es ist also
plausibel, dass Sachsens Wirtschaft deutlich schneller wuchs als
jene Gesamtdeutschlands.
Ein Vergleich mit den angrenzenden
ostdeutschen Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt
allerdings: Auch ihnen gegenüber legte das nominale BIP in Sachsen
1995 erheblich stärker zu, obwohl die beiden anderen Bundesländer
den Buß- und Bettag als Feiertag strichen. Der Vorsprung lag bei 3,7
Prozentpunkten gegenüber Sachsen-Anhalt und 4,3 Prozentpunkten
gegenüber Thüringen (siehe auch Abbildung 1).
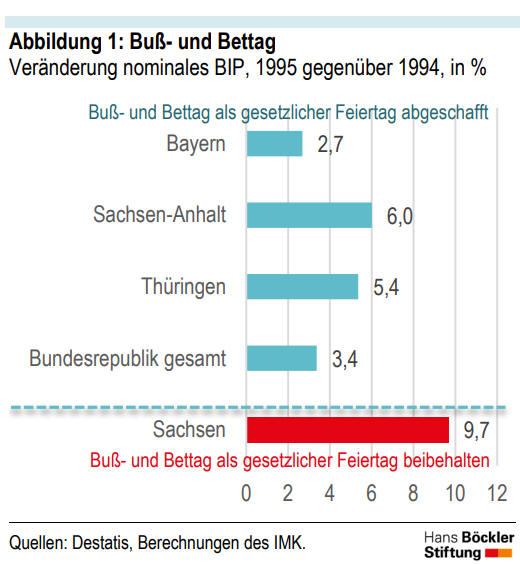
Reformationstag 2017 und 2018
2017 wurde anlässlich des 500.
Jahrestags der Reformation in allen Bundesländern der 31. Oktober
als gesetzlicher Feiertag begangen. In den ostdeutschen
Bundesländern, in denen der Feiertag schon zuvor gesetzlich
verankert war, fiel das nominale Wachstum in diesem Jahr tatsächlich
minimal um 0,2 Prozentpunkte stärker aus als in jenen Ländern, in
denen der Reformationstag einmalig arbeitsfrei war (Abbildung 2 in
der Studie).
Allerdings zeigte der Wegfall des Feiertages im
Folgejahr in den betroffenen Bundesländern wiederum keinen positiven
Effekt. 2018 war der 31. Oktober in Bayern, Baden-Württemberg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder
normaler Arbeitstag.
Vergleicht man das Wirtschaftswachstum
in diesen Bundesländern mit jenen westdeutschen Bundesländern, die
den Reformationstag 2017 als gesetzlichen Feiertag eingeführt haben
und 2018 beibehielten, so hatten die Bundesländer mit Wegfall des
Feiertages sogar ein minimal um 0,2 Prozentpunkte schwächeres
Wirtschaftswachstum als jene, die den Feiertag dauerhaft
beibehielten (Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein;
Abbildung 3).
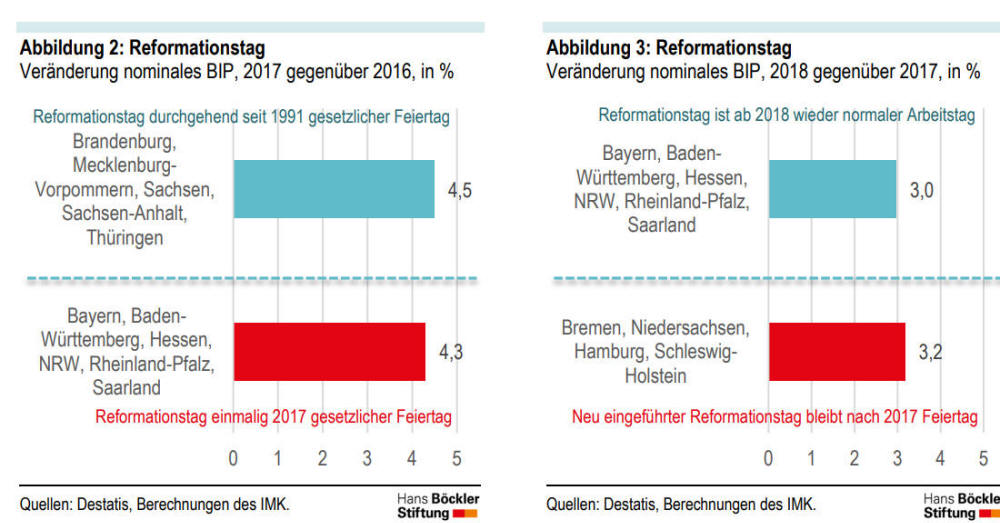
Internationaler Frauentag in Berlin und Weltkindertag in
Thüringen 2019
In Berlin wurde 2019 der Internationale Frauentag
am 8. März erstmals als gesetzlicher Feiertag begangen. Die
Wirtschaftsleistung in der Bundeshauptstadt entwickelte sich in dem
Jahr besser als im Bundesdurchschnitt: Der Vorsprung beim Wachstum
des nominalen BIPs lag bei 2,0 Prozentpunkten. Auch im Vergleich zu
den anderen beiden Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie dem
umliegenden Brandenburg wuchs das BIP in Berlin stärker, nicht
schwächer.
In Thüringen wurde ebenfalls 2019 der
Weltkindertag am 20. September als gesetzlicher Feiertag eingeführt.
Hier fiel das Wachstum um 0,4 Prozentpunkte niedriger aus als im
Bundesdurchschnitt (Abbildung 4).
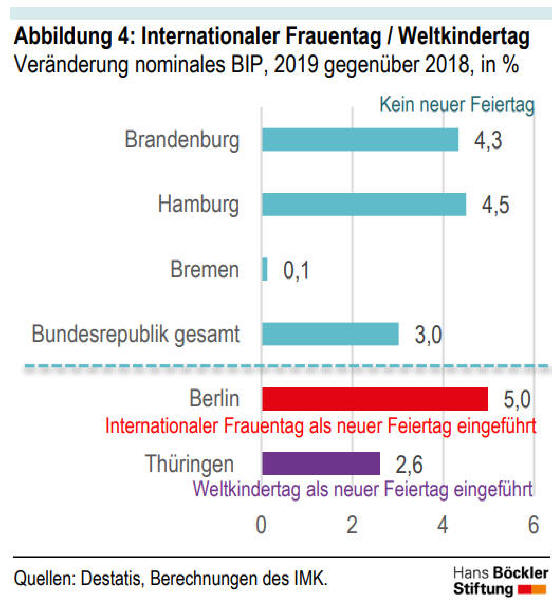
Internationaler Frauentag in Mecklenburg-Vorpommern 2023
In
Mecklenburg-Vorpommern wurde der Internationale Frauentag 2023
gesetzlicher Feiertag. Dort fiel das Wachstum höher aus als in der
Bundesrepublik insgesamt und im angrenzenden Bundesland
Schleswig-Holstein, allerdings niedriger als in Brandenburg und
Niedersachsen (Abbildung 5). Zu beachten ist hier laut IMK jedoch,
dass es sowohl für Niedersachsen als auch für Mecklenburg-Vorpommern
2023 Sonderfaktoren gab: In Stade wurde in dem Jahr ein LNG-Terminal
fertiggebaut und in Betrieb genommen.
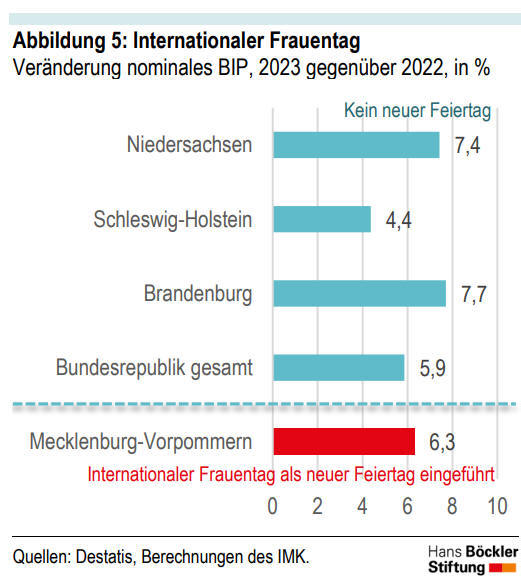
Mecklenburg-Vorpommern war zum einen besonders negativ von der
Unterbrechung der russischen Gaslieferungen durch die
Nordstream-Pipelines betroffen, gleichzeitig liefen die
Vorbereitungen für die Inbetriebnahme eines LNG-Terminals in Mukran
2024, die das BIP erhöht haben dürften. Von daher sei fraglich, wie
aussagekräftig letztlich dieses Beispiel ist.
Schaden weniger
Feiertage der Produktivität?
Dass ein Feiertag weniger keinen
klaren positiven Einfluss auf die Wirtschaftsleistung hat, erklären
die Forschenden des IMK einerseits mit der Flexibilität einer
modernen Volkswirtschaft: Unternehmen planen die Abarbeitung ihrer
Aufträge so, dass diese möglichst nicht an Feiertagen stattfindet,
auch, weil dann Zuschläge gezahlt werden. Unklar ist, ob ohne diese
Feiertage tatsächlich über das Jahr mehr produziert würde – wie es
die Befürworter*innen von Streichungen annehmen –, oder ob die
Produktion nur anders verteilt würde.
Viel spricht aber laut
IMK dafür, dass – auch in Zeiten vielerorts beklagten
Fachkräftemangels – die Nachfragesituation der Unternehmen der
bestimmende und begrenzende Faktor für die Produktion ist. So gaben
in den jüngsten Umfragen des Ifo-Instituts 36,8 Prozent der
Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes an, mangelnde Aufträge seien
ein Hindernis für die Produktion, während nur 17,5 Prozent sagten,
Personalmangel behindere die Produktion.
Hinzu kommt, dass
die gesamtwirtschaftliche Produktion nicht nur auf die geleistete
Zahl der Arbeitsstunden zurückgeht, sondern auch Produktivität und
Innovation eine wichtige Rolle spielen. „Denkbar ist, dass die
Beobachtung fehlender positiver Wachstumseffekte einer geringeren
Zahl an Feiertagen darauf zurückgeht, dass die geringere
Erholungszeit die Produktivität senkt“, schreiben Dullien, Stein und
Herzog-Stein.
Möglich sei auch der Effekt, dass
Erwerbstätige, die sich durch ihre Arbeit und andere Verpflichtungen
in Familie oder Haushalt stark belastet fühlen, zumindest mittel-
und langfristig als Reaktion auf die Streichung des Feiertages ihr
Arbeitsangebot an anderer Stelle zurückfahren, etwa durch die
Verringerung der Arbeitszeit in Teilzeitstellen oder die Aufgabe
eines zusätzlichen Minijobs. So gibt es Hinweise, dass während der
Covid-Pandemie Pflegekräfte als Reaktion auf die hohe Belastung ihre
Arbeitszeit verringert haben.
Ein Festival der Stimmen
bei der zweiten Nacht der Chöre
Wenn am Samstag, 28. Juni 2025 in der Evangelischen Kirche Duisburg
Obermeiderich, Emilstraße 27, die Sängerinnen und Sänger ihre
Stimmen erheben, dann wird der Abend beeindruckend musikalisch: Denn
zwölf Chöre aus den Duisburger Gemeinden haben sich angemeldet, um
bei der Nacht der Chöre jeweils in 20-Minuten-Slots ein Best of
ihres Repertoires zu geben.
Dabei reicht die stilistische
Breite von klassischer Chormusik und Werken der Alten Musik über
Neue Geistliche Lieder bis hin zu Gospel und Popsongs jüngerer Zeit.
Das Obermeidericher Gotteshaus wird so von 17 bis 22.30 Uhr mit
musikalischen Highlights umgeben.
Zur inzwischen zweiten
Nacht der Chöre laden die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker des
Evangelischen Kirchenkreises Duisburg herzlich ein. Nach der
erfolgreichen Premiere 2019 und einer langen Durststrecke für Chöre
durch die Corona-Zeit wollen sie jetzt wieder ein großes Fest der
Chormusik feiern.

Projektchor
Der genaue Zeitplan wird kurz vor der
Veranstaltung auf www.kirchenmusik-duisburg.de und
www.kirche-duisburg.de veröffentlicht. Die Besucherinnen und
Besucher können kommen und gehen, wann sie möchten. Für die
kulinarische Verpflegung sorgt das Team aus Obermeiderich um Peter
Fackert. Der Eintritt zur Nacht der Chöre ist frei.

Nacht der Chöre 2019 - Gospelchor Trinitatis
Klassische Klaviermusik beim Konzert in der Hamborner
Friedenskirche
Fans der klassischen Musik können sich auf das Konzert am 29. Juni
2025 in der Friedenskirche in Duisburg Hamborn, Duisburger Str. 176,
freuen. Denn dort wird die junge, mit Preisen ausgezeichnete
Pianistin Nihan Ulutan ihr Können am Klavier beweisen.

(Foto: www.nihanulutan.com).
Die Musikerin, die derzeit
ihren Masterstudiengang bei Paolo Giacometti an der Düsseldorfer
Robert Schumann Hochschule absolviert, spielt in Hamborn Mozarts
Klaviersonate KV.333, eine Klaviersonate von Leoš Janáček, von
Claude Debussy „2 Preludes (Des pas sur le neige - Hommage à S.
Pickwick Esq. P.P.M.P.C.)“ und von Ahmed Adnan Saygun „8 Preludes“.
Der Eintritt ist frei. Mehr Infos zur Künstlerin gibt es im Netz
unter www.nihanulutan.com.
Akkordeon-Orchester gibt Konzert in der Wanheimer Kirche
Das Ratinger Akkordeonorchester ist mit seinen
Konzerten seit über 60 Jahren fester Bestandteil des kulturellen
Lebens der Heimatstadt und hat erfolgreich an nationalen und
internationalen Wettbewerben teilgenommen. Jetzt ist es am 29. Juni
2025 um 17 Uhr zu Gast in der evangelischen Kirche in Wanheim und
präsentiert ein abwechslungsreiches Programm aus seinem großen
Musikrepertoire.
Mit Interpretationen bekannter Werke
unterschiedlichster Musikrichtungen zeigen die Akkordeonspieler die
große Bandbreite ihres Instrumentes. Und begeistert das Publikum mit
seiner Klangvielfalt, Dynamik und Virtuosität. Der Eintritt ist
frei, das Orchester freut sich über eine Spende.

Die evangelische Kirche Wanheim (Foto: Tanja Pickartz)
Kirche kocht und lädt zum kostenfreien Mittagessen nach
Untermeiderich
In der Evangelischen Gemeinde Meiderich
heißt es einmal im Monat „Kirche kocht“, denn im Begegnungscafé „Die
Ecke“, Horststr. 44a, stehen dann Ehrenamtliche an den Töpfen und
zaubern Leckeres; so zum Beispiel am 24. Juni, wenn sie um 12 Uhr
Nudelsalat mit Würstchen auftischen. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig, das Angebot ist kostenfrei.
„Wir wollen
Herzenswärme spenden, schöne Momente schenken und gemeinsam
Mittagessen!“ sagt Yvonne de Temple-Hannappel, die Leiterin des
Begegnungscafés (Tel. 0203 45 57 92 70, E-mail:
detemple-hannappel@gmx.de). Die Menüs für die nächsten Termine
stehen schon fest. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.kirche-meiderich.de.

Engagierte des Begegnungscafés „DIE ECKE“
Untermeiderich (Foto:
www.kirche-meiderich.de)

Bundestagswahl 2025: Ergebnisse
der repräsentativen Wahlstatistik
WIESBADEN, 23. Juni 2025 - Bei der Wahl zum
21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025
gaben 82,5 % der Wahlberechtigten ihre
Stimme ab. Damit lag die Wahlbeteiligung
gegenüber der Bundestagswahl 2021 um
6,2 Prozentpunkte höher und damit so hoch
wie seit der Bundestagswahl 1987 nicht mehr.
Detailliertere Ergebnisse liefert die
repräsentative Wahlstatistik des
Statistischen Bundesamtes (Destatis), die in
Deutschland bei Bundestags- und Europawahlen
durchgeführt wird.
Mit ihr lässt sich
das Wahlverhalten, das heißt die
Wahlbeteiligung und die Stimmabgabe, nach
Geschlecht und Geburtsjahresgruppe
analysieren. Für die repräsentative
Wahlstatistik zur Bundestagswahl 2025 wurden
1.790 Urnen- und 899 Briefwahlbezirke
ausgewertet. Damit waren rund
1,9 Millionen Wahlberechtigte und rund
1,6 Millionen Wählerinnen und Wähler in der
Stichprobe.
Wahlbeteiligung von
Jüngeren stärker gestiegen als von Älteren
Vor allem Wählerinnen und Wähler in den
Altersgruppen bis 44 Jahren beteiligten sich
an der Bundestagswahl 2025 deutlich stärker:
Ihre Wahlbeteiligung stieg gegenüber 2021
zwischen 7,1 und 8,3 Prozentpunkten.
Trotz der gestiegenen
Wahlbeteiligung von Jüngeren lag die
Wahlbeteiligung der bis 34-Jährigen unter
allen Wahlberechtigten unter dem
Durchschnitt. Am geringsten war sie in der
Altersgruppe 21 bis 24 Jahre mit 78,3 %
ausgeprägt. In den Altersgruppen ab 35 bis
69 Jahren fiel die Wahlbeteiligung
überdurchschnittlich aus, am höchsten bei
den 50- bis 69-Jährigen mit 85,5 %.
In der ältesten Altersgruppe
„70 Jahre und mehr“ verfestigt sich hingegen
ein Trend seit der Bundestagswahl 2017: Ihre
Wahlbeteiligung sank weiter unter den
Durchschnitt und lag jetzt bei 79,3 %. Mit
Ausnahme der ältesten Altersgruppe „70 Jahre
und mehr“ beteiligten sich Frauen häufiger
an der Wahl als die gleichaltrigen Männer.
Die Unterschiede sind in den
jüngeren Altersgruppen größer. In der
Altersgruppe ab 70 Jahren betrug die
Wahlbeteiligung der Männer 82,6 % und
entsprach damit nahezu dem
Bundesdurchschnitt. Frauen in dieser
Altersgruppe wählten bei einer
Wahlbeteiligung mit 76,8 % vergleichsweise
selten.
Einfluss der Generation
60plus auf das Wahlergebnis nimmt weiter zu
Die Zahlen der Wahlberechtigten in der
mittleren Generation zwischen 30 und
59 Jahren sowie in der älteren Generation ab
60 Jahren liegen inzwischen
demografiebedingt nahe beieinander. Während
die mittlere Generation unter allen
Wahlberechtigten 44,4 % ausmachte, lag der
Anteil der älteren Generation bei 42,6 %.
Bei der Bundestagswahl 2017 lagen
die Anteile noch bei 48,9 % für die mittlere
Generation und 36,3 % für die ältere
Generation, bei der Bundestagswahl 2021 bei
47,0 % bzw. 38,8 %. Zusammen mit ihrer
Wahlbeteiligung hat dadurch der Einfluss der
„60plus“-Generation noch mehr Einfluss auf
das Wahlergebnis genommen.
Keine
Partei war in allen erhobenen Gruppen
stärkste Kraft
Bezogen auf die
Zweitstimmenanteile war keine Partei
durchweg über alle Altersgruppen stärkste
Kraft. Bei den jüngsten Wählerinnen und
Wählern bis 24 Jahre dominierten Die Linke
(27,3 % aller gültigen Zweitstimmen), in den
darauffolgenden Altersgruppen von 25 bis 34
sowie 35 bis 44 Jahren jeweils die AfD
(20,8 % bzw. 27,1 %) und in den übrigen
Altersgruppen ab 45 Jahren die
Unionsparteien CDU und CSU (45 bis 59 Jahre:
28,7 %, 60 bis 69 Jahre: 31,6 % und 70 Jahre
und mehr: 41,4 ).
Die SPD erhielt
ihren stärksten Zuspruch von den ab
70-Jährigen mit 24,9 % (hinter den
Unionsparteien). Die GRÜNEN erzielten mit
15,9 % ihr bestes Ergebnis in der
Altersgruppe von 25 bis 34 Jahren (hinter
AfD und Die Linke). Nach Geschlecht wurden
die SPD (Differenz Frauen/Männer:
3,0 Prozentpunkte), GRÜNE
(1,9 Prozentpunkte), Die Linke
(2,9 Prozentpunkte) und das BSW
(1,3 Prozentpunkte) anteilig stärker von
Frauen gewählt.
Die Unionsparteien
CDU und CSU (Differenz Männer/Frauen:
0,7 Prozentpunkte), FDP (1,0 Prozentpunkte)
und AfD (8,5 Prozentpunkte) erhielten
hingegen mehr Zweitstimmen von den Männern.
FDP bei jüngeren Männern über der
Fünfprozenthürde, BSW bei Frauen unter 70
Hätte das Stimmverhalten der 18- bis
24-jährigen oder 25- bis 34-jährigen Männer
allein gezählt, hätte die FDP die 5-%-Hürde
überwunden (7,5 % bzw. 6,3 %) und somit an
der Sitzverteilung teilgenommen.
Hätten allein Frauen mit Ausnahme der
ältesten Altersgruppe ab 70 Jahren (zwischen
5,6 %und 6,7 %) oder die Männer zwischen 18
und 34 Jahren (5,0 % bzw. 5,3 %) entscheiden
dürfen, wäre das BSW erfolgreich in den
Bundestag gewählt worden. Die
unterdurchschnittlichen Stimmenanteile der
übrigen Altersgruppen verhinderten deren
Einzug.
Briefwahl eher von Älteren
und Frauen genutzt
Bei der
Bundestagswahl 2025 beantragten 32,3 % aller
Wahlberechtigten einen Wahlschein mit
Briefwahlunterlagen. Mit 36,2 % lag die
Antragsquote der ab 70-Jährigen unter allen
Wahlberechtigten am höchsten, am geringsten
bei den 18- bis 20-Jährigen (23,0 %). Von
den wahlberechtigten Frauen beantragten
34,2 % die Briefwahl, von den
wahlberechtigten Männern 30,3 %.
Bevölkerung Deutschlands wächst im
Jahr 2024 geringfügig um 0,1 %
• Zum Jahresende 2024 lebten knapp 83,6
Millionen Menschen in Deutschland
•
Erneut mehr Sterbefälle als Geburten –
Bevölkerungswachstum beruht auf
Wanderungsüberschuss
• 30 % der
Bevölkerung mindestens 60 Jahre alt
Zum Jahresende 2024 lebten knapp 83,6
Millionen Personen in Deutschland. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
ist die Bevölkerung in Deutschland somit im
Jahr 2024 um 121 000 Personen
beziehungsweise 0,1 % gewachsen, nachdem sie
im Vorjahr noch um 338 000 beziehungsweise
0,4 % zugenommen hatte. Diese Entwicklung
ergibt sich zum einem aus den Geburten und
Sterbefällen, zum anderen aus den
Wanderungsbewegungen.
Der Überschuss
der Sterbefälle über die Geburten war dabei
nach vorläufigen Ergebnissen mit +330 000
ähnlich hoch wie im Vorjahr. Der vorläufige
Wanderungssaldo, also die Differenz zwischen
den Zu- und Fortzügen über die Grenzen
Deutschlands, ist hingegen von +660 000 auf
+420 000 zurückgegangen. Das
Bevölkerungswachstum ist somit auch 2024 auf
den Wanderungsüberschuss zurückzuführen.
Zahl der Menschen zwischen 60 und
80 Jahren nimmt um 2,2 % zu
Die
Entwicklung der Bevölkerung fällt nach
Altersgruppen unterschiedlich aus. So nahm
die Zahl der 60- bis 79-Jährigen um 416 000
(+2,2 %) zu, während die Zahl der 40- bis
59-Jährigen um 323 000 beziehungsweise 1,4 %
abnahm. Diese entgegengesetzten
Entwicklungen können vor allem darauf
zurückgeführt werden, dass der
geburtenstarke Jahrgang 1964 im Jahr 2024 in
die Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen
gewechselt ist.
Die Zahl der Kinder
und Jugendlichen unter 20 Jahre
(15,6 Millionen) sowie die Zahl der jüngeren
Erwachsenen zwischen 20 und 39 Jahren
(20,3 Millionen) hat sich dagegen kaum
verändert. Neben der Zahl der 60- bis
79-Jährigen nahm auch die Zahl der Personen
im Alter von 80 Jahren und älter mit +14 000
auf 6,1 Millionen Menschen (+0,2 %) leicht
zu.
Insgesamt waren
25,5 Millionen Personen 60 Jahre oder älter,
das entpricht 30,5 % der Bevölkerung in
Deutschland. Ausländeranteil liegt bei
14,8 % Die ausländische Bevölkerung wuchs
2024 um 283 000 auf 12,4 Millionen (+2,3 %),
während die deutsche Bevölkerung um 162 000
auf 71,2 Millionen zurückging (-0,2 %).
Infolgedessen erhöhte sich der
Ausländeranteil von 14,5 % Ende 2023 auf
14,8 % Ende 2024.
Die Anteile fallen
je nach Altersgruppe jedoch unterschiedlich
aus: Am höchsten ist der Ausländeranteil in
der Altersgruppe 20 bis 59 Jahre mit 19,7 %,
am niedrigsten bei den ab 60-Jährigen mit
6,3 %. Bei den Kindern und Jugendlichen
unter 20 Jahre liegt der Ausländeranteil bei
15,4%. Die größte ausländische Gruppe bilden
wie in den vergangenen Jahren Türkinnen und
Türken (1 403 000), gefolgt von
Staatsangehörigen aus der Ukraine
(1 085 000), Syrien (889 000), Rumänien
(771 000) und Polen (723 000).
Zensus 2022: Kinder, Jugendliche und Erwachsene
mittleren Alters leben immer seltener in
Wohneigentum
* Menschen im
Alter von 24 bis 32 Jahren wohnen besonders
häufig zur Miete
* Ab einem Alter von 49
Jahren leben die meisten Menschen im
Eigentum
* Rückgang der Eigentumsquoten
betrifft vor allem Personen unter 72 Jahren
Zum Zensusstichtag am 15.05.2022
lebten in NRW 46,8 % der Personen in
Wohneigentum. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches
Landesamt mitteilt, waren es beim Zensus
2011 noch 49,8 %. Junge Erwachsene zwischen
24 und 32 lebten besonders häufig in
Mietverhältnissen, während ältere Erwachsene
ab 49 sowie Seniorinnen und Senioren eher in
Wohneigentum wohnten.
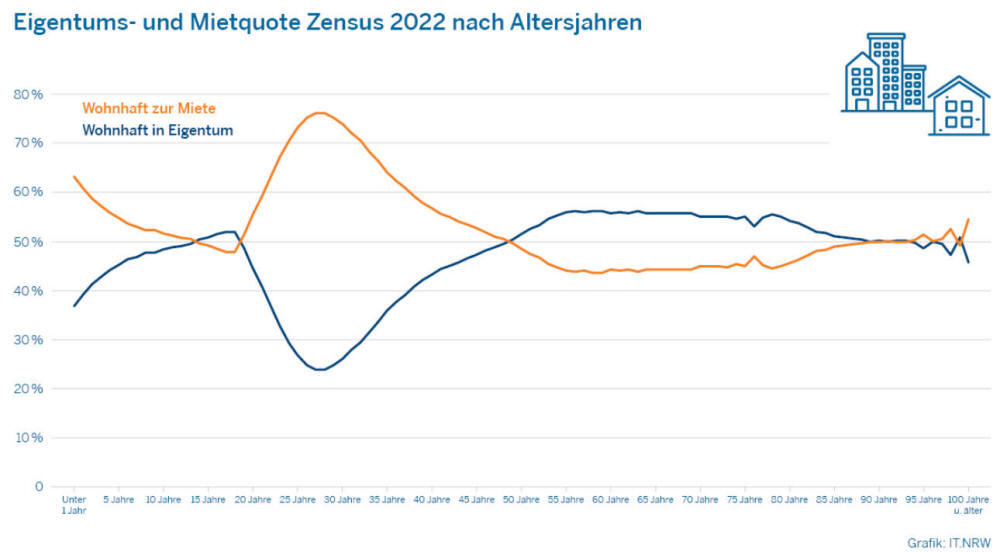
Über alle Altersgruppen betrachtet, lag
die Mietquote im Alter von 27 mit 76,1 % am
höchsten. Die höchste Eigentumsquote, also
Personen, die in Wohneigentum lebten, wiesen
die 58- und 59-Jährigen mit 56,2 % auf.
Personen unter 72 Jahren leben 2022 seltener
in Wohneigentum als 2011 – Ältere hingegen
häufiger Ab einem Alter von 49 Jahren lag
die Eigentumsquote für Erwachsene höher als
die Mietquote.
Beim Zensus 2011 war
dieser Wendepunkt bereits bei einem Alter
von 41 Jahren erreicht. Beim detaillierten
Vergleich der Eigentumsquote zwischen dem
Zensus 2011 und 2022 ist zu erkennen, dass
in fast allen Altersgruppen unter 72 die
Wohneigentumsquote gesunken ist.
Besonders deutlich wird dies bei Kindern und
Jugendlichen sowie Erwachsenen mittleren
Alters. So lebten 57,2 % der
nordrhein-westfälischen Kinder im Alter von
13 Jahren im Jahr 2011 noch in Haushalten,
die im Eigentum wohnten. 2022 waren es
dagegen nur 49,5 %. Das entspricht einem
Rückgang von 7,7 Prozentpunkten.
Ähnlich sah es bei Erwachsenen im Alter von
43 Jahren aus: Sie wohnten 2011 noch zu
53,2 % im Eigentum, während 2022 nur 45,8 %
dieses Alters in den eigenen vier Wänden
lebten (- 7,4 Prozentpunkte). Dagegen hat
die Eigentumsquote im hohen Alter
zugenommen: Für Personen im Alter von über
72 Jahren hat die Eigentumsquote zwischen
2011 und 2022 zugenommen.
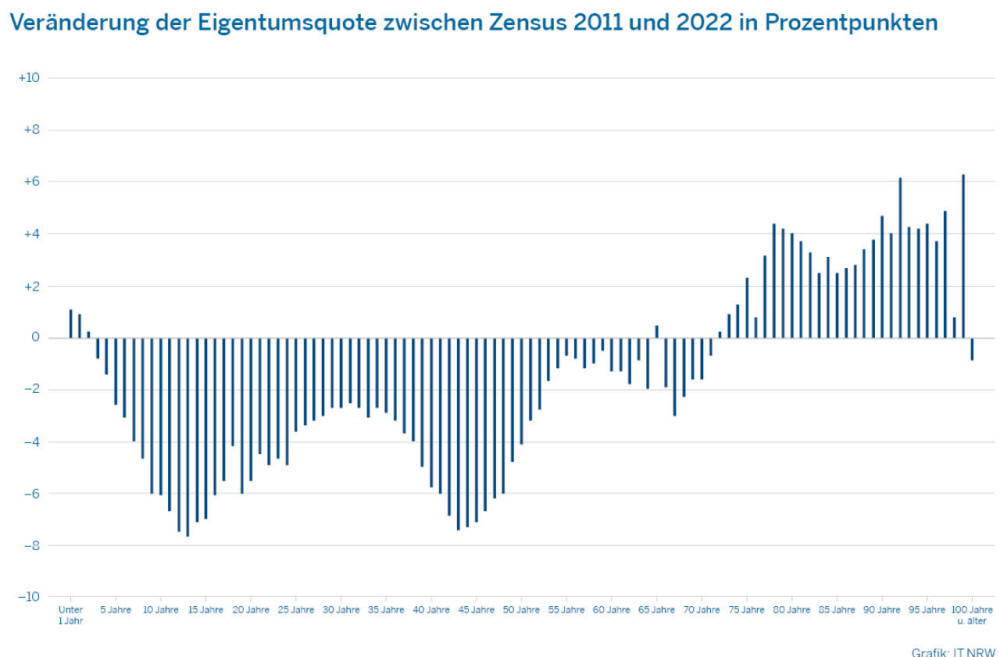
Den größten Anstieg über alle
Altersjahre hinweg gab es im Alter von 99
und 92 Jahren. Demnach lebten in diesem
Alter mit +6,3 bzw. +6,2 Prozentpunkten mehr
Menschen in Wohneigentum als 2011.