






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 42. Kalenderwoche:
16. Oktober
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Freitag, 17. Oktober 2025
EU-Fahrplan zur Wahrung des Friedens – Verteidigungsbereitschaft
2030
Die Europäische Kommission und die Hohe
Vertreterin der EU für Außen und Sicherheitspolitik Kaja Kallas
haben den EU-Mitgliedstaaten den „Fahrplan zur Wahrung des Friedens
– Verteidigungsbereitschaft 2030“ vorgeschlagen. Dieser Plan soll
die europäischen Verteidigungsfähigkeiten stärken.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte: „Die jüngsten
Bedrohungen haben gezeigt, dass Europa in Gefahr ist. Wir müssen
alle Bürgerinnen und Bürger und jeden Quadratzentimeter unseres
Territoriums schützen. Europa muss mit Einheit, Solidarität und
Entschlossenheit reagieren. Der Verteidigungsfahrplan enthält einen
klaren Plan mit gemeinsamen Zielen und konkreten Meilensteinen auf
unserem Weg bis 2030. Denn nur was sich messen lässt, wird auch
getan.“
Vier Leitinitiativen für die europäische
Bereitschaft In dem Fahrplan werden vier Leitinitiativen für die
europäische Bereitschaft vorgeschlagen: Europäische
Drohnen-Verteidigungsinitiative, Eastern Flank Watch, Europäischer
Luftschild und Verteidigungsraumschild.
Diese vier
Initiativen werden die Verteidigungsindustrie stärken, die
Produktion beschleunigen und die Unterstützung für die Ukraine
aufrechterhalten.
Wie vom Europäischen Rat im Juni gefordert,
werden im Verteidigungsfahrplan klare Ziele und Etappenziele zur
Schließung von Fähigkeitslücken, zur Beschleunigung der
Verteidigungsinvestitionen in allen Mitgliedstaaten und als
Richtschnur für die Fortschritte der EU auf dem Weg zur
vollständigen Verteidigungsbereitschaft bis 2030 festgelegt. Die
Stärkung der Verteidigung Europas bedeutet auch, fest gegenüber der
Ukraine zu stehen.
Neues Besucherzentrum im Landschaftspark Duisburg-Nord
Der Landschaftspark Duisburg-Nord erhält einen positiven
Förderbescheid von der Bezirksregierung Düsseldorf für die
Neukonzeption seines Besucher- und Informationszentrums.
Für das
Projekt stehen insgesamt 3,9 Millionen Euro zur Verfügung. Davon
werden 3,1 Millionen Euro (80 Prozent) aus dem EFRE/JTF-Programm NRW
2021–2027 finanziert. Den verbleibenden Eigenanteil von 20 Prozent
trägt die Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (DKH) als
Betreiberin des Landschaftsparks.
Mit der Förderung
entsteht in den kommenden Jahren ein moderner und zentraler Ort der
Information und Vermittlung – das neue Herzstück des
Landschaftsparks. Das Besucherzentrum soll in der alten Zentralen
Messwarte entstehen, die künftig allen Besuchenden als erster
Anlaufpunkt dienen wird. Das Gebäude liegt in unmittelbarer
Sichtweite des Haupteingangs und auf der Achse aller
Hauptwegeverbindungen im Park. Die bislang ungenutzte Messwarte soll
bis 2028 umfassend saniert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden.
„Die Neukonzeption eines Besucher- und
Informationszentrums im Landschaftspark ist ein bedeutender Schritt
in Richtung einer nachhaltigen und innovativen Zukunft für den
Park“, freut sich Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link.
„Es entsteht ein moderner Ort, der unseren Landschaftspark zeitgemäß
und umfangreich vermitteln wird. Die Bewilligung unseres
Förderantrags ist ein wichtiger Beitrag zur kulturellen,
touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung Duisburgs.“
Auch der Geschäftsbereichsleiter des Landschaftsparks, Frank
Jebavy, betont die Bedeutung der Förderung: „Nach fast 30 Jahren
Betrieb wollen wir unseren Besucherinnen und Besuchern den
Landschaftspark noch umfassender zugänglich machen. Die neue
Messwarte wird ein Ort, an dem Industriekultur, Industrienatur und
die Geschichte des Hüttenwerks erlebbar werden.“
Das neue
Besucherzentrum soll erstmals auch die Arbeits- und Sozialgeschichte
des Hüttenwerks integrieren. Ziel ist es, Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft des Standortes anschaulich zu verknüpfen und die
Identität der gesamten Region zu stärken.
Weitere
Informationen unter www.efre.nrw
Der Landschaftspark feierte im letzten Jahr sein 30-jähriges
Bestehen. Mit durchschnittlich 1,2 Millionen Besuchenden pro Jahr
gehört er zu den beliebtesten Natur- und Kulturlandschaften in
Nordrhein-Westfalen und ist mit rund 250 Veranstaltungen jährlich
eine feste Größe in der Region.

v.l.: Peter Hoppe,
Bezirksbürgermeister Duisburg-Meiderich Christoph Späh,
nebenamtlicher Geschäftsführer der beiden städtischen
Tochtergesellschaften Duisburg Kontor GmbH und Duisburg Kontor
Hallenmanagement GmbH Frank Jebavy, Parkleitung Edeltraud Klabuhn,
Bürgermeisterin der Stadt Duisburg, Uwe Kluge, hauptamtlicher
Geschäftsführer der beiden städtischen Tochtergesellschaften
Duisburg Kontor GmbH und Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH. Foto
©Thomas Berns
Mario-Kart-Stadtmeisterschaft der Duisburger Kinder- und
Jugendzentren
Auf der „Nintendo Switch“ flitzen Mario,
Luigi, Peach, Yoshi, Donkey Kong, Bowser und Co. wieder um die
Wette. Die Rede ist von den Mario-KartStadtmeisterschaft der
Duisburger Kinder- und Jugendzentren. Ausgetragen werden diese am
Freitag, 17. Oktober, ab 12 Uhr im städtischen Kinder- und
Jugendzentrum „Die Insel“, Benediktstraße 46, 47059 Duisburg.
Bereits seit Wochen werden in den Duisburger Jugendzentren
interne Turniere ausgetragen, um dann die jeweils zwei besten
Spielerinnen und Spieler an der Konsole zum Turnier zu schicken, die
dort ihre Einrichtungen vertreten. Insgesamt sind elf Teams
angemeldet. „Die Insel“ richtet bereits seit 2017 jährlich die
FIFA-Stadtmeisterschaft der Duisburger Kinder- und Jugendzentren aus
und wird dabei tatkräftig durch den KellaRindaClan
(www.lan-duisburg.de) unterstützt, der auch dieses Mal den
technischen Support und die Spielleitung übernimmt.
Neben
dem Wanderpokal werden die ersten drei Plätze mit
Einkaufsgutscheinen und die dahinterstehenden Einrichtungen mit
einer Budgetaufstockung belohnt. Als besonderer Clou werden die
Teilnehmenden aber nicht einfach vor einer Konsole auf Stühlen,
sondern in liebevoll von den Einrichtungen selbst gestalteten
Holzkarts sitzen. Auch dafür wird es einen Preis geben.
Ungefährer Ablaufplan 12 Uhr Eröffnungsrede / Aufbau der Geräte
12.40 Uhr Ligasystem (3 Spieltage)
14.30 Uhr Mittagessen
15.10 Uhr Ligasystem (3 Spieltage)
17.20 Uhr Halbfinale H1,
Qualifikationsspiele um die Plätze 9 - 32
18 Uhr Halbfinale H2,
Endspiele um die Plätze 9 - 32
18.40 Uhr Finale 19.50 Uhr
Siegerehrung
Bezirksbibliothek Großenbaum: Lesung
mit Igal Avidan
Die Bezirksbibliothek Großenbaum in der
Gesamtschule Süd und der Bürgerverein Duisburg-Großenbaum/Rahm laden
am Freitag, 24. Oktober, um 19 Uhr, in die Räumlichkeiten an der
Großenbaumer Allee 168-174, zu einer in Lesung mit dem israelischen
Journalisten und Autor Igal Avidan ein.
Igal Avidan liest
aus einem Buch „… und es wurde Licht!“ über eine bewegte israelische
Gesellschaft, in der Juden und Araber längst ein Zusammenleben
gefunden haben. Geboren wurde Igal Avidan 1962 in Tel Aviv. In
Israel hat er zunächst Englische Literatur und Informatik und
anschließend dann in Berlin Politikwissenschaft studiert.
Der
Nahostexperte arbeitet als freier Berichterstatter aus Berlin für
israelische und deutsche Zeitungen und Hörfunksender. Der Eintritt
ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
RVR
Ruhr Grün bietet wieder Kaminholz aus heimischen Wäldern an
Jetzt kann es muckelig werden: Rechtzeitig zum Start der
Heizsaison öffnet der Eigenbetrieb des Regionalverbandes Ruhr (RVR
Ruhr Grün) immer freitags seinen Kaminholzverkauf am Heidhof in
Bottrop, Zum Heidhof 25.
Das Holz gibt es für Selbstabholer
jeden Freitag von 13 bis 16 Uhr. Ab Oktober findet der Verkauf auch
am ersten und dritten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr statt.
Vorgelagerte Scheite kosten 130 Euro je Schüttraummeter, frisches
Holz 110 Euro je Schüttraummeter. Scheite aus der Gitterbox (0,7
Schüttraummeter) kosten 90 Euro. idr
Logistikmarkt Ruhrgebiet steigert
Umsätze / Region liegt im bundesweiten Ranking auf Platz zwei
Der Logistikmarkt im Ruhrgebiet befindet sich im
Aufwind: Mit einem Flächenumsatz von rund 357.000 Quadratmetern in
den ersten drei Quartalen hat die Region bereits jetzt das
Gesamtjahresresultat von 2024 erreicht (358.000 Quadratmeter). Im
Ranking der bedeutendsten Logistikregionen liegt das Ruhrgebiet
damit aktuell auf dem zweiten Rang hinter Frankfurt (399.000
Quadratmeter).
In der isolierten Betrachtung des dritten Quartals
ist die Metropole Ruhr sogar führend. Das zeigt eine Analyse des
Immobiliendienstleisters BNP Paribas Real Estate. Die Flächenumsätze
im Ruhrgebiet sind seit Jahresbeginn von Quartal zu Quartal
gestiegen. Mit rund 156.000 Quadratmetern zwischen Anfang Juli und
Ende September wurde das beste Quartalsergebnis seit Q4 im Jahr 2023
erzielt. Die Analysten erwarten, dass die Region den Schwung in das
Schlussquartal mitnehmen kann.
Das dynamische Marktgeschehen
spiegelt sich auch in der Mietpreisentwicklung wider. Sowohl die
Spitzen- (8 Euro/m²) als auch die Durchschnittsmiete (6,50 Euro/m²)
haben um fünf Prozent im Vorjahresvergleich zugelegt. Infos:
http://www.realestate.bnpparibas.com Pressekontakt: BNP Paribas
Real Estate Holding GmbH, Pia Ewald, Telefon: 069/29899-941, E-Mail:
pia.ewald@bnpparibas.com - idr
167 Schulwege überprüft:
Nur 5 Prozent als sicher eingestuft – ACE-Schulweg-Index deckt
Risiken für Grundschulkinder auf
Wie sicher ist der
tägliche Schulweg wirklich? Dieser Frage ist der ACE Auto Club
Europa im Rahmen seiner 20. Clubinitiative nachgegangen. Unter dem
Motto „Easy Going“ wurde bundesweit die Schulwegsicherheit von rund
49.000 Grundschulkindern untersucht.
Im Fokus standen bei
der systematischen Analyse sowohl der morgendliche Bringverkehr als
auch die Infrastruktur vor der Schule. Das Ergebnis ist alarmierend:
Nur 5 Prozent der 167 überprüften Schulwege konnten als sicher
bewertet werden. Knapp ein Drittel (30 Prozent) schnitt mangelhaft
ab, sechs Prozent wurden sogar als gefährlich eingestuft. Der
ACE-Schulweg-Index 2025 zeigt deutlich, dass noch immer viel zu
viele Schulwege in Deutschland unsicher sind.
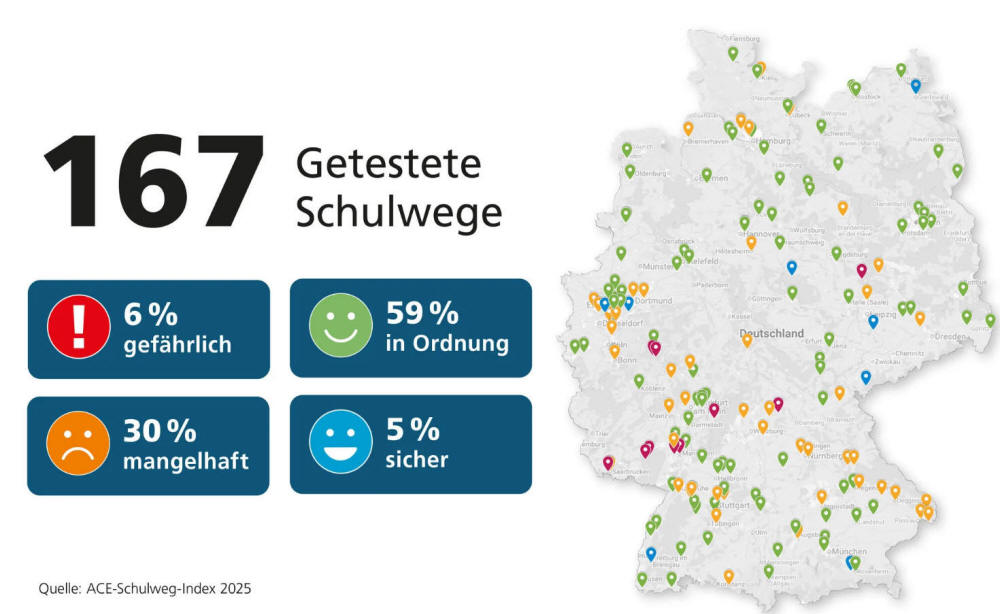
41 Prozent der Elterntaxis missachten Verkehrsregeln
Vor
Schulbeginn steigt die Unfallgefahr durch Elterntaxis: Allein das
erhöhte Verkehrsaufkommen führt regelmäßig zu chaotischen und
unübersichtlichen Situationen vor den Schulen. Hinzu kommen riskante
Wendemanöver, zugeparkte Gehwege und das Aussteigen von Kindern zur
Fahrbahnseite hin.
All diese Aspekte hat der ACE bei der
Untersuchung der 6.422 beobachteten Elterntaxis bundesweit unter die
Lupe genommen. Dabei wurde in 41 Prozent der Fälle gegen
Verkehrsregeln verstoßen: am häufigsten durch Halten im Halteverbot
(20 Prozent), in Einfahrten (8 Prozent) oder auf Gehwegen und in
zweiter Reihe (je 6 Prozent).

Trotz Verbot und vor laufendem ACE-Check hält ein Elterntaxi an.
ACE-Foto
Komplett fehlerfrei verhielt sich der Bringverkehr
nur an zwei Schulen: der Grundschule am Waldrand in Schwedt
(Brandenburg) und an der Sebastianschule in Rosendahl
(Nordrhein-Westfalen). Hier wurde nicht regelwidrig gehalten, alle
Kinder sind zur sicheren Gehwegseite aus dem Auto gestiegen und auch
beim Abfahren ist es zu keinen zusätzlichen Risiken durch
Wendemanöver oder Rückwärtsfahrten gekommen. Ganz anders an der
Nordstadtschule in Pforzheim (Baden-Württemberg), bei der die
ACE-Testerinnen und -Tester im morgendlichen Bringverkehr die
meisten Fehler bundesweit beobachteten: Im Schnitt fuhren nur 14
Prozent der Elterntaxis fehlerfrei.
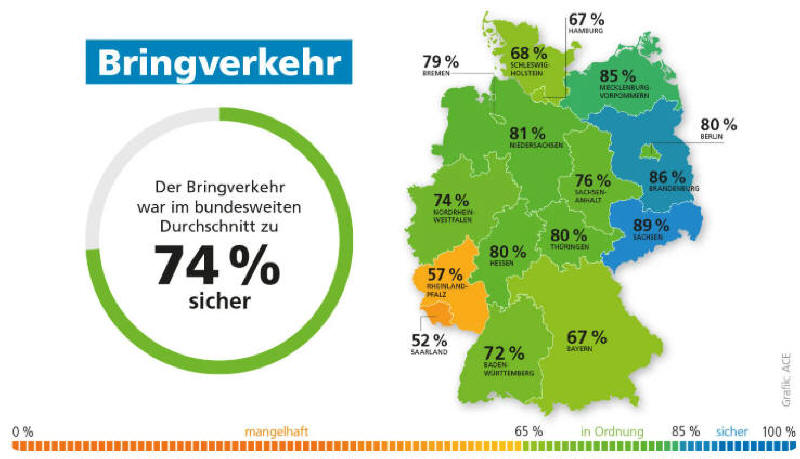
Grafiken ACE
Große Unterschiede beim Bringverkehr Vor
Schulbeginn steigt durch Elterntaxis die Unfallgefahr: Riskante
Wendemanöver, zugeparkte Gehwege und falsches Aussteigen machen den
Schulweg chaotisch und gefährlich.
Entsprechend haben
die ACE-Ehrenamtlichen nicht nur ermittelt, ob Elterntaxis
verkehrswidrig gehalten haben, sondern auch zu welcher Seite das
Kind das Auto verlassen hat und ob beim Abfahren weitere Risiken,
etwa durch Wendemanöver oder Rückwärtsfahrten, verursacht wurden.
Der Durchschnitt der fehlerfreien Elterntaxis in allen
drei Kategorien ist hier abgebildet. Schlusslicht ist
Rheinland-Pfalz, Spitzenreiter ist Sachsen.
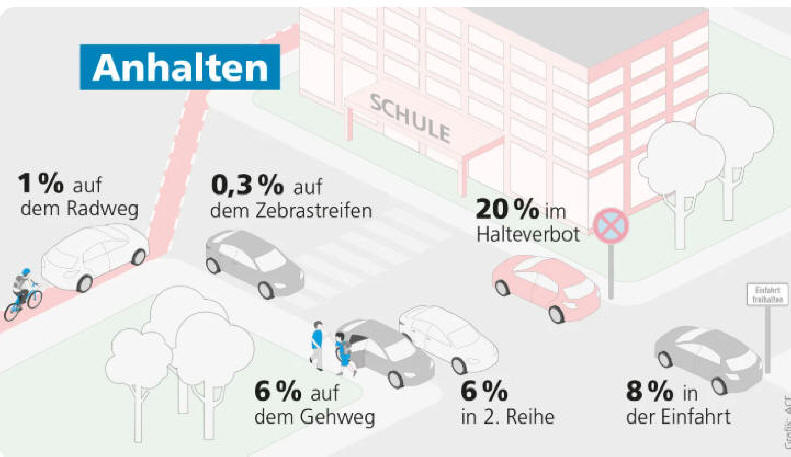
Elterntaxis: Luft nach oben beim Anhalten Unsere Erhebung zeigte
auch, dass durch Elterntaxis für die Schülerinnen und Schüler
zahlreiche unterschiedliche Gefahrensituationen zustande kamen: Von
den 6.422 beobachteten Elterntaxis hielten 20 Prozent im
Halteverbot, 8 Prozent in der Einfahrt, jeweils 6 Prozent auf dem
Gehweg oder in zweiter Reihe, um die Kinder aus dem Wagen zu lassen.
Ingesamt verhielten sich 41 Prozent der dokumentierten Elterntaxis
verkehrswidrig.
Bei der Betrachtung der Bundesländer war der
Bringverkehr in Sachsen mit 89 Prozent am sichersten. Am
schlechtesten schnitten das Saarland (52 Prozent) und
Rheinland-Pfalz (57 Prozent) ab. Während unserer Checks wurden wir
vereinzelt von Schulen oder engagierten Eltern angesprochen, die
sich ebenfalls eine Überprüfung wünschten. Diesem Wunsch sind wir,
wenn möglich, nachgekommen. Besonders viele dieser angefragten Tests
fanden in Rheinland-Pfalz statt.
Infrastruktur oft nur
„befriedigend“
Auch beim Blick auf die Verkehrsinfrastruktur
zeigt sich ein gemischtes Bild. Zwar ist erfreulicherweise vor 92
Prozent der Schulen das Tempo auf 30 km/h beschränkt, doch die
sicherste Lösung – eine Spielstraße oder verkehrsberuhigte Zone –
fand sich nur bei 6 Prozent der Schulen. In 8 Prozent der Fälle
fehlte jegliche Querungshilfe, ob Ampel, Zebrastreifen oder
Mittelinsel. Im Ländervergleich schneiden die nordöstlichen
Bundesländer am besten ab: Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg
erreichen durchschnittlich 9,6 von 14 möglichen Punkten, während
Rheinland-Pfalz (7,7 Punkte) und das Saarland (7,5 Punkte) am
schlechtesten bewertet wurden.
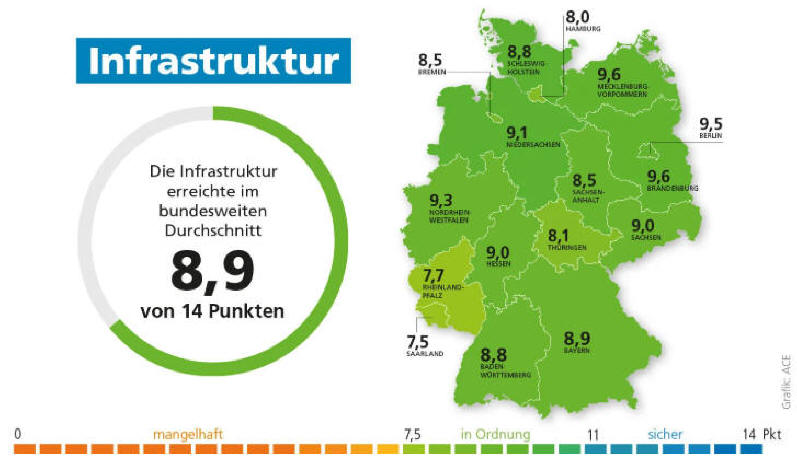
Mit 4,5 Punkten wurden bundesweit die wenigsten Punkte für die
Infrastruktur der Ganztagesgrundschule in Stendal (Sachsen-Anhalt)
vergeben. Gleich vier Schulen teilen sich mit je 12 Punkten den
ersten Platz in Sachen Infrastruktur: Grundschule Passau-Grubweg in
Passau (Bayern), Grundschule Grundschöttel in Wetter/Ruhr (NRW), GGS
Herderstraße in Leverkusen (NRW) und Overbergschule in Lingen/Ems
(Niedersachsen).
Die Gefahren sind da – wir müssen jetzt
handeln
Der ACE-Schulweg-Index zeigt deutlich, dass es noch viel
zu viele Risiken auf dem Schulweg gibt. Um sie zu beseitigen, müssen
Akteure wie Landes- und Kommunalverwaltung, Schulen und Eltern
gemeinsam Verantwortung übernehmen. Unser ACE-Handlungsdreieck
zeigt, wie konsequente Kontrollen, verständliche Aufklärung und eine
sichere Infrastruktur dafür ineinandergreifen müssen.
„Der
ACE-Schulweg-Index 2025 zeigt alarmierende Zahlen: Nur 5 Prozent der
untersuchten Schulwege sind sicher. Noch immer werden zu viele
Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zur Schule verletzt – manche
leider auch getötet. Es ist dringend notwendig, die
Verkehrsinfrastruktur weiter systematisch zu verbessern und auch den
Umgang mit Elterntaxis zu ändern.
Bund, Länder, Kommunen, Eltern und
alle Verkehrsteilnehmenden müssen jetzt gemeinsam handeln – jedes
Kind zählt“, fordert Manfred Wirsch, Präsident des Deutschen
Verkehrssicherheitsrats (DVR) und Schirmherr der diesjährigen
ACE-Clubinitiative.
„Unsere engagierten Ehrenamtlichen haben
bundesweit ganz genau hingeschaut und damit ein realistisches Bild
der Schulwegsicherheit geschaffen. Leider ist das Ergebnis
ernüchternd: Noch immer starten viele Kinder ihren Tag in einem
Umfeld, das für sie schlicht zu gefährlich ist. Damit dürfen wir uns
nicht abfinden, sondern müssen den Umstand als Auftrag an uns alle
verstehen: Infrastruktur verbessern, Elterntaxis vermeiden und
Kinder besser schützen. Jeder Schulweg muss sicher sein“, ergänzt
Sven-Peter Rudolph, Vorsitzender des ACE Auto Club Europa.
Über die Erhebung
Seit 2005 führt der ACE mit seinem Ehrenamt
jährlich bundesweite Clubinitiativen durch, die sich mit aktuellen
Themen der Verkehrssicherheit befassen. In diesem Jahr wurden von
April bis Ende Juli Infrastruktur und Bringverkehr vor 167
Grundschulen bundesweit durch die 700 ACE-Ehrenamtlichen vor Ort
überprüft.
Der Bringverkehr wurde jeweils 30 Minuten vor Schulbeginn
beobachtet. Die schulnahe Infrastruktur wurde im Bereich von 200
Metern in beide Richtungen vom Schultor aus anhand eines
standardisierten Kriterienkatalogs begutachtet. Partner der
diesjährigen Clubinitiative ist der DVR. Weiterführende
Informationen:
ACE-Schulweg-Index 2025 (PDF)
KrebsStiftung NRW
Musik hilft heilen: Innovative Charity-Aktion unterstützt
Krebsbetroffene in Nordrhein-Westfalen
Die KrebStiftung
Nordrhein-Westfalen hat im September die Aktion „Musik hilft heilen“
(musikhilftheilen.de)
gestartet #musikhilftheilen ist eine Aktion für Musikbegeisterte und
Menschen, die sich für den guten Zweck begeistern Mitmachen können
alle Personen ab 16 Jahren, die in den sozialen Netzwerken aktiv
sind oder sich engagieren möchten
Seit ihrer Gründung 2009
fördert die KrebsStiftung Nordrhein-Westfalen (NRW) Projekte sowie
Initiativen zur Prävention, Therapie, Nachsorge und der
onkologischen Forschung. Und zwar mit Maßnahmen, die den Menschen in
NRW unmittelbar zugutekommen.
„Wir arbeiten intensiv daran,
Krebsbetroffene und ihre Angehörigen im ganzen Bundesland zu
unterstützen – und das in unterschiedlichen Bereichen und mit
verschiedenen Angeboten“, erklärt Dr. Dieter Niederacher,
Vertretungsberechtigter Vorstand der KrebsStiftung NRW.
„Daher haben wir im September mit einer ganz besonderen Kampagne
gestartet: ‚Musik hilft heilen‘. Ziel ist das Sammeln von Spenden –
allerdings fern ab von herkömmlichen Spendenaufrufen. Denn wir
wollen die Leidenschaft zur Musik für den gute Zweck nutzen.“ Die
Kampagne läuft bis Ende des Jahres.
Jede:r kann mitmachen!
Mitmachen kann jede Person, die Spaß an Musik hat und bei Social
Media aktiv ist. Hierfür veröffentlichen die Teilnehmenden einen
kurzen Clip – Gesang, Tanz oder Instrumental – auf ihren
Social-Media-Accounts und verlinken auf die Kampagne „Musik hilft
heilen“. Follower und Fans haben nun die Möglichkeit, einen selbst
gewählten Geldbetrag zu spenden.
„Wir freuen uns über alle,
die diese Charity-Kampagne unterstützen – und natürlich auch über
jeden Euro, den wir hierdurch sammeln“, betont Niederacher.
Gemeinsam könne man so weiterhin Krebsbetroffene in
Nordrhein-Westfalen unterstützen. „Und das dank eines interaktiven
Austauschs und unterhaltender und Mut machender Musikbeiträge – das
ist eine echte Win-Win-Situation.“
Alle Spenden kommen
vollständig den Projekten und Aktionen der Krebsgesellschaft
Nordrhein-Westfalen e.V. zugute, die Betroffene und ihre Angehörigen
unterstützen. Investitionen für die Entwicklung und Umsetzung der
#musikhilftheilen-Aktion werden mittels eigener Gelder der
KrebsStiftung und durch Fördernde gedeckt.
Großer Dank
gilt den Sponsor:innen und Unterstützer:innen
„Wir freuen uns
sehr, dass sich bereits viele Privatpersonen aber auch Unternehmen
bei ‚Musik hilft heilen‘ angemeldet haben und erste Spenden und
musikalische Beiträge eingegangen sind“, so Niederacher.
Insbesondere das Engagement von Firmen, Stiftungen und Institutionen
sei wichtig, um die Botschaft und die Kampagne bekannt zu machen.
Und das tun viele aus voller Überzeugung.
Als Sponsor:innen
dabei sind zum Beispiel Four 20 Pharma aus Paderborn, Allbau und die
Essener Agentur AnotherNew. Zu den Fördernden gehören unter anderem
die Peter Frankenheim Stiftung, der BKK Nordwest Landesverband, die
Commerzbank Stiftung sowie die Kommunikationsagentur Heyst aus
Essen. Die Motivation treffend zusammengefasst hat Four 20 Pharma
auf der individuellen Landingpage des Unternehmens: „Wenn das Leben
aus dem Takt gerät, können zwei Dinge helfen, den Rhythmus
wiederzufinden: Musik und Medizin. Musik erreicht die Seele, gibt
Menschen Halt und Zuversicht, wenn die Worte fehlen.“
In
diesem Sinne hoffen Niederacher, seine Mitstreiter:innen der
KrebsStiftung und alle Supporter, dass noch viele weitere Menschen,
Institutionen, Vereine und Unternehmen die Kampagne unterstützen.
Weiterführende Links: Kampagnen-Trailer für Social Media,
Funk & Fernsehen:
https://musikhilftheilen.de/ Projektvorstellung per Video mit
WDR-Moderator Tobias Häusler:
https://musikhilftheilen.de/frontpage/ueber-das-projekt Kurzes
Erklärvideo zur Funktionsweise der Kampagne (nach Anlegen eines
Profils):
https://musikhilftheilen.de/frontpage/so-kannst-du-mitmachen
Die KrebsStiftung Nordrhein-Westfalen wurde 2009 gegründet,
um Projekte und Initiativen zur Prävention, Therapie und Nachsorge
sowie die onkologische Forschung aktiv zu fördern. Und zwar mit
Maßnahmen, die den Menschen in NRW unmittelbar zugutekommen.
Die Stiftung geht aus einer Initiative der Krebsgesellschaft
Nordrhein-Westfalen e.V. hervor. Das heißt, bereits als „junge“
Stiftung befand sie sich in einem Netzwerk, das seit mehr als 65
Jahren kontinuierlich gewachsen ist. Mehr Kompetenz und mehr Nähe zu
Forschenden, Onkolog:innen, Betreuer:innen und Betroffenen sind kaum
vorstellbar. Weitere Informationen gibt es auf der
Website der KrebsStiftung
NRW.
Außenführung: „ÜBERSEeHEN in
Duisburg.“ - Kolonialismus in der Innenstadt
Das
Zentrum für Erinnerungskultur bietet am Freitag, 17. Oktober, um 17
Uhr ab dem Haupteingang des Kultur- und Stadthistorischen Museums am
Johannes-Corputius-Platz (Innenhafen) eine Feierabendführung zu den
kolonialen Spuren in Duisburg an. An welchen Ecken gab es in
Duisburg Kolonialwarenläden? Gab es Duisburgerinnen und Duisburger,
die als Soldaten, Missionare oder Siederinnen in die Kolonialgebiete
reisten?
Welche Spuren hat dieses dunkle Kapitel der
Geschichte in Duisburg hinterlassen – und wie wirken sich koloniale
Denkmuster und rassistische Stereotype bis heute aus? Die Führung
wird von Naomi Dibu, Politikwissenschaftlerin und kuratorische
Assistentin, gemeinsam mit Christa Frins, wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Zentrums für Erinnerungskultur und Kuratorin der
Ausstellung „ÜBERSEeHEN.
Auf (post)kolonialer Spurensuche in
Duisburg“, geleitet. Im Fokus stehen vergessene oder übersehene
Orte, die zeigen, wie der Kolonialismus Duisburg und seine
Bevölkerung geprägt hat. Dabei wird auch thematisiert, wie
rassistische Bilder und Vorurteile, etwa durch Völkerschauen und
andere Formen der Schauvorführung, verbreitet und stereotype
Vorstellungen von Menschen aus den Kolonialgebieten reproduziert
wurden.
Die Teilnahme ist kostenlos. Bei schlechtem Wetter
findet die Führung im Museum durch die Ausstellung „ÜBERSEeHEN“
statt.
Wirtschaftsbetriebe führen Kanalbauarbeiten
in Hochheide durch
Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg
beginnen am 20. Oktober mit Kanalbauarbeiten in der Glückaufstraße
in Duisburg-Hochheide. Auf einer Gesamtstrecke von 90 Metern muss
der Schmutzwasserkanal erneuert werden, dafür muss die
Glückaufstraße stückweise vollgesperrt werden. Der Baustellenbereich
befindet sich zwischen dem Straßeneingang an der Moerser Straße und
der Glückaufstraße 10.
Die Verlegung der neuen
Schmutzwasserrohre erfolgt in offener Bauweise, außerdem werden neue
Kontrollschächte gesetzt. Hinzu kommen 42 Meter Altrohre, die für
das Kanalnetz nicht mehr erforderlich sind. Diese Rohre werden im
Rahmen der Bauarbeiten außer Betrieb genommen und verfüllt.
Der Wochenmarkt auf dem Bürgermeister-Bongartz-Platz findet auch
während der Bauarbeiten statt, lediglich die Platzierung der
Marktstände muss baustellenbedingt leicht angepasst werden. Die
Arbeiten werden voraussichtlich Mitte Januar 2026 abgeschlossen.
Grippesaison 2025/26: Neue Impfstoffalternative für alle
Personen ab dem Alter von 60 Jahren
Bekanntmachung
eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine
Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie: Umsetzung „STIKO-Empfehlung
zur Erweiterung der Indikations- und beruflichen
Indikationsempfehlung zur saisonalen Influenza-Impfung“:
Der
Beschluss vom 4. September 2025 wurde im Bundesanzeiger (BAnz AT
14.10.2025 B1) veröffentlicht und tritt am 15. Oktober 2025 in
Kraft.
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die
aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) zur
Impfung gegen die saisonale Grippe in die Schutzimpfungs-Richtlinie
übernommen. Nach Einschätzung der STIKO sind zwei wirkungsverstärkte
Impfstofftypen besser als der Standard-Impfstoff geeignet, eine
Grippe (Influenza) und mögliche Komplikationen zu verhindern.
Deshalb können alle Personen ab dem Alter von 60 Jahren in der
Grippesaison 2025/26 entweder mit einem
Hochdosis-Influenza-Impfstoff oder mit einem MF59-adjuvantierten
Influenza-Impfstoff geimpft werden – jeweils mit aktueller, von der
Weltgesundheitsorganisation empfohlener Antigenkombination. Mit der
Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie schafft der G-BA die
Planungsgrundlage für die Impfstoff-Beschaffung für die Grippesaison
2025/26.
Hintergrund: Leistungsansprüche auf
Grippeschutzimpfungen Voraussetzung für die Aufnahme einer
Schutzimpfung in den Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) ist eine Empfehlung der beim Robert
Koch-Institut angesiedelten STIKO. Auf Basis der STIKO-Empfehlungen
legt der G-BA – spätestens zwei Monate nach deren Veröffentlichung –
die Einzelheiten zur Leistungspflicht der GKV in der
Schutzimpfungs-Richtlinie fest.
Spontaner Besuch aus
den Philippinen in Duisburg
Im Rahmen ihrer
Deutschlandaufenthalte schauten letzte Woche Gäste aus den
Philippinen auch im Evangelischen Kirchenkreis Duisburg vorbei. Dr.
Jamelle Justine Cataag von der United Church of Christ in the
Philippines (UCCP) sowie Pfarrerin Jurcelyn Astudillo, Priscilla
Pascua-Quezon und Manathaleo Quezon trafen Christiane
Schmidt-Holzschneider, die seit vielen Jahren die Partnerschaft des
Kirchenkreises mit der „Southern Tagalog Conference“ der UCCP
mitträgt, zum Gespräch.
Mit dabei war Skriba Pfarrerin
Sabine Schmitz, die die die Gäste im Namen des Kirchenkreises
begrüßte. Zusammen mit Pfarrer Sören Asmus sprachen sie über die
Partnerschaft, die den Kirchenkreis mit der „Southern Tagalog
Conference“ verbindet. Thema der Begegnung waren auch die
Menschenrechte in den Philippinen.
Diakon Claudio Gnypek von
der Vereinten Evangelischen Mission war beeindruckt von den
Gesprächen: „Unsere Partnerkirche engagiert sich stark für
Menschenrechte, davon können wir auch etwas lernen.“ Bei aller
Unterschiedlichkeit sei wichtig, „dass wir als Kirchen in der
Gesellschaft die Stimme erheben, wenn es z.B. um Gerechtigkeit
geht.“

Im Bild zu sehen sind vor dem Duisburger Haus der Kirche, Am
Burgacker, (v.l.) Sabine Schmitz, Jurcelyn Astudillo, Sören Asmus,
Dr. Jamelle Justine Cataag, Claudio Gnypek, Christiane
Schmidt-Holzschneider, Priscilla Pascua-Quezon (Foto: Manathaleo
Quezon)
Dr. Cataag war im Rahmen einer internationalen
Gesundheitskonferenz der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) in
Deutschland und wollte kurz vor ihrer Rückkehr schnell noch Duisburg
besuchen, da ihr Vater früher in der Partnerschaft aktiv war und vor
vielen Jahren auch den Kirchenkreis besucht hatte.
Priscilla
Pascua-Quezon ist Mitarbeiterin der Vereinten Evangelischen Mission
und hatte selbst im Rahmen eines Freiwilligenjahres der VEM im
Kirchenkreis Duisburg gearbeitet. Zusammen mit ihrem Ehemann
Manathaleo und der VEM-Pfarrerin Astudillo fuhren sie nach Duisburg
und wurden vor Ort von Christiane Schmidt-Holzschneider und Diakon
Claudio Gnypek (VEM) begleitet.
Aktionsstart am
25.10. - Kirchengemeinde sammelt Weihnachtspäckchen für Kinder in
Not und bittet um Mithilfe
Viele Kinder dieser Welt
wissen nicht, was es heißt, persönliche Geschenke zu bekommen, da
sie zusammen mit ihren Familien in ärmlichsten Verhältnissen leben.
Ihnen wollen Engagierte in der Evangelischen Versöhnungsgemeinde
Duisburg-Süd zu Weihnachten eine Freude machen. Deshalb ist die
Gemeinde wieder bei der Aktion „Weihnachtspäckchen für Kinder in
Not“ mit dabei. Sie konnte im letzten Jahr ein Strahlen auf
mindestens 37.000 kleine Gesichter zaubern.
Die
diesjährige Sammelaktion startet im Duisburger Süden am 25. Oktober.
Der Karton kann dann – gerne mit einer freiwilligen
Transportkostenbeteiligung - zu den Öffnungszeiten im Gemeindebüro
an der Lauenburger Allee (0203 76 11 20 oder evgds@ekir.de) zu den
Gottesdiensten in den Kirchen der Versöhnungsgemeinde in Ungelsheim,
Großenbaum und Huckingen sowie in Gemeindezentren abgegeben werden.
Nach dem 25. November finden die Weihnachtspäckchen über die
Stiftung „Kinderzukunft“ ihren Weg zu Kindern nach Bosnien,
Herzegowina, Rumänien und auch in die Ukraine. Wer mag, legt ganz
nach dem Motto „Was zum Waschen, was zum Naschen, was zum Fühlen,
was zum Spielen, was zum Wärmen und was zum Lernen“ einige
Süßigkeiten, Spielsachen und Kleidung wie etwa Handschuhe in einen
Schuhkarton, verpackt ihn zu einem schönen Geschenk und kennzeichnet
mit einem Aufkleber, für welche Altersgruppe und welches Geschlecht
die Weihnachtsfreude gedacht ist.

Detailinfos zur Aktion: Die Weihnachtspäckchen gehen über die
Stiftung an Kinder und Jugendliche in Osteuropa. Kinderdörfer und
Partnerorganisationen in den Projektländern stellen sicher, dass die
Päckchen bei den Bedürftigen ankommen. Die Mädchen und Jungen sind
im Kindergarten- und Schulalter, der Großteil ist zwischen sechs und
zwölf Jahren.
Es werden aber auch Jugendliche bis 18 Jahre
beschenkt. Mehr Infos zur Aktion gibt es im Netz unter
www.kinderzukunft.de, Infos und Kontakte zur Gemeinde gibt es unter
www.evgds.de.

„Weihnachtspäckchen für Kinder in Not“ (Foto:
www.kinderzukunft.de).
Bach, Telemann und David und
Goliath Konzert und Lesung im Neudorfer Gemeindezentrum
Musik kann starke Emotionen wecken. Dass sie auch Geschichten
erzählen kann, erlebt das Publikum am 26. Oktober um 16 Uhr im
Neudorfer Gemeindezentrum, Wildstr. 31. Im Zentrum stehen drei
Sonaten aus dem Zyklus „Biblische Historien“ des Leipziger
Thomaskantors Johann Kuhnau (1660–1722). Sie veranschaulichen die
alttestamentlichen Erzählungen, wie etwa den Streit zwischen David
und Goliath, musikalisch.
Pfarrer Sören Asmus trägt
begleitende Texte aus dem Notenmaterial vor und führt mit seiner
Moderation durch das Konzert. Zwischen den biblischen Historien
erklingen Werke von Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach
für Viola da Gamba und Cembalo. Kirchenmusikerin Ada Tanir spielt
auf ihrem zweimanualigen Cembalo, an der Viola da Gamba ist Torben
Klaes als Gastmusiker zu hören. Der Eintritt ist frei. Infos zur
Gemeinde gibt es im Netz unter
www.hochfeld-neudorf.de.

Ada Tanir und Torben Klaess (Foto: Alex Muchnik).
Okko Herlyn und Heike Kehl geben Hüsch und Jazz... in
Wanheimer Kirche
Hanns Dieter Hüsch wäre in diesem Jahr
100 geworden. Doch seine Texte und Lieder von Himmel und Erde, Komik
und Tragik, Zärtlichkeit und Widerstand haben bis heute eine
erstaunliche Aktualität behalten. Das zeigen Kabarettist Okko Herlyn
und Sängerin Heike Kehl am 26. Oktober 2025 um 17 Uhr in der
evangelischen Kirche in Duisburg Wanheim, Friemersheimer Straße –
Ecke Wanheimer, mit ihrem Programm „Weil mich mein Gott das Lachen
lehrt“.
Heike Kehl ist bekannt als bühnenerfahrene
Rezitatorin und ausdrucksstarke Jazzsängerin, Dr. Okko Herlyn ist
ehemaliger Gemeindepfarrer in Duisburg Wanheim, Theologieprofessor,
Liedermacher und ausgezeichneter Kabarettist. In der Beschreibung
zum aktuellen Programm heißt es: „Unverwechselbar seine wild
wuchernden Geschichten aus der niederrheinischen Provinz, seine
konsequent antifaschistische Haltung gegen Rassismus, Ausgrenzung,
Gewalt und Krieg, seine Vision vom „großen Menschenhaus“, in dem
Geschwisterlichkeit, Solidarität und vor allem Humor wohnen.
Seine nur scheinbar naive Frömmigkeit, sein Glaube an den Gott
der Zukurzgekommenen und Spurenlosen, der Geknickten und
Gekränkten.“ Das Ganze wird im Wanheimer Gotteshaus begleitet mit
Hüschs eigenen Liedern und weiteren einfühlsamen Jazz-Standards. Der
Eintritt ist frei, Spenden sind gerne gesehen.

Okko Herlyn und Heike Kehl (Foto: Tom Thöne).

Sterbefallzahlen im 3. Quartal 2025 unter den mittleren
Werten der Vorjahre
Im 3. Quartal 2025 sind in
Deutschland nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) rund 228 000 Menschen gestorben. Die Sterbefallzahlen
lagen in allen drei Monaten unter den mittleren Werten der vier
Vorjahre: im Juli um 1 %, im August um 3 % und im September um 4 %.
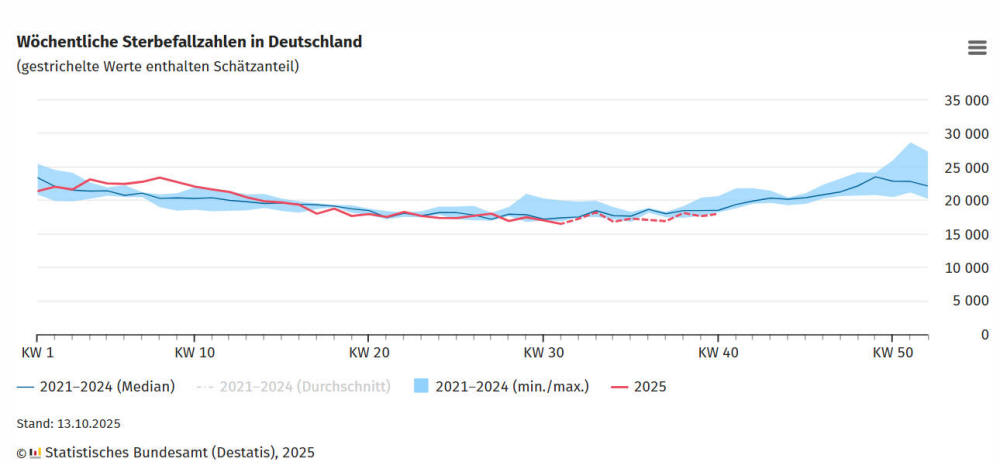
Die Entwicklung der Sterbefallzahlen in den Sommermonaten der
Vergleichsjahre war zum Teil durch Hitzewellen oder noch durch die
Corona-Pandemie geprägt. Derartige Einflüsse blieben im Sommer 2025
größtenteils aus, was die vergleichsweise niedrigen Sterbefallzahlen
in den diesjährigen Sommermonaten erklären kann.
Lediglich
Anfang Juli waren die Sterbefallzahlen während einer Hitzewelle
kurzzeitig gegenüber dem mittleren Wert der Jahre 2021 bis 2024
erhöht (+5 % in Kalenderwoche 27 vom 30. Juni bis 06. Juli). Dass im
Zusammenhang mit Hitze die Sterbefallzahlen ansteigen können, ist
ein bekannter Effekt, der in Sommermonaten bereits häufiger
beobachtet wurde.
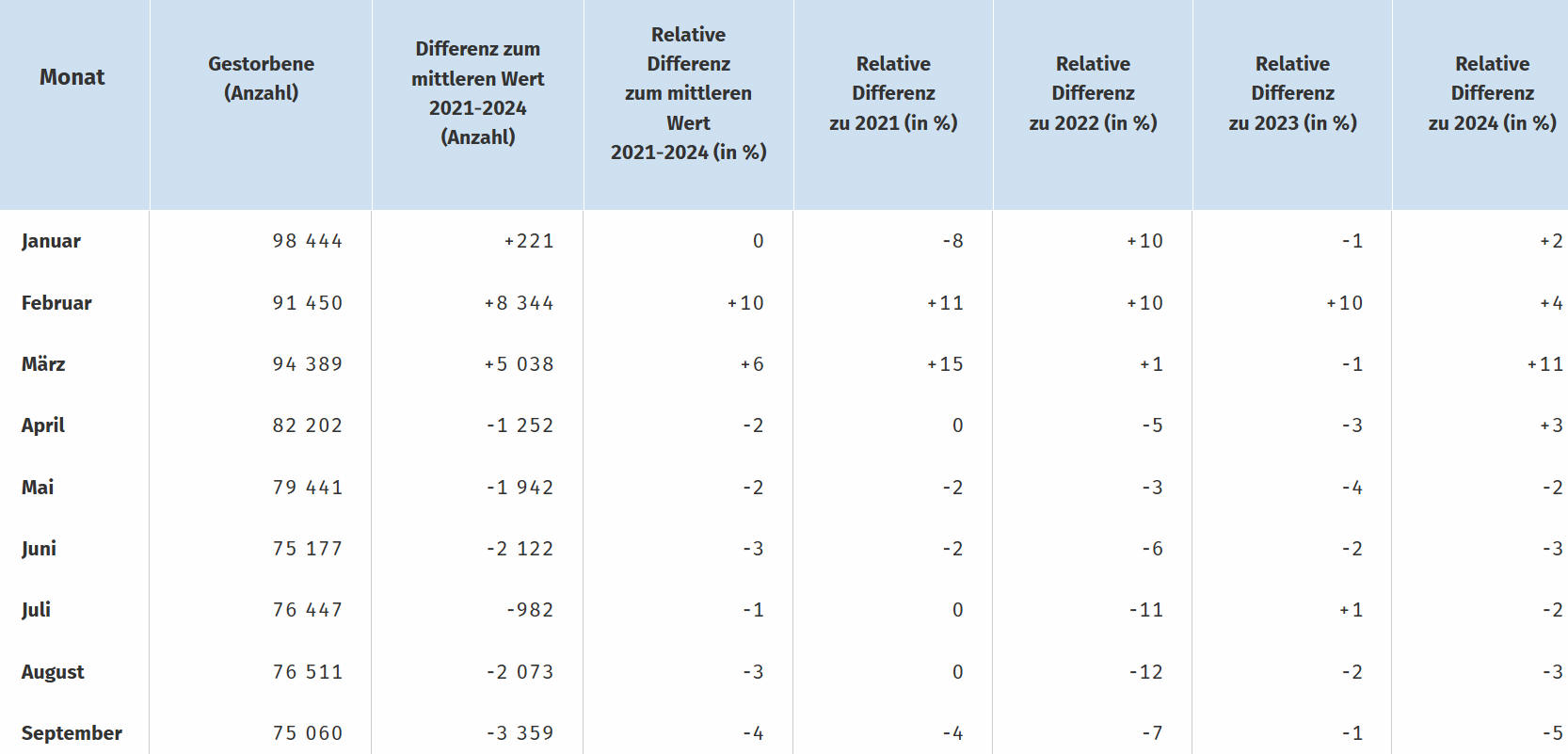
Öffentliche Schulden im 2. Quartal 2025 um 1,2 % höher
als im Vorquartal
Öffentlicher Schuldenstand steigt um
30,6 Milliarden Euro auf 2 554,0 Milliarden Euro
Der
Öffentliche Gesamthaushalt war beim nicht-öffentlichen Bereich zum
Ende des 2. Quartals 2025 mit 2 554,0 Milliarden Euro verschuldet.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen
Ergebnissen mitteilt, stieg die öffentliche Verschuldung damit
gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % oder 30,6 Milliarden Euro. Zum
Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden
und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung
einschließlich aller Extrahaushalte.
Zum nicht-öffentlichen
Bereich gehören Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und
ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und
Ausland. Schulden des Bundes erhöhen sich um 1,8 % Die Schulden des
Bundes stiegen zum Ende des 2. Quartals 2025 gegenüber dem
Vorquartal um 30,9 Milliarden Euro (1,8 %). Unter anderem hat das
"Sondervermögen Bundeswehr" seine Verschuldung um 9,2 % oder
2,4 Milliarden Euro auf 28,3 Milliarden Euro erhöht.
Schulden der Länder reduzieren sich um 5,7 Milliarden Euro
Die
Länder waren zum Ende des 2. Quartals 2025 mit 609,8 Milliarden Euro
verschuldet, dies entspricht einem Rückgang um 5,7 Milliarden Euro
(-0,9 %) gegenüber dem Vorquartal. Prozentual am stärksten gegenüber
dem Vorquartal sanken die Schulden in Sachsen-Anhalt (-3,7 %), in
Baden-Württemberg und Niedersachsen (jeweils -2,6 %).
Der
stärkste Schuldenanstieg gegenüber dem Vorquartal wurde für
Mecklenburg-Vorpommern mit +5,5 % ermittelt. Auch in
Schleswig-Holstein (+2,8 %) und Hessen (+2,5 %) stiegen die Schulden
vergleichsweise stark. Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände
wachsen um 3,1 % Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden nahm die
Verschuldung zum Ende des 2. Quartals 2025 gegenüber dem Vorquartal
zu. Sie stieg um 5,4 Milliarden Euro (+3,1 %) auf
179,8 Milliarden Euro.
Den höchsten prozentualen
Schuldenanstieg gegenüber dem Vorquartal wiesen dabei die Gemeinden
und Gemeindeverbände in Brandenburg (+5,7 %) auf, gefolgt von
Rheinland-Pfalz (+5,1 %) und Schleswig-Holstein (+4,2 %). Einen
Rückgang der Verschuldung gab es wie schon im 1. Quartal 2025
lediglich in Thüringen (-0,6 %). Die Verschuldung der
Sozialversicherung sank im 2. Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal
um 0,2 Millionen Euro (-1,7 %) auf 9,7 Millionen Euro.
NRW-Industrie: Absatzwert der Glas-
und Glaswarenproduktion 2024 um mehr als 9 % gesunken
*
Absatzwert das zweite Jahr in Folge rückläufig
* Rückgang setzt
sich auch in der ersten Jahreshälfte 2025 fort
* NRW-Anteil am
Bundesabsatzwert unverändert
Im Jahr 2024 sind in 76
produzierenden Betrieben des nordrhein-westfälischen Verarbeitenden
Gewerbes im energieintensiven Industriebereich der Glas- und
Glaswarenproduktion Waren im Wert von 1,9 Milliarden Euro
hergestellt worden. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, war der
Absatzwert damit um nominal 9,1 % niedriger als ein Jahr zuvor und
sank somit bereits das zweite Jahr in Folge.
Im
Zehnjahresvergleich wurde der geringste Absatzwert im Jahr 2020
erzielt. Beinahe alle Glassparten mit rückläufiger Produktion Auch
im Jahr 2024 entfiel der größte Anteil am gesamten Absatzwert mit
62,6 % auf den Bereich „Herstellung von Flachglas”, das u. a. für
Fensterscheiben genutzt wird. Der Absatzwert sank hier um 6,3 %
gegenüber dem Vorjahr.
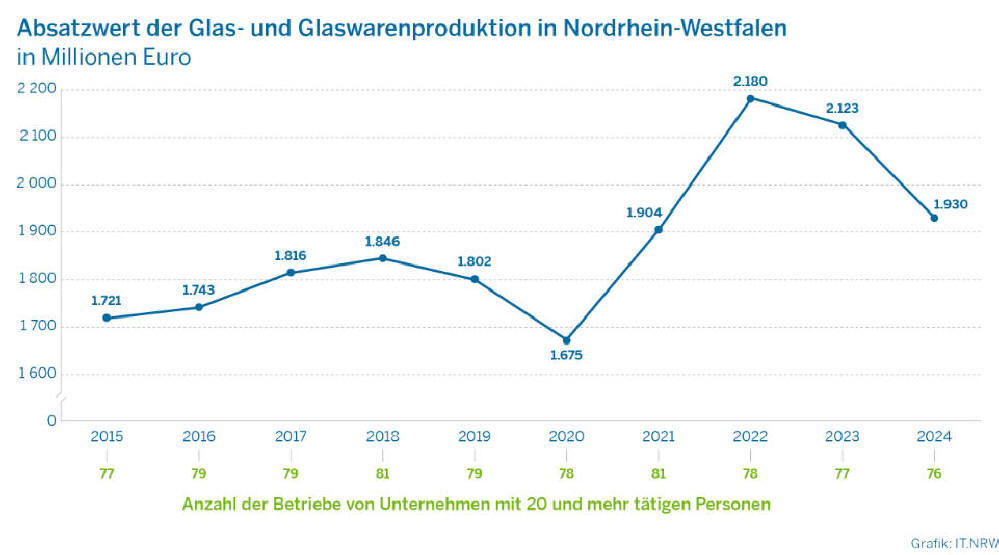
Der Absatzwert von Hohlglas – dazu zählen Einmachgläser,
Flaschen, Trinkgläser, Vasen und Geschirr aus Glas – verringerte
sich um 24,0 %. Im Bereich Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und
Waren daraus (ohne Gewebe) sank der Absatzwert um 2,6 %. Der
Absatzwert von sonstigem Glas, wie z. B. Bruchglas, Glasabfälle und
nicht bearbeitetes Glas, stieg hingegen um 1,3 % gegenüber dem
Vorjahr.
NRW-Anteil am bundesweiten Absatzwert bleibt
unverändert
Auch bundesweit ging der Wert der Glas- und
Glaswarenproduktion im Jahr 2024 auf 10,5 Milliarden Euro zurück;
damit sank der Wert um 8,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der NRW-Anteil
am bundesweiten Absatzwert von Glas und Glaswaren blieb unverändert
und lag wie im Vorjahr bei 18,3 %.
Regierungsbezirk Köln
weiterhin auf dem ersten Platz beim Absatzwert von Glas und
Glaswaren in NRW
Mit 30,5 % wurde der größte Anteil des
nordrhein-westfälischen Absatzwertes von Glas und Glaswaren2024 in
Betrieben des Regierungsbezirkes Köln erzielt. Es folgten die
Betriebe in den Regierungsbezirken Münster (21,5 %), Düsseldorf
(17,2 %), Arnsberg (16,3 %) und Detmold (14,5 %).
Absatzwert
in der ersten Jahreshälfte 2025 geringer als im Vorjahreszeitraum
aber höher als im ersten Halbjahr 2020
Im ersten Halbjahr 2025
produzierten nach vorläufigen Ergebnissen 76 nordrhein-westfälische
Betriebe Glas und Glaswaren im Wert von 949,3 Millionen Euro. Das
waren 4,2 % weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, aber
16,5 % mehr als im ersten Halbjahr 2020.