






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 45. Kalenderwoche:
8. November
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Montag, 10. November 2025
Internationale Kinderbuchausstellung der
Stadtbibliothek 2025: „Demokratie…ganz einfach“
Die Duisburger Stadtbibliothek lädt wieder zur Internationalen
Kinderbuchausstellung (IKiBu) ein. Mehr als 50 Jahre IKiBu in
Duisburg stehen für Begeisterung an Literatur, Freude am Lesen und
Begegnungen, die Kinder stärken und ihre Neugier wecken. Vom 10. bis
15. November geht es in diesem Jahr um das Thema „Demokratie … ganz
einfach!“.
In den Bibliotheken und an anderen Orten gibt es
dazu ein vielfältiges Programm mit Geschichten, Theater, Musik und
Kreativität rund um das Thema. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt,
was Freiheit, Vielfalt und Toleranz für uns bedeutet, und warum sie
so wichtig sind. Vormittags richten sie sich die Angebote an Schulen
und Kindertageseinrichtungen, die Veranstaltungen am Nachmittag und
am Samstag stehen allen offen.
Am Samstag, 15. November,
findet der traditionelle Aktionstag zum Abschluss der IKiBu in der
Zentralbibliothek statt. Hier wird die gesamte Kinder- und
Jugendbibliothek zur Veranstaltungsfläche: es spielt Musik, es wird
gebastelt und gespielt. Spaß und Kreativität stehen im Vordergrund,
damit das Thema der IKiBu noch einmal mit allen Sinnen erfahrbar
wird. Mit dem Komma-Theater, Unicef, „Coding for tomorrow“ und
vielen anderen. Alle Informationen rund um die IKiBu sind im
Internet auf www.ikibu.de zu finden.
Chargeback – wann
und wie die Rückbuchung einer Kreditkartenzahlung möglich ist
Viele Verbraucherinnen und Verbraucher kennen das sogenannte
Chargeback-Verfahren nicht – obwohl es ihnen in bestimmten Fällen
ermöglicht, Kreditkartenzahlungen rückgängig zu machen. Mit einem
aktualisierten Online-Artikel informiert das Europäische
Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland über das Verfahren, gibt
Hilfestellung bei der Beantragung und erklärt, welche Probleme
insbesondere bei grenzüberschreitenden Fällen auftreten können.
Beispiel aus der Fallarbeit des EVZ Deutschland
Ein Ehepaar
aus Baden-Württemberg machte Urlaub auf Gran Canaria. An der
Strandpromenade wurden sie von einer Frau angesprochen, die ihnen
drei Lose anbot – eines entpuppte sich als angeblicher Hauptgewinn.
Daraufhin ließ sich das Ehepaar zu einer Besichtigung einer
Ferienanlage überreden. Dort wurden sie in ein Verkaufsgespräch
verwickelt, in dem ihnen ein „Urlaubszertifikat“ angeboten wurde –
angeblich mit exklusiven Reisevorteilen. Unter Druck unterschrieben
sie schließlich einen Vertrag und zahlten 4.000 Euro per
Kreditkarte.
Erst später bemerkten sie, dass es sich um eine
typische Urlaubs-Masche handelte, aus dem ein Rücktritt kaum möglich
war. Die Familie wandte sich an das EVZ Deutschland. Nach unserer
Empfehlung beantragten sie bei ihrer Bank ein Chargeback – mit
Erfolg: Die 4.000 Euro wurden vollständig erstattet.
Was ist
ein Chargeback-Verfahren?
Das Chargeback ist ein
Rückbuchungsverfahren für Kredit- und Debitkartenzahlungen. Es wurde
von den Kreditkartenorganisationen (z. B. Visa, Mastercard)
entwickelt und ermöglicht es, Geldbeträge zurückzufordern, wenn eine
Abbuchung fehlerhaft oder unrechtmäßig war.
Da das Verfahren
auf den Regeln der Kartenanbieter basiert und nicht gesetzlich
geregelt ist, kommt es nach den Erfahrungen des EVZ Deutschland in
der Praxis häufig zu Missverständnissen oder Ablehnungen durch
Banken.
In diesen Fällen ist ein Chargeback-Verfahren möglich
Ein Chargeback kann zum Beispiel in folgenden Fällen beantragt
werden:
- eine im Internet bestellte Ware wurde nicht geliefert,
- ein Online-Händler erstattet trotz fristgerechtem Widerruf und
Rücksendung kein Geld,
- ein Betrag wurde doppelt oder falsch
abgebucht,
- ein Unternehmen hat Insolvenz angemeldet,
- es
wurden unberechtigte Zusatzkosten belastet – zum Beispiel nach einer
Mietwagen- oder Hotelbuchung,
- es handelt sich um eine
betrügerische Abbuchung oder einen Fake-Shop – hier sollte
zusätzlich Anzeige bei der Polizei erstattet werden.
So
läuft die Beantragung eines Chargeback ab
Das Chargeback wird
über die kartenausgebende Bank beantragt. Viele Banken stellen dafür
Reklamationsformulare bereit. Dem Antrag sollten alle relevanten
Belege beigefügt werden.
Fristen und Nachweise beachten
Kreditkartenunternehmen setzen für Chargebacks in der Regel Fristen
von bis zu 120 Tagen nach der Abbuchung. Verbraucherinnen und
Verbraucher sollten sich aber so schnell wie möglich an ihre Bank
wenden.
Die Bank prüft den Fall und stößt das Verfahren im
besten Fall an – häufig über spezialisierte Zahlungsdienstleister.
Händler können der Rückbuchung widersprechen; in solchen Fällen kann
sich die Klärung verzögern – teils über mehrere Monate.
Verbraucher-Tipp: Hartnäckig bleiben
Nach den Erfahrungen des EVZ
Deutschland sind Bankangestellte oftmals nicht mit dem
Chargeback-Verfahren vertraut oder lehnen es ohne nachvollziehbare
Begründung ab. Hier lohnt es sich, nachzuhaken und auf die Regeln
der Kreditkartenunternehmen zu verweisen. Zur Unterstützung können
Verbraucherinnen und Verbraucher auch den EVZ-Artikel mitschicken.
Weitere Informationen und praktische Tipps zum Chargeback-Verfahren
Bürgerenergie in NRW: Umfrage zeigt Fortschritte – aber
auch dringenden Handlungsbedarf
Eine Umfrage des Genoverband
e.V. unter Energiegenossenschaften in Nordrhein-Westfalen zeigt ein
interessantes Stimmungsbild: Die Bürgerenergie erfährt zunehmend
Rückenwind, steht jedoch weiterhin vor erheblichen
Herausforderungen. Zwischen dem 14. August und dem 25. September
2025 nahmen 71 Vorstandsmitglieder von Energiegenossenschaften in
NRW an der Umfrageteil.
Positive Impulse durch das
Bürgerenergiegesetz
Nur etwa ein Drittel der Befragten sehen
Verbesserungen. Wenn Verbesserungen gesehen wurden, sind diese am
häufigsten durch die geregelten finanziellen
Beteiligungsmöglichkeiten durch das Bürgerenergiegesetz in NRW
wahrgenommen worden. Die Mehrheit der befragten
Energiegenossenschaften bieten direkte Beteiligungen an, dicht
gefolgt von Direktzahlungen an Gemeinden. Derartige Beteiligung ist
ein wichtiger Schritt für mehr lokale Teilhabe und Akzeptanz der
Windenergie.
Genehmigungsprozesse und Netzausbau als zentrale
Hürden
Als Hemmnis bei den Genehmigungsverfahren geben die
meisten der Befragten die Dauer von Genehmigungsverfahren an und
sehen Verbesserungsbedarf. Besonders das sogenannte „Lex Sauerland“
– eine landesrechtliche Übergangsregelung in NRW – hat die
Genehmigungen außerhalb geplanter Windgebiete in Konflikt mit
Bundesrecht gebracht, was viele Windenergie-Projekte in NRW
verzögert oder beendet hat.
Auch der schleppende Netzausbau
und fehlende Speicherlösungen bereiten Sorgen: Die Mehrheit der
befragten Windenergiegenossenschaften in NRW sehen hier ein
zentrales Problem. Der Ausbau erneuerbarer Energien kann nur dann
Wirkung entfalten, wenn die erzeugte Energie auch eingespeist und
gespeichert werden kann. In offenen Antwortfeldern forderten die
Genossenschaften, gezielte Flächenausweisungen in der Nähe von
Netzeinspeisepunkten zu ermöglichen, sowie eine netzdienliche
Anbindung von Speichern.
Ungleiche Wettbewerbsbedingungen bei
der Flächenvergabe
Zudem kritisieren viele Genossenschaften in
der Befragung die Konkurrenz mit großen, kapitalstarken Unternehmen
bei der Flächenvergabe. Sie fordern faire Rahmenbedingungen und eine
gezielte Förderung, um die Bürgerenergie als demokratische Säule der
Energiewende zu stärken.
„Energiegenossenschaften sind das
Modell für Bürgerbeteiligung. Die Akzeptanz von Windenergieanlagen
steigt, wenn die Menschen vor Ort in die Projekte eingebunden
werden“, betont Peter Götz, Vorstandsmitglied beim Genoverband e.V.
Die Umfrage zeigt: Die Bürgerenergie in NRW ist auf einem guten
Weg, braucht aber weiterhin politische Unterstützung und faire
Rahmenbedingungen. Das Land NRW arbeitet intensiv an Lösungen und
hat durch Leitfäden, Checklisten und Standardisierungen schon vieles
auf den Weg gebracht. Ein Expertenworkshop 30. September 2025 im
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (MUNV NRW) diente
der Evaluation dieser Maßnahmen und für den Erfahrungsaustausch
weitere Lösungen zu entwickeln.
Hinweis zur Umfrage: Die
verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage des Genoverband
e.V. unter Vorständen von Energiegenossenschaften. Von den etwa 120
Mitgliedsgenossenschaften im Verbandsgebiet haben sich zwischen dem
14.8. – 25.9.2025 n=71 Vorstände an der Umfrage beteiligt. N= 31
davon sind im Bereich Windenergie tätig.
Der Genoverband e.V.
ist der Prüfungs- und Beratungsverband, Interessenvertreter und
Bildungsträger für rund 2.800 Mitgliedsgenossenschaften. Als
moderner Dienstleister betreut er Genossenschaften aus den Bereichen
Kreditwirtschaft, Landwirtschaft, Agrarwirtschaft, Verkehr und
Logistik sowie Handel, Gewerbe und Dienstleistungen mit insgesamt
über acht Millionen Mitgliedern. Mehr Informationen unter:
www.genoverband.de
„Mut zur Gründung: Let’s talk future“
Vereinbarkeit, Wachstum und Finanzen – Veranstaltung für Female
Start-ups und Gründerinnen am Niederrhein
Am diesjährigen
Women´s Entrepreneurshipday, Mittwoch, 19. November 2025, sind
Female Start-ups und Gründerinnen vom Niederrhein in der Zeit von
18.00 Uhr bis 20.00 Uhr zur Veranstaltung „Mut zur Gründung: Let‘s
talk future“ in die Alte reformierte Kirche nach Schermbeck
eingeladen. Gründerinnen sind erfolgreich und erzielen solide
Umsätze.
Trotzdem ist der Anteil der Gründerinnen weiterhin
gering. Nach erfolgreichem Gründungsstart das Business zu etablieren
und weiterzuentwickeln ist eine große Herausforderung und erfordert
eine gute Strategie! Oft ist die Finanzierung der Stolperstein. Mit
Impulsvorträgen der NRW.Bank zu Finanzierungs- und Förder-Know-how
für Gründung und Wachstum geht es um Female Entrepreneurship und die
Existenzgründung.
Den Vortrag hält Förderberaterin Simone
Plum. Im Anschluss wird Autorin und Mentorin Denise Brücker,
kokokonzept Hamminkeln, über gelungene „Kommunikation als Hebel für
unternehmerischen Erfolg“ sprechen. Im regionalen Talk kommen wir
mit den Unternehmerinnen Katharina Klump, Geschäftsführerin
Landhotel Voshövel, Schermbeck und Jennifer Rotehüser Gründerin &
Inhaberin rotehüser PHYSIOTHERAPIE, Wesel in´s Gespräch.
Der
Mut zur Gründung, die besonderen Herausforderungen und
Lösungsansätze im Rahmen von Vereinbarkeit und Wachstum sowie
Zugänge zu Kapital und öffentlichen Fördermöglichkeiten werden
thematisiert. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, sich erfolgreich
zu vernetzen.
Franziska Hilfenhaus, Freie
Journalistin (Frau tv/WDR) und Moderatorin/Medientrainerin
(Kooperative W), moderiert die Veranstaltung. Die Teilnahme ist
kostenfrei, um Anmeldung zur Veranstaltung wird bis zum 11. November
2025 gebeten. Eine Anmeldung ist über den folgenden Link https://beteiligung.nrw.de/k/1018010
sowie den Veranstaltungskalender
des Kreis Wesel möglich.
Die Veranstaltung wird in
Kooperation der Fachstelle Frau und Beruf Kreis Wesel und dem
STARTERCENTER NRW.NIEDERRHEIN in der EntwicklungsAgentur Wirtschaft
des Kreises Wesel sowie Competentia NRW Kompetenzzentrum Frau &
Beruf Niederrhein in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle
der Gemeinde Schermbeck angeboten.
Das Kompetenzzentrum Frau
& Beruf Niederrhein, unter der Trägerschaft der Stadt Duisburg, wird
gefördert vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie,
Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes
Nordrhein-Westfalen.
Bidirektionales
Laden: Grundlagen für sichere Markteinführung schaffen
Elektroautos sollen Strom nicht nur laden, sondern auch
zurückspeisen können. Das vergünstigt die Energiewende und entlastet
das Stromnetz. TÜV-Verband legt Positionspapier vor und fordert
klare Vorgaben für Technik, Sicherheit und Zuständigkeiten.
Elektroautos können nicht nur lokal emissionsfrei fahren, sondern
auch als universeller Stromspeicher dienen. Beim sogenannten
bidirektionalen Laden geben die Batterien der E-Autos überschüssigen
Strom wieder ins Netz oder ins eigene Haus zurück. Mit diesem
Konzept können Lastspitzen erneuerbarer Energien aufgenommen werden.
Das senkt die Stromkosten für alle und stabilisiert die Stromnetze.
„Bidirektionales Laden ist ein wichtiger Baustein für eine sichere,
bezahlbare und resiliente Energieversorgung“, sagt Robin Zalwert,
Referent für Nachhaltige Mobilität beim TÜV-Verband.
„Damit
diese Technologie in Deutschland zügig in den Markt kommt, brauchen
wir verbindliche technische Vorgaben, eine gute Koordination und
eine leistungsfähige digitale Infrastruktur.“ Der TÜV-Verband
veröffentlicht heute ein Positionspapier und fordert darin
verbindliche technische Regeln, eine gute Koordination dieses
Querschnittsthemas innerhalb der Bundesregierung sowie den schnellen
Ausbau digitaler Infrastruktur.
Großes Potenzial für
Energiewende und Verbraucher:innen
Mit bidirektionalem Laden
werden Elektroautos zu mobilen Energiespeichern. Sie können
Verbrauchsspitzen abfedern und Strom speichern. Studien wie vom
Fraunhofer ISI und Fraunhofer ISE zeigen: Durch die Nutzung von
Fahrzeugbatterien als Zwischenspeicher könnten in Deutschland bis
2040 bis zu 8,4 Milliarden Euro pro Jahr eingespart werden. Auch
private Haushalte und Unternehmen könnten profitieren, indem sie
Strom flexibler nutzen und zurückspeisen.
Von der Strategie
in die Umsetzung
Im Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 des
Bundesverkehrsministeriums (BMV) wird das Thema erstmals
konkretisiert. Dennoch fehlen verbindliche Regelungen und klare
Zuständigkeiten. „Europa – insbesondere Deutschland – zählt beim
bidirektionalen Laden derzeit zu den führenden
Technologiestandorten“, sagt Zalwert. „Dieser Vorsprung ist jedoch
nicht gesichert und könnte ohne entschlossenes Handeln schnell
verloren gehen. Denn bidirektionales Laden betrifft Energie-,
Verkehrs- und Digitalpolitik. Nur wenn Ministerien, Netzbetreiber
und Energieversorger eng zusammenarbeiten, kann die Technologie
schnell in den Markt kommen.“
Kernforderungen für den
Markthochlauf
Für den erfolgreichen Start des bidirektionalen
Ladens schlägt der TÜV-Verband vier zentrale Schritte vor.
Technische Regeln festlegen: Dafür braucht es einheitliche
Sicherheits- und Prüfstandards, klare technische Vorgaben und ein
transparentes Zertifizierungssystem für Fahrzeuge, Ladepunkte und
Software.
Koordiniert vorgehen: Das setzt eine enge Abstimmung
zwischen Verkehrs- und Wirtschaftsministerium voraus sowie
Förderprogramme, die verlässlich ausgestattet sind und nicht unter
Finanzierungsvorbehalt stehen.
Digitale Infrastruktur
beschleunigen: Dazu zählen der rasche Ausbau intelligenter
Stromzähler, deutlich beschleunigte Genehmigungsverfahren für
Ladeinfrastruktur von Depots und Flotten und klare Rahmenbedingungen
für flexible Stromtarife.
Qualität und Sicherheit prüfen: Die
TÜV-Organisationen bringen ihre Prüferfahrung ein und testen sowie
zertifizieren Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und IT-Systeme. So wird
sichergestellt, dass bidirektionale Ladelösungen sicher,
nutzerfreundlich und verlässlich funktionieren.
Die
Technologie ist bereit. Jetzt müssen die politischen Weichen
gestellt werden. Ziel ist es, Pilotversuche in einen bundesweiten
Markt zu überführen und Verbraucher:innen sichere, verständliche und
wirtschaftliche Lösungen anzubieten.
Vorlesen, Mitmachen,
Basteln: Winter- und Nikolausgeschichten in der Rumelner Bibliothek
Die Bibliothek in Rumeln-Kaldenhausen, Schulallee 11, lädt
Kinder ab sieben Jahren zu einer gemütlichen Mitmach-Aktion in der
Vorweihnachtszeit ein. Am Dienstag, 18. November, dreht sich von 16
bis 17 Uhr alles um Winterund Nikolausgeschichten. Gemeinsam wird
gelesen, gelauscht und gelacht – mit schönen Geschichten, die Lust
aufs Lesen machen. Im Anschluss gibt es passend zum Thema eine
Bastelaktion.
Die Veranstaltung richtet sich an Kinder, die
Freude am Lesen und Basteln haben. Sie ist eine schöne Gelegenheit,
spielerisch das Lesen zu üben und dabei neue Geschichtenwelten zu
entdecken. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung auf
www.stadtbibliothekduisburg.de (unter „Veranstaltungen“) wird
gebeten.
Fragen beantwortet das Team der Bibliothek gerne
persönlich oder telefonisch unter 02151 41908158. Die Öffnungszeiten
sind dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,
sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.
Lesung mit Birgit
Stieler in Wanheimerort
Die Bibliothek in Wanheimerort,
Düsseldorfer Straße 544, lädt am Freitag, 28. November, um 16 Uhr zu
einer Lesung mit Birgit Stieler ein. Die Duisburger Autorin aus
Wanheimerort hat bereits die Bücher „Relativ arm. Leben in der
Bedarfsgemeinschaft“ und „Schokokussgenuss“ veröffentlich. Bei der
Lesung stellt sie lyrische Texte aus ihrem neuen Buch „Und die Tage
plätschern fröhlich dahin“ mit einer gesunden Portion Humor und
einem liebevollen Blick auf die kleinen Freuden des Alltags vor.
Ihre Gedichte und Wortspielereien erzählen vom Strom des Lebens,
vom Sich-Treiben-Lassen und vom Glück, das manchmal einfach am
Bachufer wartet. Der Eintritt ist frei, um eine Online-Anmeldung
unter www.stadtbibliothekduisburg.de wird gebeten. Fragen
beantwortet das Team der Bibliothek gerne persönlich oder
telefonisch unter 0203 773096. Die Servicezeiten sind dienstags und
donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 10.30 bis 13 und 14 bis
18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.
VHS-Vortrag: Was haben Stolpersteine mit Demokratie zu
tun?
Die Historikerin Dr. Marina Sassenberg berichtet
am Montag, 10. November, um 20 Uhr in der Volkshochschule im
Stadtfenster, Steinsche Gasse 26 in der Duisburger Innenstadt, über
„Stolpersteine“ im Straßenpflaster. Sie geht der Frage nach, worin
die Stärken und Schwächen dieser Form der Erinnerungskultur liegen
und was diese Steine mit Demokratie zu tun haben. Mehr als 300
sogenannte Stolpersteine erinnern in Duisburg an die Opfer des
Nationalsozialismus.
Das sind Pflastersteine mit einer
Kantenlänge von zehn Zentimetern, die eine Messingtafel tragen, in
die der Name, das Geburts- und Deportationsjahr sowie der Todesort
der jeweiligen Opfer eingestanzt ist. In der Regel wurden sie in den
Gehweg vor dem letzten Wohnort der Ermordeten verankert. Die Idee,
der Opfer auf diese Weise zu gedenken, stammt von dem Künstler
Gunter Demnig.
Die Teilnahme kostet fünf Euro. Eine
vorherige Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es
telefonisch bei der VHS unter 0203 283- 984617.
Workshop Manga zeichnen in der Zentralbibliothek
Die Kinder- und Jugendbibliothek an der Steinschen Gasse 26 in
der Duisburger Innenstadt lädt am Samstag, 29. November, von 11 bis
13.30 Uhr zu einem Manga-Zeichenworkshop ein. Jugendliche von 10 bis
14 Jahren können mit der Künstlerin Jen Satora in die Welt von Ash
und Pikachu, Sailor Moon und anderen Manga-Heldinnen und Helden
eintauchen oder eigene Figuren erfinden.
Bei dem Workshop
wird vermittelt, wie man Stilmittel richtig einsetzt und mit den
typischen Materialien arbeitet. Anfängerinnen und Anfänger sind
herzlich willkommen. Wer selbst schon gezeichnet hat, kann seine
Sachen gerne mitbringen und sich weitere Tipps und Anregungen holen.
Die Teilnahme kostet zwei Euro zugunsten der Duisburger
Bibliotheksstiftung. Alle Materialien werden gestellt. Die Kurse
gehören zum Programm des Kulturrucksack NRW. Die Anmeldung ist
online auf der Internetseite www.stadtbibliothekduisburg.de (unter
„Veranstaltungen“) möglich.
Evangelische Gemeinden südlich der A42 möchten eine werden
Versammlungen in Beeck und Meiderich am 16. November
Die Leitungsgremien der Evangelischen Kirchengemeinden Meiderich,
Obermeiderich und Ruhrort-Beeck haben einstimmig beschlossen, ab
Januar 2028 eine gemeinsame evangelische Kirchengemeinde südlich der
A42 zu bilden. Ihre Mitglieder - 12.000 sind es insgesamt - haben
nun Gelegenheit, bei zwei Versammlungen mehr über die Pläne und die
nächsten Schritte zu erfahren.
Am 16. November können sind
die Mitglieder der Gemeinden Meiderich und Obermeiderich herzlich
zum 11-Uhr-Gottesdienst in der Kirche und zur anschließenden
Versammlung gegen 12 Uhr im benachbarten Gemeindezentrum, Auf dem
Damm 8, eingeladen. Beim warmen Imbiss und der Gelegenheit zum
Gespräch in gemütlicher Runde freuen sich die Presbyterien auch über
Rückfragen und Austausch zu den Fusionsplänen der drei Gemeinden.
Die Mitglieder der Gemeinde Ruhrort-Beeck sind am gleichen
Tag um 9.30 Uhr zum Gottesdienst und zur anschließenden Versammlung
(gegen 10.30 Uhr) eingeladen, wo es ebenfalls um die gemeinsame
Zukunft der drei Gemeinden geht. Außerdem stellt sich die neue
Gemeindepfarrerin Lisa Federl vor. Besprochen werden u.a. zudem
aktuelle Entwicklungen zum gemeinsamen Gottesdienst in der Region
und die Zukunft des Gemeindebriefes. Auch hier freut sich das
Presbyterium auf einen produktiven gemeinsamen Vormittag, ebenfalls
bei Getränken, leiblicher Stärkung und Gelegenheit für den
gemeinsamen Austausch.
Infos zu den Gemeinden gibt es im
Netz unter www.kirche-meiderich.de, www.obermeiderich.de und
www.ruhrort-beeck.de. Zusatzinfos: Zusammenführen sollen die drei
Gemeinden gemeinsame Gottesdienste und Feste an verschiedenen Orten,
Gemeindeveranstaltungen für alle im neuen Gebiet sowie die
gemeinsame Arbeit in wichtigen Bereichen wie z.B. Seelsorge und
Konfirmandenunterricht. Wichtiger Punkt dabei: Die drei Gemeinden
werden zudem ein gemeinsames Gemeindebüro einrichten, das alle
Abläufe koordinieren soll.
Die drei Presbyterien sehen sich
in ihrer Entscheidung für den gemeinsamen Weg bestärkt durch die
Erfahrung, dass im Pfarrteam und bei den Hauptamtlichen der
Gemeinden das menschliche Miteinander einfach passen würde. Bereits
jetzt gäbe es schon viele Ideen, die man gemeinsam entwickeln und
umsetzen wolle

Pfarrerin Lisa Federl, Pfarrerin Sarah Süselbeck und Heidi Kloppert,
Presbyteriumsvorsitzende in Meiderich, die auch für ihre Gemeinden
sehr gerne zusammenrücken (Foto: Rolf Schotsch).
Schlemmen beim Gemeindefrühstück in Wanheimerort
In der Evangelischen Rheingemeinde Duisburg gibt es im
Gemeindehaus Vogelsangplatz 1 in Wanheimerort am 14. November 2025
um 9.30 Uhr das nächste Schlemmen in netter Gesellschaft. Auch bei
diesem Frühstucks-Treffen gibt es am Büffet wieder alles, was neben
Lachs, Rührei, Marmeladen, Brötchen und Kaffee zu einem guten
Frühstück gehört.
Kosten von zehn Euro sollten eingeplant
werden. Maria Hönes, Ehrenamtskoordinatorin der Gemeinde,
beantwortet Fragen und nimmt Anmeldungen zum Frühstück entgegen
(Tel.: 0203 / 770134).
Gemeinde lädt zum Marktcafé in Meiderich
Zu Kaffee und lecker Frühstück mit Geselligkeit und
Freundlichkeit lädt die Evangelische Kirchengemeinde Meiderich
mehrmals im Jahr samstags zu den Marktzeiten in das Gemeindezentrum,
Auf dem Damm 8, ein. Den nächsten Termin zum Schlemmen und Klönen
gibt es am 15. November 2025.
Geöffnet ist das Marktcafé der
Gemeinde ab 9.30 Uhr und somit zu der Zeit, in der manche ihr
Einkäufe am Meidericher Wochenmarkt machen. Nach kurzem Fußweg lässt
sich im Gemeindezentrum bei Kaffee, Brot, Brötchen, Wurst- und
Käseaufschnitt und Marmeladen der Einkaufsstress vergessen.
Das Angebot bereiten Ehrenamtliche zu, das Frühstück gibt´s zum
Selbstkostenpreis. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter 0203-4519622.
Pfarrer Asmus am Service-Telefon der evangelischen Kirche in
Duisburg
„Zu welcher Gemeinde gehöre ich?“ oder „Wie
kann ich in die Kirche eintreten?“ oder „Holt die Diakonie auch
Möbel ab?“: Antworten auf Fragen dieser Art erhalten Anrufende beim
kostenfreien Servicetelefon der evangelischen Kirche in Duisburg.
Es ist unter der Rufnummer 0800 / 12131213 auch immer
montags von 18 bis 20 Uhr besetzt, und dann geben Pfarrerinnen und
Pfarrer Antworten auf Fragen rund um die kirchliche Arbeit und haben
als Seelsorgende ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das
Service-Telefon ist am Montag, 10. November 2025 von Sören Asmus,
Pfarrer beim Dialogreferat im Evangelischen Kirchenkreis Duisburg,
besetzt.

NRW-Industrie: Absatzwert von Maschinen und
Maschinenteilen für die Land- und Forstwirtschaft 2024 um fast 21 %
gesunken
* Zahl der Betriebe seit 2021 konstant.
*
NRW-Anteil am Bundesabsatzwert sank 2024 auf 10-Jahrestief.
*
Rückgang des Absatzwertes auch im ersten Halbjahr 2025.
In
Nordrhein-Westfalen sind 2024 in 51 Betrieben des Verarbeitenden
Gewerbes Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und
Forstwirtschaft sowie Teile dafür im Wert von 2,8 Milliarden Euro
hergestellt worden. Wie das Statistische Landesamt anlässlich der
Weltleitmesse für Landtechnik AGRITECHNICA (09. bis 15. November
2025 in Hannover) mitteilt, war der Absatzwert nominal um
726,7 Millionen Euro bzw. 20,9 % niedriger als ein Jahr zuvor.

Nachdem der Absatzwert von 2020 bis 2023 vier Jahre in Folge
gestiegen ist, sank er 2024 erstmalig wieder gegenüber dem Vorjahr.
Gegenüber dem Jahr 2015 stieg er nominal um 498,8 Millionen Euro
bzw. 22,1 %. Zahl der Betriebe seit 2021 konstant bei 51 Von den 51
Betrieben stellten im letzten Jahr 35 Betriebe Maschinen, Apparate
und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft wie Schlepper,
Anhänger, Bodenbearbeitungs- und Erntemaschinen mit einem nominalen
Absatzwert von 2,1 Milliarden Euro her.
27 Betriebe
produzierten Teile für Maschinen, Apparate und Geräte für die Land-
und Forstwirtschaft mit einem nominalen Absatzwert von
675,7 Millionen Euro; auch hier sank der Absatzwert um 20,9 %
gegenüber dem Vorjahr. Außerdem gaben 24 Betriebe an für
24,9 Millionen Euro land- und forstwirtschaftliche Maschinen
repariert bzw. instandgehalten zu haben, was einer Steigerung von
1,1 % zum Vorjahr entspricht.
NRW-Anteil am Bundesabsatzwert
auf 10-Jahrestief
Auch bundesweit sank im Jahr 2024 der
Absatzwert der Produktion von Maschinen, Apparate und Geräte für die
Land- und Forstwirtschaft und von Teilen dafür um 19,9 % auf nominal
12,8 Milliarden Euro. Der NRW-Anteil am bundesdeutschen Absatzwert
lag 2024 bei 21,4 %; er sank damit auf den niedrigsten Stand der
letzten 10 Jahre (2015: 25,5 %).
Rückgang setzt sich auch in
der ersten Jahreshälfte 2025 fort
Im ersten Halbjahr 2025
produzierten nach vorläufigen Ergebnissen 49 nordrhein-westfälische
Betriebe Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und
Forstwirtschaft sowie Teile dafür im Wert von 1,6 Milliarden Euro.
Der Absatzwert sank damit um 11,1 % gegenüber dem entsprechenden
Vorjahreszeitraum.
46,5 % weniger Zuzüge syrischer
Staatsangehöriger von Januar bis September 2025 als im
Vorjahreszeitraum
• Zahl der Fortzüge von Syrerinnen
und Syrern im selben Zeitraum um 35,3 % gestiegen
• Ende 2024
waren 22 % der Schutzsuchenden in Deutschland Syrerinnen und Syrer
• 1,22 Millionen Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte
leben in Deutschland, 19 % von ihnen sind hier geboren
Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien Ende 2024 ist die
Zahl der Zuzüge syrischer Staatsangehöriger im laufenden Jahr um
46,5 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis
von vorläufigen Ergebnissen der Wanderungsstatistik mitteilt,
registrierten die Meldebehörden von Januar bis September 2025 rund
40 000 Zuzüge von Syrerinnen und Syrern. Von Januar bis September
2024 waren es noch gut 74 600 Zuzüge.
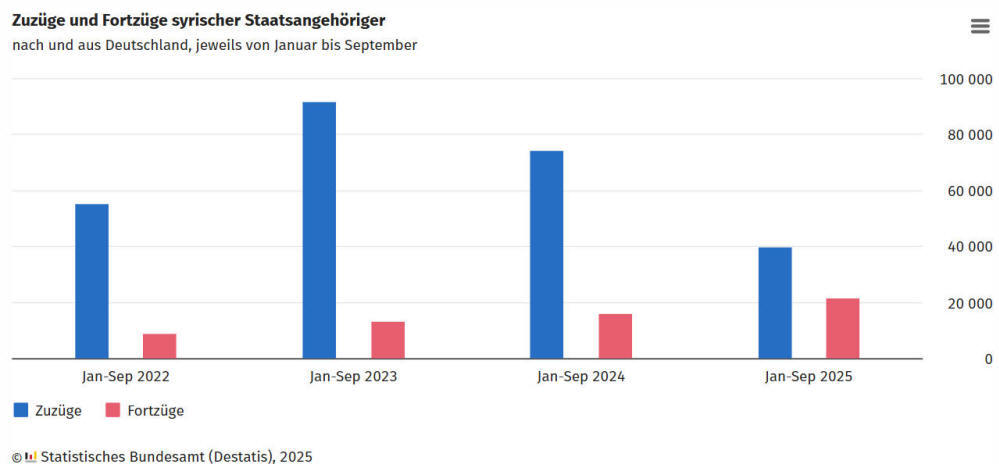
Die Zahl der syrischen Staatsangehörigen, die aus Deutschland
fortzogen, hat sich im selben Zeitraum dagegen um mehr als ein
Drittel erhöht (+35,3 %). Von Januar bis September 2025 wurden gut
21 800 Fortzüge von Syrerinnen und Syrern registriert, im
Vorjahreszeitraum waren es gut 16 100. Die Wanderungszahlen beziehen
sich auf syrische Staatsangehörige, sagen also nichts über die
Gründe oder den etwaigen Asyl- oder Schutzstatus der Abwandernden
und Zuwandernden aus.
Der Rückgang bei den Zuzügen und der
Anstieg bei den Fortzügen syrischer Staatsangehöriger führten dazu,
dass die Nettozuwanderung deutlich gesunken ist. Von Januar bis
September 2025 lag die Nettozuwanderung (Zuzüge abzüglich der
Fortzüge) bei 18 100 Personen. Von Januar bis September 2024 war sie
noch mehr als dreimal so hoch (58 500 Personen).
67 %
weniger Erstanträge auf Asyl von Syrerinnen und Syrern von Januar
bis September 2025
Auch im laufenden Jahr haben Syrerinnen und
Syrer Schutz in Deutschland gesucht. Von Januar bis September 2025
verzeichnete das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge gut 19 200 entsprechende
Erstanträge auf Asyl. Das waren 67,1 % weniger Erstanträge als im
Vorjahreszeitraum (58 400). Mit einem Anteil von 21,9 % blieben
syrische Staatsangehörige die größte Gruppe unter den insgesamt
87 800 Menschen, die von Januar bis September 2025 in Deutschland
erstmals Asyl beantragten.
Für die gesamte Europäische Union
(EU) liegen Daten bis einschließlich Juli 2025 vor. In den ersten
sieben Monaten des Jahres gingen laut EU-Statistikbehörde Eurostat
26 200 Erstanträge auf Asyl von Syrerinnen und Syrern ein. Das waren
68,8 % weniger als im Vorjahreszeitraum mit rund
84 100 Erstanträgen. Syrien war damit im Jahr 2025 nur noch das
drittgrößte Herkunftsland Asylsuchender in der EU (7 % aller
Erstanträge aus Nicht-EU-Staaten) nach Venezuela (14 %) und
Afghanistan (9 %).
Mehr als die Hälfte (61 % bzw. rund
16 000) aller Anträge von Syrerinnen und Syrern in der EU in den
ersten sieben Monaten des Jahres 2025 wurden in Deutschland
gestellt. Insgesamt gab es von Januar bis Juli EU-weit
396 700 Erstanträge auf Asyl aus Nicht-EU-Staaten (-27,0 % gegenüber
dem Vorjahreszeitraum).
Nach Angaben des Flüchtlingshilfwerk
der Vereinten Nationen (UNHCR) sind im Zeitraum vom 8. Dezember
2024 bis September 2025 weltweit rund 1,0 Million Geflüchtete nach
Syrien zurückgekehrt, ebenso wie 1,8 Millionen Binnenvertriebene
innerhalb des Landes. Laut UNHCR leben weiterhin mehr als
4,5 Millionen Geflüchtete im Ausland und mehr als
7 Millionen Binnenvertriebene innerhalb Syriens.
713 000 syrische Schutzsuchende lebten Ende 2024 in Deutschland –
zweitgrößte Gruppe hinter Ukrainerinnen und Ukrainern
Zu
Schutzsuchenden in Deutschland liegen Daten aus dem
Ausländerzentralregister (AZR) zum Stichtag 31. Dezember 2024 vor –
die Entwicklungen nach dem Regimewechsel in Syrien dürften sich
deshalb noch kaum darin widerspiegeln. Zum Jahresende 2024 waren
hierzulande rund 713 000 syrische Schutzsuchende registriert.
Mit knapp 22 % der insgesamt 3,30 Millionen Schutzsuchenden
waren Syrerinnen und Syrer damit die zweitgrößte Gruppe nach
ukrainischen Staatsangehörigen (33 %). Schutzsuchende sind Menschen
mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die sich unter Berufung auf
völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe in Deutschland
aufhalten.
Zu einem großen Teil leben syrische
Schutzsuchende schon seit Längerem in Deutschland: Knapp die Hälfte
von ihnen (48 %) kam in den Jahren vor und bis einschließlich 2016
erstmals nach Deutschland, lebte Ende 2024 also bereits acht Jahre
oder länger hier. 12 % der syrischen Schutzsuchenden waren in
Deutschland geboren. Die große Mehrheit der syrischen
Schutzsuchenden verfügte Ende 2024 über einen humanitären
Aufenthaltstitel und somit über einen anerkannten Schutzstatus
(642 200 oder 90 %).
In den meisten Fällen handelte es sich
dabei um einen Schutzstatus für Flüchtlinge nach der Genfer
Flüchtlingskonvention (247 700 oder 35 % aller syrischen
Schutzsuchenden) oder um subsidiären Schutz (295 700 oder 41 %). Der
subsidiäre Schutz greift ein, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch
die Asylberechtigung gewährt werden können und im Herkunftsland
ernsthafter Schaden droht.
Bei weiteren knapp
64 200 syrischen Schutzsuchenden war der Schutzstatus noch offen
(9 %). Rund 6 600 (1 %) hatten einen abgelehnten Schutzstatus, etwa
weil der Asylantrag abgelehnt wurde. Bei 92 % der rund
642 200 syrischen Schutzsuchenden mit anerkanntem Schutzstatus war
dieser befristet.
83 200 Syrerinnen und Syrer im Jahr 2024
eingebürgert
Deutlich größer als die Zahl der syrischen
Schutzsuchenden ist hierzulande die der Menschen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte. Laut Mikrozensus lebten 2024 in Deutschland
rund 1,22 Millionen Menschen, die selbst (81 %) oder deren beide
Elternteile aus Syrien eingewandert und die hier geboren sind
(19 %). Rund ein Viertel (24 %) von ihnen besaß die deutsche
Staatsbürgerschaft, etwa durch Einbürgerung.
Laut
Einbürgerungsstatistik wurden allein im Jahr 2024 rund
83 200 Syrerinnen und Syrer eingebürgert, sie machten mit gut 28 %
den größten Anteil an allen Einbürgerungen aus. Die meisten Menschen
mit syrischer Einwanderungsgeschichte lebten in Nordrhein-Westfalen
(363 000, 30 %).
Gut 10 % lebten in Niedersachsen, gefolgt von
Baden-Württemberg und Bayern mit je rund 10 %. Menschen mit
syrischer Einwanderungsgeschichte vergleichsweise jung Personen mit
syrischer Einwanderungsgeschichte waren 2024 durchschnittlich
26,6 Jahre alt.
Zum Vergleich: Personen mit
Einwanderungsgeschichte insgesamt hatten ein Durchschnittsalter von
38,2 Jahren. 57 % aller Personen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte waren männlich, 43 % weiblich. Auch aufgrund
des vergleichsweise niedrigen Altersdurchschnitts waren 723 000 oder
59 % der 1,22 Millionen Personen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte ledig, 450 000 waren verheiratet (37 %).
17 % der 15- bis 64-Jährigen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte noch in (Aus)-Bildung Rund 845 000 Menschen
mit syrischer Einwanderungsgeschichte waren 2024 im erwerbsfähigen
Alter von 15 bis 64 Jahren. Davon waren 46 % bzw. 387 000 Personen
erwerbstätig, 8 % bzw. 64 000 erwerbslos und 47 % bzw.
394 000 Nichterwerbspersonen, etwa weil sie noch in (Aus-)Bildung
waren, weil sie krankheitsbedingt nicht arbeiten konnten oder weil
sie keine Arbeitserlaubnis hatten.
Der Anteil der
Nichterwerbspersonen ist deutlich höher als bei der Bevölkerung mit
Einwanderungsgeschichte insgesamt (26 %) oder der Bevölkerung ohne
Einwanderungsgeschichte (17 %) im jeweiligen Alter von 15 bis
64 Jahren. Ein Grund dafür ist, dass sich ein hoher Anteil der
Bevölkerung mit syrischer Einwanderungsgeschichte aufgrund des
niedrigen Durchschnittsalters noch in (Aus-)Bildung befindet.
So waren 17 % aller 15- bis 64-Jährigen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte noch in Schule oder Ausbildung. Zum
Vergleich: Dies traf auf 11 % aller Personen mit
Einwanderungsgeschichte bzw. 10 % aller Personen ohne
Einwanderungsgeschichte in dieser Altersgruppe zu.
23 % der
Personen mit syrischer Einwanderungsgeschichte im Alter von 15 bis
64 Jahren verfügten 2024 über einen berufsqualifizierenden Abschluss
(197 000), davon besaßen 105 000 einen akademischen Abschluss. 59 %
bzw. 502 000 Personen mit syrischer Einwanderungsgeschichte hatten
keinen berufsqualifizierenden Abschluss. 17 % befanden sich noch in
(Aus-)Bildung.