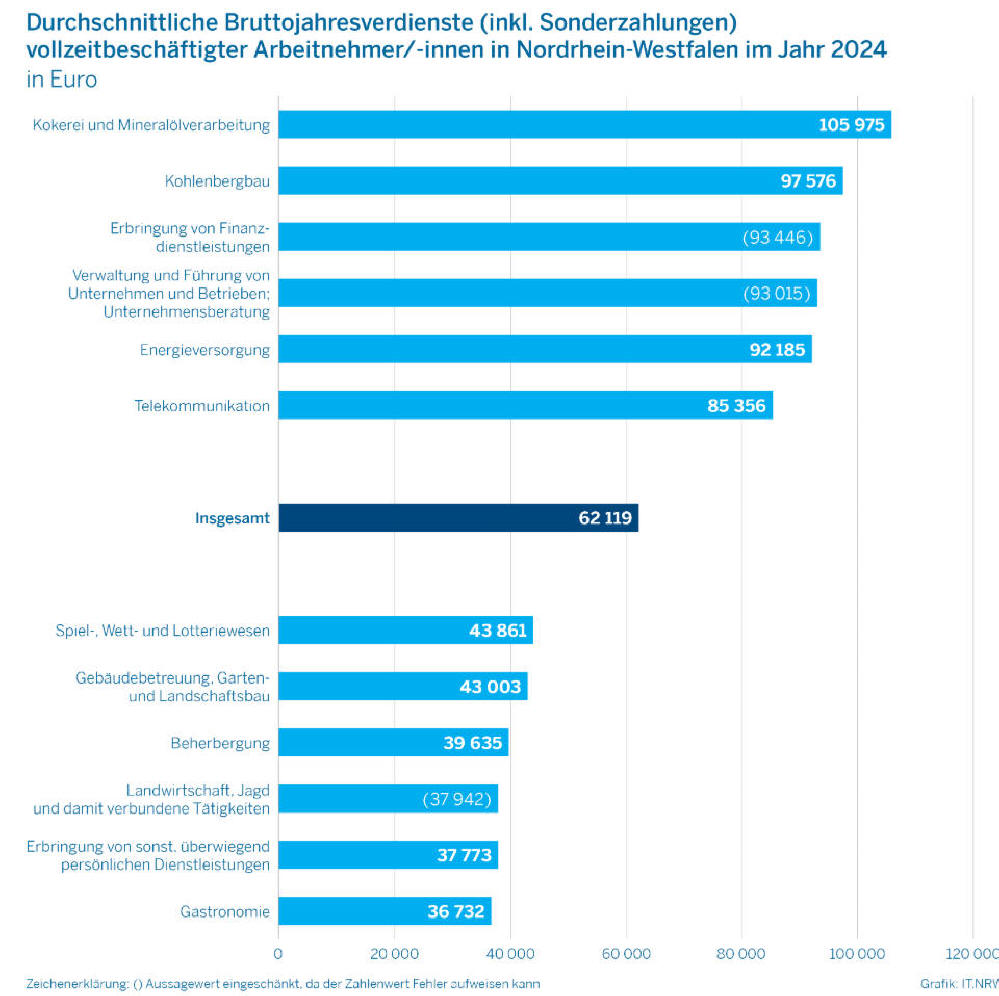|
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 16. Kalenderwoche:
19. April
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Ostermontag, 21. April 2025
Zum Tod von Papst Franziskus:
Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger würdigt Lebenswerk
„Mit großem Bedauern haben wir heute vom Tod
von Papst Franziskus erfahren, nachdem er gestern noch
Menschen auf der ganzen Welt den Ostersegen gespendet hat.
Als Oberhaupt der katholischen Kirche hat er sich stets
für Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit eingesetzt.
Sein Engagement für die Armen und seine offene
Haltung haben die katholische Gemeinschaft weltweit
geprägt. Sein Wirken wird unvergessen bleiben."
Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken
Papst
Franziskus, mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio,
wurde 88 Jahre alt. Er stammte aus Argentinien und wurde
am 17. Dezember 1936 als Sohn italienischer Einwanderer in
Buenos Aires geboren. Er war Mitglied des Jesuitenordens
und empfing 1969 die Priesterweihe. 2001 ernannte ihn
Papst Johannes Paul II. zum Kardinal. Nach dem Rücktritt
des deutschen Papstes Benedikt XVI. wurde er 2013 zu
dessen Nachfolger und damit zum Oberhaupt der katholischen
Kirche gewählt.
Vor 10 Jahren in der BZ: Projekt "Kinderrechte" an der Baerler-Waldschule

Mit einer Schweigeminute für in Not geratene Kinder und dem gemeinsamen Singen des Waldschulenliedes wurde der Tag der Ideen-Umsetzung gestartet.
"Die Waldschule macht Spaß, wir lernen gestern, heute und morgen und fühlen uns hier geborgen...

Anschließend gab es "Oh happy day" von
Blockflötenchor.
Die Idee und der Plan eines „Grünen
Klassenzimmers“ an der Baerler Waldschule eingebettet in
das Jahresthema „Kinderrechte“ anlässlich des
25jährigen Bestehens der UN-Kinderrechtskonvention konnte
mit Hilfe zahlreicher Sponsoren in die Tat umgesetzt
werden.

Es entstanden mehrere wetterfeste Sitzgruppen mit
großer Tafel auf einer umgestalteten Grünfläche auf dem
Schulhof inklusive Sonnenschutz zum ganzheitlichen Lernen
zum Schreiben, Malen, Basteln u.v.m..

Die
Schulleiterin der Baerler Waldschule, Frau Nicole
Wardenbach, freute sich besonders darüber, dass nicht nur
das Thema Kinderrechte im Rahmen einer
Projektwoche sehr vielfältig behandelt wurde, sondern,
dass für die Schülerinnen und Schüler das „Recht auf
Mitbestimmung“ durch dieses Projekt erfahrbar wurde:

„Dank der großen Unterstützung (personell und finanziell) konnte ein solches Vorhaben, das über mehrere Monate von den Kindern geplant wurde, nun umgesetzt werden, sagte Schulleiterin Nicole Wardenbach, hier neben Bezirksbürgermeister Hans-Joachim Paschmann (links) und Markus Dorok vom Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl.
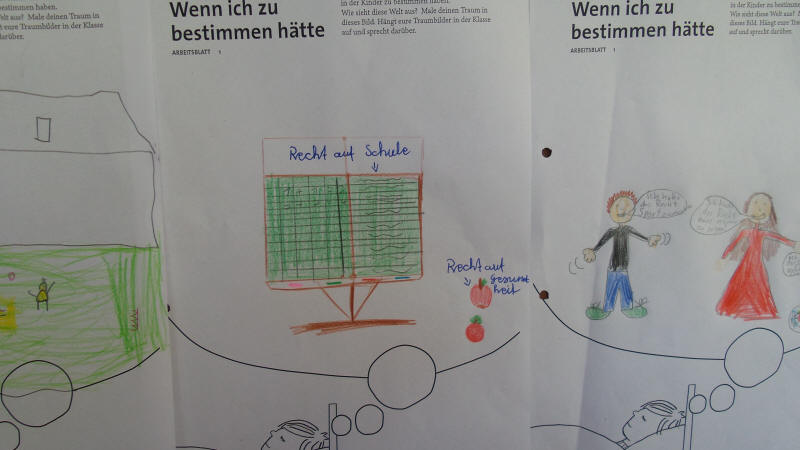
So „begreifen“
Kinder ihre Rechte, verankert in der guten
Zusammenarbeit der Gemeinde, in einem Nebeneinander
von Fröhlichkeit und Besinnung, in einer Schule voller
gelingender Hoffnungen.“

Alle Kinder haben Rechte


Auch Kinder wollten Kindern in Not helfen und spendeten,
so wie hier Josy

während Tobias aus der 3. Klasse hervorragend die
Tattoo-Aufklebetechnik beherrschte - Harald
Jeschke
Klarinettenchor: Konzert in der Marienkirche
Der Klarinettenchor der Deutschen Klarinetten-Gesellschaft lädt
am Sonntag, 4. Mai, um 12 Uhr zum Konzert in die Marienkirche,
Josef-Kiefer-Straße 4, in Duisburg-Mitte ein. Unter der Leitung von
Prof. Christof Hilger erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches
und klanglich facettenreiches Programm.
Auf dem Repertoire
stehen Werke großer Komponisten wie Georg Friedrich Händel, Wolfgang
Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Gustav Mahler, Marco
Antonio Santer und Jan Van der Roost.
Die stilistische
Bandbreite reicht dabei von barocken Meisterwerken bis hin zu
modernen Kompositionen. Der Klarinettenchor vereint talentierte
Klarinettistinnen und Klarinettisten, die die ganze Klangvielfalt
und Ausdruckskraft der Klarinettenfamilie im höchsten Niveau auf die
Bühne bringen. Die Marienkirche bietet mit ihrer beeindruckenden
Architektur und exzellenten Akustik den idealen Rahmen für dieses
besondere Konzerterlebnis. Der Eintritt ist frei - Spenden zur
Unterstützung der musikalischen Arbeit des Klarinettenchors sind
herzlich willkommen.
Malteser Hospizzentrum St. Raphael: Infoabend zum
Ehrenamt in der Malteser Hospizarbeit - Zeitschenker gesucht
30. Vorbereitungskurs auf der rechten Rheinseite startet im
September
In der Malteser Hospizarbeit für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene gibt es vielfältige Möglichkeiten, als
Ehrenamtliche/r seine Zeit zu schenken und lebensbegrenzt erkrankten
Menschen und ihre Angehörigen zu begleiten. „Viele Menschen spüren
aufgrund eigener Erfahrungen schon länger den Impuls, sich im
Bereich der Hospizarbeit zu engagieren, sind sich aber unsicher, ob
sie dafür geeignet sind“, so Katja Arens, Verantwortliche für die
Ehrenamtsarbeit im Hospizzentrum.
Die Infoveranstaltung am
Montag, 28. April um 11 Uhr im Malteser Hospizzentrum St. Raphael in
der Remberger Str. 36 in 47259 Duisburg-Huckingen soll den Raum
bieten, die ehrenamtlichen Einsatzmöglichkeiten kennenzulernen,
Fragen loszuwerden und Klarheit zu finden, ob dieses Ehrenamt in
Frage kommt. Der integrierte Vorbereitungskurs, der im Herbst
startet , befähigt die Teilnehmenden, Patienten, ihre Zugehörigen
aber auch Geschwisterkinder gut zu begleiten. Infos und Anmeldung
bei Christina Jakubiak, christina.jakubiak@malteser.org Tel. 0203
60852010
Malteser Hospizzentrum St. Raphael
Das Malteser
Hospizzentrum St. Raphael umfasst einen ambulanten Palliativ- und
Hospizdienst sowie ein stationäres Hospiz mit zwölf Plätzen für
schwerstkranke Menschen in der letzten Lebensphase. Zudem
unterstützt der Kinder- und Jugendhospizdienst „Bärenstark“
lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche sowie ihre
Familien in der Häuslichkeit. Hinterbliebenen stehen die geschulten
und erfahrenen Mitarbeitenden des Hospizzentrums im Rahmen der
Trauerberatung und -begleitung mit unterschiedlichen
Beratungsangeboten für Erwachsene und Kinder zur Seite.
Die
fachlich kompetenten und erfahrenen Mitarbeitenden des
Hospizzentrums werden in allen Bereichen von geschulten
Ehrenamtlichen unterstützt. Zur Vorbereitung, Begleitung und
Integration der ehrenamtlich Mitarbeitenden betreibt das
Hospizzentrum ein professionelles Ehrenamtsmanagement.
In enger
Zusammenarbeit mit dem Malteser Ambulanten Palliativpflegedienst ist
das Hospizzentrum fester Partner in der Sicherung der
SAPV-Versorgung. Träger des Malteser Hospizzentrums St. Raphael ist
die Malteser Wohnen & Pflegen gGmbH mit Sitz in Duisburg. Sie
betreibt neben dem Hospizzentrum deutschlandweit 34 Wohn- und
Pflegeeinrichtungen, von denen einige neben umfassenden
Pflegeleistungen der Altenhilfe über spezielle
Schwerpunktpflegebereiche verfügen.
Im Opern-UFO
läuft „Out In Space“
Im UFO – der mobilen Außenstation
der Deutschen Oper am Rhein – laden ab Samstag, 26. April eine
Tänzerin und zwei Tänzer des Ballett am Rhein zu einer Reise in die
Gefühlswelten junger Menschen ein. Das Material für das Stück „Out
In Space“ hat Choreographin Sara Angius mit Jugendlichen aus
Duisburg und Düsseldorf erprobt und recherchiert.
Ohne
Worte, allein durch die universelle und direkte Sprache des Tanzes
und der Musik, wirft „Out In Space“ einen Blick auf die breite Skala
wechselnder Emotionen und möchte alle ab 14 Jahren ermutigen, die
eigenen Gefühle zu reflektieren.
In „Out In Space“ beginnt
die Grenze zwischen äußerlicher Realität und erlebter, innerer Welt
zu verschwimmen. An diesem intimen Ort tritt das ganze Spektrum
menschlicher Emotionen hervor, das jede und jeder tagtäglich in sich
trägt. Was sind die Konflikte, die uns zerreißen? Die Ängste, die
uns zurückhalten? Die Freude, die uns beflügelt? Die Wut, die uns
verzehrt? Oder ist es eine wohlige Passivität, die uns vor dem
Gefühlschaos der Außenwelt schützt?
Das UFO versteht sich als
kreativer Musik-, Tanz- und Begegnungsort für alle. Es macht in
Duisburger und Düsseldorfer Stadtteilen Station, um dort mit der
Nachbarschaft und umliegenden Schulen und KiTas neues Musiktheater
zu entwickeln und zu erleben. Bis zu den Sommerferien ist das UFO am
Neumarkt im Duisburger Stadtteil Ruhrort zu Gast.

Foto: DOR_UFO_DUI - Neumarkt. FOTO Lisa Kanthack
Ab 26. April
kann man im UFO am Duisburg-Ruhrorter Neumarkt die Tanzvorstellung
„Out In Space“ erleben.
Top Secret und plötzlich
wieder aktuell: Der Regierungsbunker im Ahrtal
Das
Ahrtal gilt vielen als eine malerische Genuss- und Wanderregion –
doch unter den Rebhängen bei Ahrweiler verbirgt sich ein Ort, der
aktueller kaum sein könnte: der ehemalige Regierungsbunker der
Bundesrepublik Deutschland. In Zeiten internationaler Krisen und
globaler Unsicherheiten rückt das einst streng geheime Bauwerk des
Kalten Krieges wieder ins öffentliche Bewusstsein – als Mahnmal, als
Museum und als eindrucksvolles Zeugnis deutscher Zeitgeschichte.

2000 Jahre Geschichte in 2000 Schritten - Foto: Dominik Ketz
In der Rotweinmetropole Ahrweiler erleben Besucher auf engstem Raum
eine Zeitreise durch zwei Jahrtausende: Die Römer hinterließen hier
eine riesige Villa Rustica, deren Erhaltungszustand jenseits der
Alpen ihresgleichen sucht. Im Museum Roemervilla begleiten die
Besucher eine römische Adelsfamilie in ihrem Heim mit Küche, eigenem
Badetrakt und Wohnräumen, die mit einer innovativen Fußboden- und
Wand-Heizungsanlage ausgestattet war.
Nur wenige Gehminuten
entfernt beginnt inmitten des Ahrweiler Stadtmauerrings aus dem 13.
Jahrhundert die Reise in mittelalterliche Zeiten. Wer durch eine der
vier mächtigen Stadttore die Ahrweiler Altstadt betritt, fühlt sich
zwischen engen Gassen und Fachwerkhäusern, Wehrgängen,
Marktschänken, alt ehrwürdigen Adelshöfen und der imposanten
Pfarrkirche zurückversetzt in die Zeit der Ritter und Lehnsleute,
Mönche und Kaufleute. Bei der Nachtwächter-Führung tauchen die Gäste
im Schein der abendlichen Laternen ein in Geschichten und Anekdoten.
Die Bunkeranlage: Ein Besuch, der unter die Oberfläche geht
Versteckt in zwei stillgelegten Eisenbahntunneln oberhalb von
Ahrweiler liegt ein einzigartiges historisches Zeitzeugnis. Ab den
1960er Jahren entstand ein 20 Kilometer langes unterirdisches
Schutzsystem – ausgestattet mit Kommandozentrale, Zahnarztpraxis,
Friseursalon, eigenem Fernsehstudio und dem Zimmer des
Bundeskanzlers. Für bis zu 3.000 Personen konzipiert, sollte der
Bunker im Ernstfall den Fortbestand der Bundesregierung sichern.

Dokumentationsstätte Regierungsbunker - Foto: Dominik Ketz
Heute ist die Dokumentationsstätte Regierungsbunker mehr als ein
Ort der Erinnerung: Es ist ein Spiegelbild historischer Ängste und
aktueller Debatten. Gerade jetzt, wo geopolitische Spannungen
weltweit zunehmen, gewinnt der Ort neue Bedeutung – nicht nur als
technisches Meisterwerk, sondern als mahnendes Symbol für Frieden
und Demokratie.
Die massiven Rolltore öffnen sich heute
nicht mehr für Regierungsmitglieder, sondern für Menschen mit
Interesse an Geschichte, Sicherheitspolitik – und der Frage, wie nah
Vergangenheit und Gegenwart beieinanderliegen können. Der ehemalige
Regierungsbunker erinnert daran, wie kostbar Frieden ist – und wie
wichtig es ist, aus der Geschichte zu lernen.
www.ahrtal.de/regierungsbunker
Teuerung für 8
von 9 Haushaltstypen leicht unter Zielinflation
Die Inflationsrate in Deutschland ist im März
gegenüber Februar von 2,3 auf 2,2 Prozent gesunken und liegt damit
sehr nahe beim Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von
zwei Prozent. Verschiedene Haushaltstypen, die sich nach Einkommen
und Personenzahl unterscheiden, weisen aktuell kaum Unterschiede bei
ihren haushaltsspezifischen Teuerungsraten auf: Diese reichten im
März von 1,7 bis 2,0 Prozent, zeigt der neue Inflationsmonitor des
Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der
Hans-Böckler-Stiftung.*
Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der
Inflationswelle im Herbst 2022 betrug die Spanne 3,1 Prozentpunkte.
Während Haushalte mit niedrigen Einkommen während des akuten
Teuerungsschubs der Jahre 2022 und 2023 eine deutlich höhere
Inflation schultern mussten als Haushalte mit mehr Einkommen, war
ihre Inflationsrate im März 2025 wie in den Vormonaten leicht
unterdurchschnittlich: Der Warenkorb von Paaren mit Kindern sowie
der von Alleinlebenden mit jeweils niedrigen Einkommen verteuerte
sich um 1,7 Prozent bzw. 1,8 Prozent.
Auf 1,7 Prozent
Inflationsrate kamen auch Alleinerziehende mit mittlerem Einkommen.
1,8 Prozent Teuerungsrate verzeichneten ebenfalls Paarfamilien mit
mittleren Einkommen und Paare ohne Kinder mit mittleren Einkommen
sowie Alleinlebende mit mittleren und mit höheren Einkommen (siehe
auch die Abbildung in der pdf-Version dieser PM; Link unten).
Auch die Kernrate, also die Inflation ohne die
schwankungsanfälligen Posten Nahrungsmittel (im weiten Sinne) und
Energie, sank zwischen Februar und März leicht. Im Jahresverlauf
2025 dürfte sich die Inflationsrate weiter normalisieren und bei
gesamtwirtschaftlich zwei Prozent einpendeln, so die Prognose des
IMK. Allerdings steigt durch den von US-Präsident Donald Trump
provozierten Zollkonflikt das Risiko, dass sie sogar deutlich unter
die Zielinflation fällt, warnt Dr. Silke Tober, IMK-Expertin für
Geldpolitik und Autorin des Inflationsmonitors. Denn die
handelspolitische Auseinandersetzung treibt die Gefahr einer
weltweiten Rezession hoch, die die Preisentwicklung zusätzlich
dämpfen würde.
Tober hält weitere Zinsschritte der EZB für
dringend erforderlich, denn bereits vor den Erschütterungen durch
die erratische Politik der US-Regierung sei die Geldpolitik im
Euroraum zu restriktiv für die schwache wirtschaftliche Dynamik
gewesen. Eine Zinssenkung auf der heutigen EZB-Ratssitzung werde
„von den Märkten bereits erwartet“. Die Zentralbank sollte heute
darüber hinaus „weitere Lockerungen der geldpolitischen Zügel
ankündigen“, empfiehlt Tober.
Das würde auch die Wirkung der von
Union und SPD vorgesehenen Investitionsoffensive in Deutschland
angemessen flankieren, betont die Ökonomin. „In der aktuellen
Situation sollten Geld- und Fiskalpolitik gemeinsam ein günstiges
Umfeld für staatliche und private Investitionen schaffen, um durch
eine starke Binnennachfrage die dämpfenden außenwirtschaftlichen
Einflüsse abzufedern.“
Das IMK berechnet seit Anfang 2022
monatlich spezifische Teuerungsraten für neun repräsentative
Haushaltstypen, die sich nach Zahl und Alter der Mitglieder sowie
nach dem Einkommen unterscheiden (mehr zu den Typen und zur Methode
unten). In einer Datenbank liefert der Inflationsmonitor zudem ein
erweitertes Datenangebot: Online lassen sich Trends der Inflation
für alle sowie für ausgewählte einzelne Haushalte im Zeitverlauf in
interaktiven Grafiken abrufen.
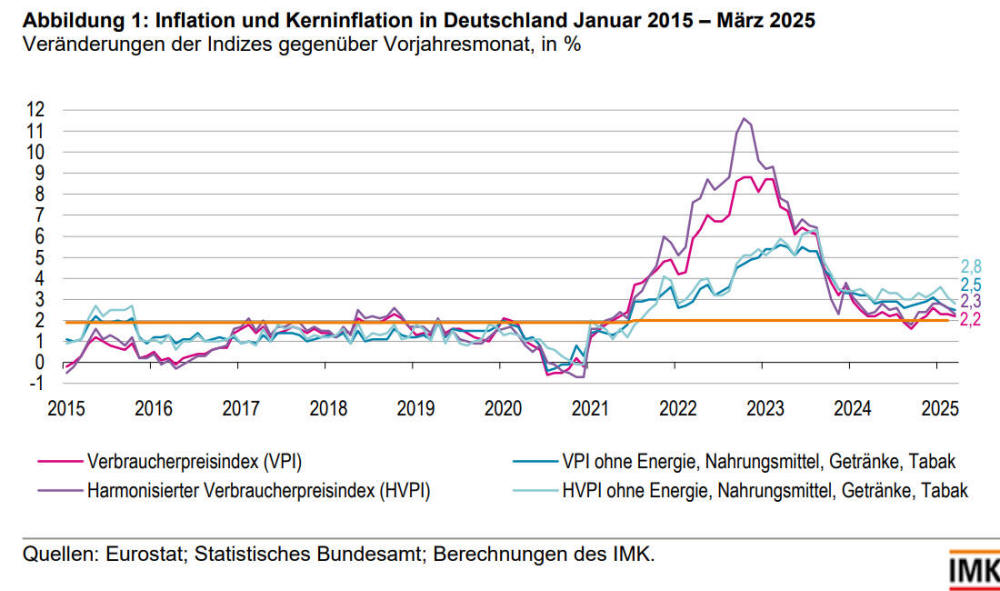
Die längerfristige Betrachtung illustriert, dass Haushalte mit
niedrigem bis mittlerem Einkommen von der starken Teuerung nach dem
russischen Überfall auf die Ukraine besonders stark betroffen waren,
weil Güter des Grundbedarfs wie Nahrungsmittel und Energie in ihrem
Budget eine größere Rolle spielen als bei Haushalten mit hohen
Einkommen.
Diese wirkten lange als die stärksten
Preistreiber, zeigt ein längerfristiger Vergleich, den Tober in
ihrem neuen Bericht ebenfalls anstellt: Die Preise für
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke lagen im März 2025 um 39,8
Prozent höher als im März 2019, also vor Pandemie und Ukrainekrieg.
Damit war die Teuerung für diese unverzichtbaren Basisprodukte mehr
als dreimal so stark wie mit der EZB-Zielinflation von kumuliert
12,6 Prozent in diesem Zeitraum vereinbar. Energie war trotz der
Preisrückgänge in letzter Zeit um 39,2 Prozent teurer als im März
2019. Deutlich weniger stark, um 19,5 Prozent, stiegen über die
sechs Jahre die Preise für Dienstleistungen.
Auf dem
Höhepunkt der Inflationswelle im Oktober 2022 betrug die
Teuerungsrate für Familien mit niedrigen Einkommen 11 Prozent, die
für ärmere Alleinlebende 10,5 Prozent. Alleinlebende mit sehr hohen
Einkommen hatten damals mit 7,9 Prozent die mit Abstand niedrigste
Inflationsrate.
Im März 2025 verteuerten sich die
spezifischen Warenkörbe von Haushalten mit niedrigen bis mittleren
Einkommen hingegen etwas weniger stark als die von Haushalten mit
hohen Einkommen, weil zuletzt vor allem die Preise für
Dienstleistungen anzogen, die mit steigendem Einkommen stärker
nachgefragt werden. Daher wiesen im Vergleich der neun
Haushaltstypen Alleinlebende mit sehr hohen Einkommen und Familien
mit hohen Einkommen mit 2,0 bzw. 1,9 Prozent geringfügig höhere
Werte aus.
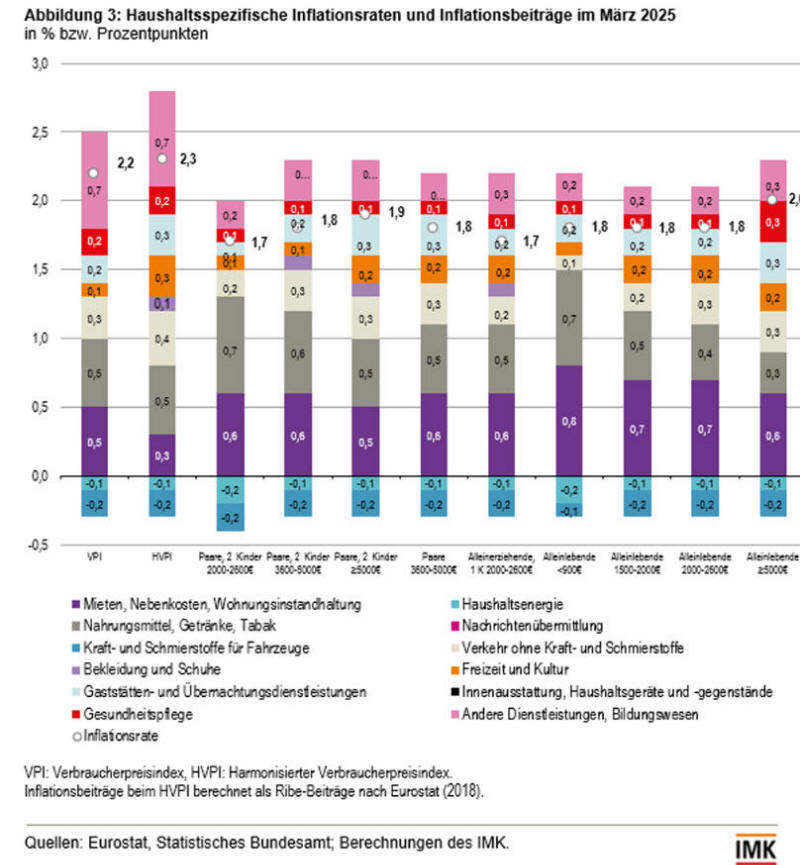
Dass aktuell alle vom IMK ausgewiesenen haushaltsspezifischen
Inflationsraten leicht unter der Gesamtinflation liegen, wie sie das
Statistische Bundesamt berechnet, liegt an unterschiedlichen
Gewichtungen: Das IMK nutzt für seine Berechnungen weiterhin die
repräsentative Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, während
Destatis seit Anfang 2023 die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
heranzieht.
Informationen zum Inflationsmonitor
Für den
IMK Inflationsmonitor werden auf Basis der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamts die für
unterschiedliche Haushalte typischen Konsummuster ermittelt. So
lässt sich gewichten, wer für zahlreiche verschiedene Güter und
Dienstleistungen – von Lebensmitteln über Mieten, Energie und
Kleidung bis hin zu Kulturveranstaltungen und Pauschalreisen – wie
viel ausgibt und daraus die haushaltsspezifische Preisentwicklung
errechnen. Die Daten zu den Haushaltseinkommen stammen ebenfalls aus
der EVS.
Im Inflationsmonitor werden neun repräsentative
Haushaltstypen betrachtet: Paarhaushalte mit zwei Kindern und
niedrigem (2000-2600 Euro), mittlerem (3600-5000 Euro), höherem
(mehr als 5000 Euro) monatlichem Haushaltsnettoeinkommen; Haushalte
von Alleinerziehenden mit einem Kind und mittlerem (2000-2600 Euro)
Nettoeinkommen; Singlehaushalte mit niedrigem (unter 900 Euro),
mittlerem (1500-2000 Euro), höherem (2000-2600 Euro) und hohem (mehr
als 5000 Euro) Haushaltsnettoeinkommen sowie Paarhaushalte ohne
Kinder mit mittlerem Haushaltsnettoeinkommen zwischen 3600 und 5000
Euro monatlich. Der IMK Inflationsmonitor wird monatlich
aktualisiert.
Licht und
Schatten im Bereich Technik und Innovation im Koalitionsvertrag von
Union und SPD
CSU-Chef Markus Söder verspricht mit dem
Ministerium Forschung, Technologie und Raumfahrt eine
Technik-Attacke der neuen Bundesregierung. Dazu erklärt VDI-Direktor
Adrian Willig:

VDI-Direktor Adrian Willig: "Wir schlagen eine unabhängige Beratung
der neuen Bundesregierung durch ein externes Gremium vor."
„Der Aufbau eines zentralen Ministeriums für Zukunftstechnologien
mit dem Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt ist ein
starkes Signal und ein überfälliger Schritt. Jetzt darf der
Aufbauprozess des neuen Ministeriums nicht zu einer monatelangen
Selbstbeschäftigung führen, sondern den großen Worten müssen auch
große Taten folgen.
Erste Amtshandlung der neuen Leitung des
Technologie- und Forschungsministeriums muss die Einberufung eines
Innovationsgipfels sein. Wir brauchen eine langfristige
Innovationsstrategie des Bundes, die gezielt Schlüsseltechnologien
der Zukunft stärkt. Das reicht von KI über Quantentechnologien bis
zur klimaneutralen Produktion. Der Fokus auf Schlüsseltechnologien
der neuen Bundesregierung im Bereich der Forschungs- und
Innovationsförderung ist daher begrüßenswert.
Und auch wenn
die Finanzierung noch nicht geklärt ist, ist eine angestrebte
Erhöhung der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf
mindestens 3,5 Prozent des BIP der richtige Weg. Klar ist jedoch für
all diese Vorhaben: Dazu braucht es ausreichend hochqualifizierte
Fachkräfte im Ingenieur- und IT-Wesen. Ingenieurinnen und Ingenieure
werden für all diese Pläne eine zentrale Rolle spielen und daher ist
es umso bedauerlicher, dass im Koalitionsvertrag das Wort
„Ingenieur“ überhaupt nicht vorkommt.
Wichtig für den
Wirtschaftsstandort ist aber nicht nur, wie wir Technologien
fördern, sondern vor allem, wie wir in die Umsetzung kommen. Die
angekündigte Investitionsoffensive mit zehn Milliarden Euro wird
alleine ohne die Innovationskraft der Unternehmen nicht reichen.
Wir schlagen daher eine unabhängige Beratung der neuen
Bundesregierung durch ein externes Gremium vor, um die angekündigte
Technik-Attacke von Markus Söder mit wissenschaftlicher Expertise
und technologischer Weitsicht strategisch zu untermauern.“
Koalitionsvertrag greift
im Bereich der psychischen Gesundheit zu kurz – BDP sieht hier
deutlichen Nachbesserungsbedarf
Wir brauchen eine neue
Kultur der Wertschätzung und des Vertrauens – und mit der
Psychologie einen Motor für politische und gesellschaftliche
Veränderungsprozesse
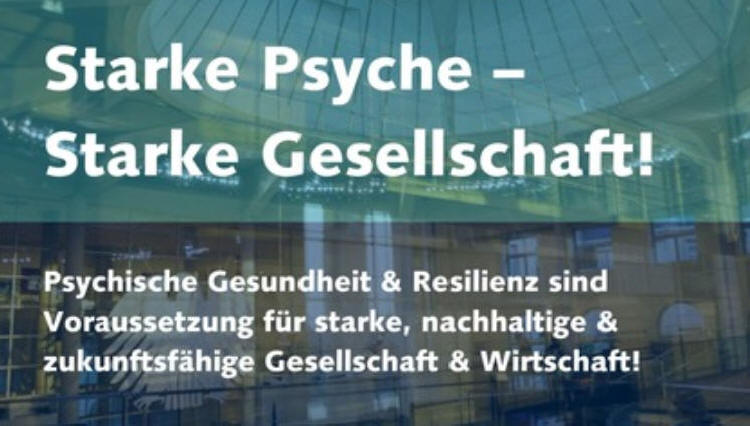
Deutschland steht vor großen und vielfältigen Herausforderungen, die
bei einem Großteil der Bevölkerung zu starker Verunsicherung führen.
Die globalen politischen Entwicklungen, der Klimawandel sowie
Umweltkatastrophen, globale Krisenherde und Kriege, eine deutlich
spürbare Inflation, aber auch Themen wie Migration, soziale
Ungleichheit und eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung belasten
viele Menschen in Deutschland. Gleichzeitig scheint das Vertrauen in
eine lösungsorientierte Handlungsfähigkeit der Politik immer weiter
zu schwinden.
Mit dem nun unterzeichneten Koalitionsvertrag
setzt die neue Bundesregierung auf mehr staatliche Kontrolle, eine
Verschärfung von Sanktionen und Einschränkung von Rechten, auch bei
Menschen mit psychischen Erkrankungen, um damit für ein mehr an
(gefühlter) Sicherheit in Deutschland zu sorgen.
Der Wunsch nach
einfachen und schnellen Lösungen ist stark, doch für ein neues
Vertrauen in die Politik und Zusammenhalt in der Gesellschaft
braucht es einen partizipativen, lösungsorientierten Ansatz und
Politiker*innen, die die Verunsicherung und Bedürfnisse der Menschen
in Deutschland glaubwürdig ernst nehmen.
Der Berufsverband
Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) sendet einen
deutlichen Appell in Richtung Politik, die psychische Gesundheit und
Resilienz der Bevölkerung als Voraussetzung und grundlegende
Ressourcen für eine starke, nachhaltige und zukunftsfähige
Gesellschaft und auch Wirtschaft zu verstehen.
Immerhin
berücksichtigt der Koalitionsvertrag die Notwendigkeit einer
gesetzlichen Regelung der psychotherapeutischen Versorgung der
Bevölkerung sowie auch der Finanzierung der psychotherapeutischen
Weiterbildung. Mit der Strategie „Mentale Gesundheit für junge
Menschen“ setzt die neue Regierung verstärkt auf Prävention von
psychischen Erkrankungen, was der BDP begrüßt und ausdrücklich
unterstützt.
Insgesamt ermuntert der Verband, bei der
Umsetzung des Koalitionsvertrags das Verständnis psychologischer
Intervention deutlich über die Psychotherapie hinaus auszuweiten
bzw. überhaupt erst vorzusehen. Die Psychologie steuert ganz
grundlegend zur Prävention im Bereich psychischer Gesundheit bei.
Psycholog*innen leisten einen essenziellen Beitrag zur frühzeitigen
Erkennung von Belastungen, zur Entwicklung von
Bewältigungsstrategien und zur Förderung von Resilienz und damit zum
Erhalt der psychischen Gesundheit in allen relevanten
gesellschaftlichen Bereichen wie der Arbeitswelt, dem Bildungs- und
Gesundheitswesen oder der öffentlichen Verwaltung.
Globale,
nationale und lokale Krisen erfordern eine kontinuierliche Bewertung
und entsprechende Verhaltensanpassung auf politischer wie auch
gesellschaftlicher Ebene. Was es dazu braucht, ist eine umfassende
strukturelle Verankerung psychologischer Kompetenzen im Netzwerk
gesundheitspolitischer Maßnahmen, um das volle Potenzial
psychologischer Expertise zum Wohl der Gesellschaft nutzbar machen
zu können.
Als Berufsverband der Psycholog*innenschaft in
Deutschland appellieren wir an die Politik, wichtige Reformvorhaben
mutig anzustoßen. Die Initiativen und Positionspapiere des BDP haben
dabei ein breites Themenspektrum im Blick:
In Zeiten multipler
Dauer-Krisen braucht es eine nachhaltige
psychologisch-psychotherapeutische Versorgungssicherung für die
gesamte Bevölkerung – die fängt schon mit der Ausbildung an.
Mit Blick auf die aktuelle Weltlage fordern wir die Verankerung der
Psychosozialen Notfallversorgung im Zivilschutz- und
Katastrophenhilfegesetz.
Die Folgen des Klimawandels erfordern
eine Strategie, die die Gesellschaft in ihrer Resilienz und
Anpassungsfähigkeit stärkt, nachhaltige Verhaltensveränderungen
fördert und sichere Zukunftsperspektiven schafft.
Bei den
Herausforderungen der modernen Arbeitswelt braucht es spezifisches
Fachwissen zur effektiven Prävention und Gesundheitsförderung. Die
Lösung sehen wir in der Aufnahme der Profession in das
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG). Und bei der zunehmenden Komplexität
im Bereich der Digitalisierung kann die psychologische Expertise
Risiken managen, Kompetenzen vermitteln und Vertrauen schaffen.
Ein besonderes Augenmerk verdienen die jüngsten Mitglieder
unserer Gesellschaft. Um Mut, Zuversicht und persönliche
Perspektiven entwickeln zu können, brauchen Kinder und Jugendliche
verlässliche und niederschwellige Unterstützungsangebote sowie auch
eine nachhaltige Bildungspolitik.
Für alle Bereiche der
Gesellschaft gilt: Psychologie hilft. Deshalb fordern wir dringend
ein Psycholog*innengesetz, das Orientierung bietet, Sicherheit
schafft und damit für einen besseren Verbraucherschutz sorgt.
Die
psychische Gesundheit ist Grundlage für alle positiven
gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse. Als Verband setzen wir uns
auch 2025 weiterhin dafür ein. Denn es gilt: Starke Psyche – starke
Gesellschaft!

NRW: Höchststand an Schwangerschaftsabbrüchen seit 2008
Für das Jahr 2024 haben Arztpraxen und Krankenhäuser
23 445 Schwangerschaftsabbrüche von Frauen mit Wohnsitz in
Nordrhein-Westfalen gemeldet. Wie das Statistische Landesamt
mitteilt, ist dies die höchste Zahl seit 2008 (damals 24 120
Schwangerschafts-abbrüche).
Nach einem Rückgang in den
Jahren 2020 und 2021 stieg die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche
seit 2022 im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Am stärksten war der
Anstieg von 2021 auf 2022 mit 13,4 Prozent. In den Folgejahren fiel
er mit 3,0 Prozent in 2023 und 0,9 Prozent in 2024 schwächer aus.
Neun von zehn Frauen waren zwischen 18 und 39 Jahre alt –
drei Prozent waren minderjährig Unter den Frauen, die 2024 einen
Abbruch vornehmen ließen, waren 695 Minderjährige, das entspricht
einem Anteil von 3,0 Prozent an allen Abbrüchen (2008: 4,8 Prozent).
70 Mädchen waren jünger als 15 Jahre. Neun von zehn Frauen
(89,5 Prozent) waren zum Zeitpunkt des Abbruchs 18 bis 39 Jahre alt;
die übrigen 7,6 Prozent waren 40 Jahre oder älter. Gut die Hälfte
der Frauen (54,8 Prozent) hatte vor dem Abbruch bereits mindestens
ein Kind geboren. Von diesen 12 840 Frauen hatten 3 025 bereits drei
oder vier Kinder. Weitere 455 Frauen hatten vor dem
Schwangerschaftsabbruch fünf oder mehr Kinder.
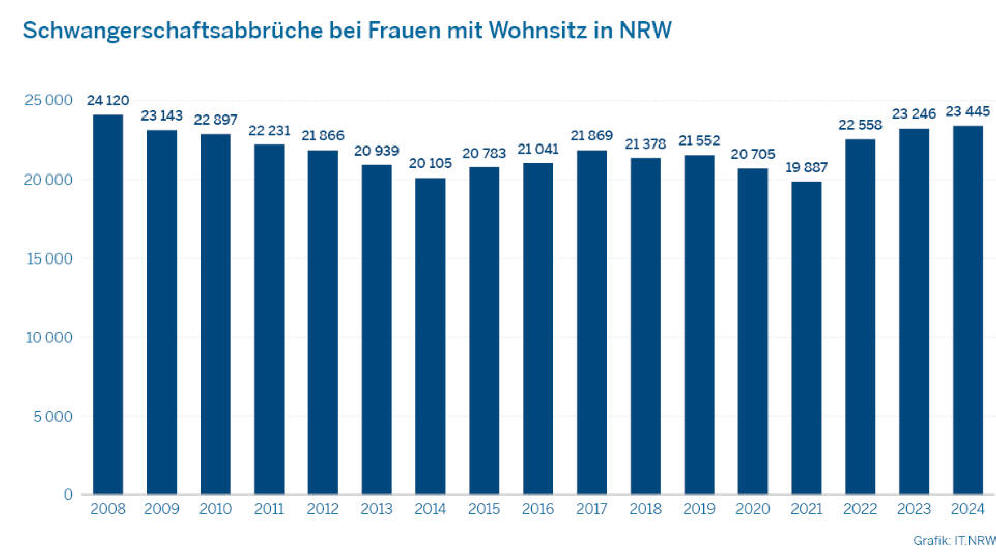
Bei rund der Hälfte der Fälle erfolgte der Eingriff vor der
siebten Schwangerschaftswoche
In 50,1 Prozent der Fälle erfolgte
der Schwangerschaftsabbruch vor der siebten Schwangerschaftswoche;
etwa 80,3 Prozent aller Schwangerschaften wurden vor der neunten und
96,7 Prozent vor der zwölften Woche abgebrochen. 94,9 Prozent der
Abbrüche erfolgten im Anschluss an die gesetzlich vorgeschriebene
Beratung.
Indikationen aus medizinischen Gründen oder
aufgrund von Sexualdelikten waren in 5,1 Prozent der Fälle die
Begründung für den Abbruch. Mit 97,3 Prozent wurden die meisten
Schwangerschaftsabbrüche ambulant in Arztpraxen und Krankenhäusern
durchgeführt; 2,8 Prozent der Eingriffe erfolgten stationär in
Krankenhäusern. (IT.NRW)
NRW: Im Jahr 2024 verdienten
Vollzeitbeschäftigte 62 119 Euro brutto
Im Jahr 2024
betrugen die durchschnittlichen Bruttojahresverdienste (inkl.
Sonderzahlungen) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen 62 119 Euro. Mit einem
durchschnittlichen Bruttojahresverdienst von 105 975 Euro lagen
vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer/-innen im Bereich der „Kokerei und
Mineralölverarbeitung” an der Spitze der Verdienste in
Nordrhein-Westfalen.
Wie das Statistische Landesamt weiter
mitteilt, waren ihre Bruttojahresverdienste damit fast 44 000 Euro
höher als der Durchschnittswert aller Wirtschaftszweige. Platz zwei
und drei im Verdienstranking belegten die Beschäftigten der
Wirtschaftsabteilungen „Kohlenbergbau“ und „Erbringung von
Finanzdienstleistungen“.
Zu den weiteren Spitzenverdienern
gehörten die Vollzeitbeschäftigten der Wirtschaftsabteilungen
„Kohlenbergbau” (97 576 Euro), „Erbringung von
Finanzdienstleistungen” (93 446 Euro), „Verwaltung und Führung von
Unternehmen und Betrieben” (93 015 Euro), „Energieversorgung”
(92 185 Euro) sowie „Telekommunikation” (85 356 Euro).
Die
Bruttoverdienste im Bereich der Gastronomie lagen am Ende der
Verdienstskala Am unteren Ende der Verdienstskala befanden sich die
Vollzeitbeschäftigen in den Bereichen „Gastronomie” (36 732 Euro),
„Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen”
(37 773 Euro), „Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene
Tätigkeiten” (37 942 Euro), „Beherbergung” (39 635 Euro),
„Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau” (43 003 Euro) und
„Spiel-, Wett- und Lotteriewesen” (43 861 Euro).