






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 17. Kalenderwoche:
21. April
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Dienstag, 22. April 2025
Information für Anwohner: Geplante Arbeiten an der Kokerei
Schwelgern von thyssenkrupp Steel am 22. April
Am
22. April wird an der Kokerei Schwelgern von thyssenkrupp Steel die
zentrale Koksgasleitung an die Mischgasstation des neuen
Warmbandwerkes 4 geschlossen. Dazu muss die Koksgasleitung außer
Betrieb genommen werden. Die Außerbetriebnahme des Koksgasnetzes
wird zudem genutzt, um notwendige Instandsetzungsmaßnahmen in den
Kohlenwertstoffanlagen der Kokerei durchzuführen.

Am 22. April wird an der Kokerei Schwelgern von
thyssenkrupp Steel die zentrale Koksgasleitung an die
Mischgasstation des neuen Warmbandwerkes 4 geschlossen. Während der
Maßnahme wird das Koksofengas über die Hochfackel abgefackelt.
Die Arbeiten selbst sind nicht mit erhöhtem Lärm verbunden. Das
Abbrennen des Koksofengases über die Hochfackel könnte zu einem
hörbaren „Fauchen“ führen. Hintergrund und Notwendigkeit der
Arbeiten Am Standort Duisburg-Bruckhausen baut thyssenkrupp Steel
ein modernes Warmbandwerk und ein Brammenlager.
Mit dem Um-
und Neubau zweier Stranggießanlagen sowie dem Bau von zwei neuen
Hubbalkenöfen stärkt das Unternehmen den Stahlstandort Duisburg
weiter und sichert damit langfristig Beschäftigung. In diesem
Projektstadium wird am 22. April die zentrale Koksgasleitung an die
Mischgasstation des neuen Warmbandwerkes 4 angeschlossen. Ihre
Funktion ist es, zukünftig das Warmbandwerk 4 mit Gas zu versorgen.
Während der Maßnahme, die voraussichtlich acht Stunden
dauern wird, muss das Koksofengas über die Hochfackel abgefackelt
werden. Eine Zuführung zu den üblichen Verbrauchern wie
Warmbandwerke und Kraftwerke ist in dieser Zeit nicht möglich.
Auswirkungen auf die Anwohner Während der Maßnahme wird die
Hochfackel auf dem Werkgelände von thyssenkrupp Steel für etwa acht
Stunden sichtbar in Betrieb sein. Für Mensch und Umwelt stellt diese
keine Gefahr dar.
Die Arbeiten selbst sind nicht mit
erhöhtem Lärm verbunden. Das Abbrennen des Koksofengases über die
Hochfackel könnte zu einem hörbaren „Fauchen“ führen. Die Arbeiten
sind in Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf sorgfältig
geplant und werden nur bei außergewöhnlichen Witterungsbedingungen
verschoben. Das Unternehmen bittet die Anwohner um Verständnis und
dankt für ihre Geduld während dieser notwendigen Maßnahme.
Vor 10 Jahren in der BZ: Nahmobilität im
Lebensraum Stadt
Wie sieht der Stadtverkehr
im nächsten Jahrzehnt aus? Was zeichnet die Gestaltung
zukunftsfähiger Verkehrsräume aus? Was ist unter „Stadt
als Lebensraum“ zu verstehen? Inwiefern kann die Förderung
von Nahmobilität zur Lösung aktueller und zukünftiger
Verkehrs-, Umwelt- und Gesundheitsprobleme beitragen?
Diese und andere zentrale Fragen zukünftiger
kommunaler Verkehrspolitik werden auf dem Politikforum
diskutiert. Demographischer Wandel – neue Ansprüche durch
die Altersgesellschaft –, Klimaveränderung, der neue
Urbanismus, aber auch das zu Ende gehende fossile
Zeitalter und der Übergang in die Elektromobilität sind
Anlass genug, über eine Neuausrichtung kommunaler
Verkehrspolitik zu sprechen. Mit dem Politikforum bietet
die AGFS ein bewährtes Format an, das sich exklusiv an
politische Entscheider vornehmlich in Städten und
Gemeinden richtet.
Politische Entscheider deshalb,
weil über zentrale Fragen zukünftiger Gestaltung und
Finanzierung kommunaler Verkehrsinfrastrukturen gesprochen
werden soll. Das bietet die Chance, in einem exklusiven
Teilnehmerkreis intensiv über Fragen der Nahmobilität zu
diskutieren. So sind vorrangig Politiker aus den
AGFS-Mitgliedskommunen Bottrop, Duisburg, Essen,
Mülheim/Ruhr und Oberhausen eingeladen.

Das
Politikforum wird von der Arbeitsgemeinschaft fußgänger-
und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise e.V.
(AGFS) veranstaltet, die aktuell 71 Städte, Gemeinden und
Kreise als Mitglieder verzeichnet. Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft sind nicht nur
„nahmobilitätsfreundlich“, sondern verstehen sich darüber
hinaus als Modellstädte für eine zukunftsfähige,
ökologisch sinnvolle und stadtverträgliche Mobilität, die
auch das Auto mit einbezieht.
Alle Maßnahmen, die das
Leitbild „Stadt als Lebensraum“ stärken, werden
unterstützt. In der konsequenten Förderung der
Nahmobilität (Fußgänger, Radfahrer, Inliner u.a.) werden
nicht nur die Potenziale zur Lösung zentraler Probleme in
den Handlungsfeldern Verkehr, Klima, Umwelt und Gesundheit
gesehen, sondern es geht letztlich darum, zukunftsfähige,
belebte und wohnliche Städte zu gestalten, und damit die
Lebens- und Bewegungsqualität deutlich zu verbessern. Dies
sind die Themen am Mittwoch, 22. April 2015 in der
Kulturkirche Liebfrauen am König-Heinrich-Platz.
Brückentag am 2. Mai: Informationen zur Erreichbarkeit der
Stadt Duisburg
Die Stadtverwaltung Duisburg ist am
Freitag, 2. Mai (Brückentag nach dem Tag der Arbeit), nur
eingeschränkt erreichbar. Einzelne Dienststellen sind von dieser
Regelung ausgenommen, wie beispielsweise der Notruf der Feuerwehr
und der Städtische Außendienst, die wie gewohnt erreichbar sind.
Das telefonische Servicecenter „Call Duisburg“ ist nur mit einem
eingeschränkten Notdienst besetzt. Die Bürgerservicestationen, das
Amt für Soziales und Wohnen, das Amt für Schulische Bildung, das Amt
für Rechnungswesen und Steuern, das Amt für Baurecht und
betrieblichen Umweltschutz, das Umweltamt, der Innendienst des
Bürger- und Ordnungsamtes, die Ausländerbehörde, die
Einbürgerungsbehörde, das Straßenverkehrsamt, alle Dienststellen im
Stadthaus (wie beispielsweise Erteilung von Parkausweisen und
Katasterauskünfte), sowie in großen Teilen das Jugendamt und das
Stadtarchiv sind am Brückentag nicht erreichbar, ebenso das
Standesamt.
Eheschließungstermine vom Standesamt, die
für diesen Tag vereinbart wurden, finden statt. Bestatter können
sich erst am Montag, 5. Mai, für die Beurkundung von Sterbefällen
und Ausstellung von Leichenpässen an das Standesamt wenden. Die
städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die Schulen sind von den
Betriebsferien an diesem Tag nicht betroffen.
Einige
Einrichtungen haben jedoch bereits im Vorfeld die Schließung für
diesen Tag eingeplant. Die Zentralbibliothek auf der Steinschen
Gasse ist am Freitag, 2. Mai, und Samstag, 3. Mai, zu den gewohnten
Zeiten geöffnet. Die Open Libraries in Beeck, Wanheimerort und
Vierlinden stehen Kundinnen und Kunden mit gültigem Ausweis an allen
Tagen, auch am Feiertag, wie gewohnt zur Verfügung. Alle anderen
Zweigstellen der Bibliothek bleiben geschlossen. Der Bücherbus fährt
an diesem Tag nicht. Das Online-Angebot der Stadtbibliothek kann mit
einem gültigen Bibliotheksausweis uneingeschränkt genutzt werden.
Die städtischen Bäder, das Museum der Deutschen
Binnenschifffahrt sowie das Kultur- und Stadthistorische Museum
haben an diesem Tag ebenso wie gewohnt geöffnet. Der Unterricht an
der Volkshochschule und der Musik- und Kunstschule findet statt. Die
Geschäftsstellen der Volkshochschule und Musik- und Kunstschule sind
geschlossen, die VHS und die MKS bleiben aber telefonisch
erreichbar. Die gesamte Stadtverwaltung ist ab Montag, 5. Mai,
wieder wie gewohnt erreichbar.
Am Freitag, 30. Mai
(Brückentag nach Christi Himmelfahrt), ist die Stadt Duisburg
ebenfalls nur eingeschränkt erreichbar. An Brückentagen können durch
den Abbau von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub oder
Freizeitausgleich sowie die Reduzierung von Energiekosten weitere
Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung erzielt werden. Durch die
CO2-Reduzierung (Strom, Pendelverkehr) ergeben sich auch positive
Effekte für die Umwelt.
Wichtiger Hinweis zur Erreichbarkeit
und dem Besuch von städtischen Einrichtungen: Die Kontaktdaten der
Dienststellen sind auf der Internetseite der Stadt Duisburg unter
www.duisburg.de einsehbar oder können telefonisch unter (0203) 94000
über Call Duisburg erfragt werden. Viele Anliegen lassen sich auch
online erledigen. Eine Übersicht hierzu gibt es auf der städtischen
Internetseite unter dem Stichwort „Bürgerportal“. Eine
Online-Terminvergabe im Bereich der Bürgerservicestationen ist
ausschließlich unter www.duisburg.de/termine möglich.
Bibliothek für die Generation Plus
Die
Zentralbibliothek, Steinsche Gasse 26, in der Duisburger Innenstadt
lädt Seniorinnen und Senioren am Dienstag, 22. April, zu einem
Workshop rund um die Nutzung der Bibliothek ein. Bei der
Veranstaltung „Bibliothek heute – alles Technik oder was?“ wird
Schritt für Schritt erklärt, wie eine Bibliothek heute funktioniert,
wie man den elektronischen Medienkatalog nutzt, seine Medien
eigenständig verbucht und zurückgibt.
Dabei gibt es viel
Zeit für alle Fragen und zum Ausprobieren. Weitere Informationen und
die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich online auf
www.stadtbibliothek-duisburg.de (unter „Veranstaltungen“). Bei
Fragen steht das Team der Bibliothek gerne telefonisch unter 0203
283-4218 oder persönlich zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind
montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr
sowie samstags von 11 bis 16 Uhr.
Achtung Autofahrer: Marder
machen wieder Jagd auf Kabel und Schläuche
Welche
Risiken muss Teilkasko-Versicherung beim Marderschaden abdecken?

HUK-COBURG: Marderschäden kosteten im vergangenen Jahr 26 Mio. Euro
Jetzt wird zugebissen: Die Marder sind wieder unterwegs. Die
kleinen Raubtiere lieben den engen Platz unter der Motorhaube: Eine
kuschelige Höhle zum Wohlfühlen. Allein der Geruch eines
vermeintlichen Konkurrenten, der seine Duftmarke hinterlässt, kann
ihr Wohlgefühl trüben. In diesem Moment sind wilde Beißattacken
vorprogrammiert.
Autofahrer mit Straßengarage müssen damit
rechnen, dass sich Marder zum Beispiel an den Kabeln ihrer
Zündkerzen oder an den Brems- und Kühlwasserschläuchen ihrer Pkw
vergehen. Das kann, wie die HUK-COBURG mitteilt, teuer werden. Mehr
als 54.000-mal bissen die kleinen Raubtiere im vergangenen Jahr bei
den Autos von HUK-COBURG-Kunden zu.
Die Beseitigung der Attacken
kostete durchschnittlich knapp 600 Euro. In der Spitze waren sogar
Reparaturen von mehr als 3.500 Euro nötig. Insgesamt beliefen sich
die Regulierungskosten des oberfränkischen Versicherers auf knapp
als 26 Mio. Euro.
Aber ein Marderbiss kann nicht nur teuer,
sondern auch gefährlich werden. Oft bleiben die Schäden unentdeckt,
da die spitzen, kleinen Zähne der Raubtiere nur stecknadelgroße
Einstiche hinterlassen. Während der Fahrt kann es recht schnell zu
Folgeschäden kommen, zum Beispiel am Motor. Ein Blick auf die
Temperaturanzeige des Kühlwassers hilft: Geht der Zeiger in den
roten Bereich, ist ein Blick unter die Motorhaube unerlässlich.
Einziger Trost: Marderschäden sind oft – aber nicht immer – in
der Teilkasko mitversichert. Im Idealfall greift der
Versicherungsschutz nicht allein bei Marder- sondern generell bei
Tierbissschäden. Wichtig für den Versicherungsschutz: Er sollte
nicht nur die unmittelbaren Schäden, also die zerbissenen Schläuche,
abdecken.
Denn teuer werden meist die Folgeschäden, wenn Motor oder
Bremsen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Hier ist es wichtig, dass
diese Schäden komplett, ohne Limit, mitversichert sind. Das ist
nicht immer Fall. Ein Gespräch mit dem eigenem Kfz-Versicherer
bringt Klarheit.
Vorbeugen ist besser als reparieren
Ein
Wundermittel, das den Marder vom Motorraum fernhält, gibt es nicht.
Autobesitzer, die sich den ganzen Ärger mit Panne und Reparatur
ersparen wollen, können dem Marder das Zubeißen aber zumindest
erschweren. Wirkungsvoll und günstig sind stabile Kabelummantelungen
für gefährdete Bauteile aus dem Fachhandel.
Zudem verderben
spezielle Vorrichtungen zum Abschotten des Motorraums – wie sie
manche Autofirmen anbieten – dem kleinen Raubtier den Spaß mit
Kabeln, Dämmmatten und Wasserschläuchen. Auch gelegentliche
Motorwäschen sollen helfen. Sie entfernen alle Geruchsspuren aus dem
Motorraum, die andere Marder anlocken.
Marode Brücken in
Deutschland: Anwendung der Richtlinie VDI 6200 unerlässlich
Der Sanierungsstau bei Deutschlands Brücken ist größer als bislang
angenommen. Laut einer aktuellen Erhebung der Organisation Transport
& Environment (T&E) sind rund 16.000 Brücken in Bundeshand als
baufällig einzustufen. Der VDI sieht dringenden Handlungsbedarf bei
der Einhaltung technischer Regeln. Die VDI 6200 bewertet dabei die
Standsicherheit von Bauwerken.

Dipl.-Ing. Frank Jansen, VDI e.V.
„Die VDI 6200 bietet seit
Jahren ein praxiserprobtes Instrument zur sicheren und
systematischen Beurteilung von bestehenden Bauwerken – besonders bei
altersbedingten Schäden und steigenden Belastungen“, sagt Frank
Jansen, Geschäftsführer der VDI-Gesellschaft Bauen und
Gebäudetechnik. „Angesichts des immensen Investitionsbedarfs muss
der Erhalt bestehender Infrastruktur absolute Priorität haben. Ein
einheitliches, ingenieurtechnisch fundiertes Vorgehen ist dabei
entscheidend.“
Die Richtlinie VDI 6200 stuft die Bauwerke in
eine Schadensfolgeklasse und in eine Robustheitsklasse ein. Abhängig
von Schadensfolgeklasse, statisch-konstruktiven Merkmalen,
Baustoffeigenschaften und Einwirkungen gibt sie Überprüfungsmethoden
und -verfahren an und empfiehlt Überprüfungsintervalle. Sie hilft
nicht nur, Risiken frühzeitig zu erkennen, sondern auch,
Sanierungsmaßnahmen gezielt zu priorisieren. Kommunale Akteure
können durch Anwendung von technischen Regeln besser unterstützt
werden.
VDI als Gestalter der Zukunft
Mit unserer
Community und unseren rund 130.000 Mitgliedern setzen wir, der VDI
e.V., Impulse für die Zukunft und bilden ein einzigartiges
multidisziplinäres Netzwerk, das richtungweisende Entwicklungen
mitgestaltet und prägt. Als bedeutender deutscher technischer
Regelsetzer bündeln wir Kompetenzen, um die Welt von morgen zu
gestalten. und leisten einen wichtigen Beitrag, um Fortschritt und
Wohlstand zu sichern.
Mit Deutschlands größter Community für
Ingenieurinnen und Ingenieure, unseren Mitgliedern und unseren
umfangreichen Angeboten, schaffen wir das Zuhause aller technisch
inspirierten Menschen. Dabei sind wir bundesweit, auf regionaler und
lokaler Ebene in Landesverbänden und Bezirksvereinen aktiv. Das
Fundament unserer täglichen Arbeit bilden unsere rund 10.000
ehrenamtlichen Expertinnen und Experten, die ihr Wissen und ihre
Erfahrungen einbringen.
Die Richtlinie beschreibt, wie
regelmäßige Überprüfungen der Standsicherheit von Immobilien
strukturiert und effizient und wirtschaftlich durchzuführen sind, um
Bauschäden oder Schäden für Leib und Leben zu verhindern. Sie gibt
Beurteilungs- und Bewertungskriterien, bewährte Checklisten,
Handlungsanleitungen und Empfehlungen zur Beurteilung der
Standsicherheit baulicher Anlagen und zu ihrer Instandhaltung sowohl
für Bestands- als auch für Neubauten.
Die Richtlinie stuft
die Bauwerke in eine Schadensfolgeklasse und in eine
Robustheitsklasse ein. Sie formuliert Vorgaben für die
Bestandsdokumentation und definiert Anforderungen an die
Überprüfenden. Abhängig von Schadensfolgeklasse,
statisch-konstruktiven Merkmalen, Baustoffeigenschaften und
Einwirkungen gibt sie Überprüfungsmethoden und -verfahren an und
empfiehlt Überprüfungsintervalle.
Der Anwendungsbereich der
Richtlinie umfasst bauliche Anlagen aller Art mit Ausnahme von
Brücken und Tunneln. Die Richtlinie VDI 6200 richtet sich an
Gebäudeeigentümer, Verfügungsberechtigte und beteiligte Fachleute,
wie planende und beratende Ingenieure, Architekten, Prüfingenieure
für Baustatik, Facility-Manager, Verwalter von Immobilien,
Bauabteilungen von Industrie- und Privatunternehmen, sowie die
öffentliche Hand.
„Scharfes Schwert“ gegen prekäre Arbeitsbedingungen
Direktanstellungsgebot wie auf Schlachthöfen: Rechtsgutachten zeigt
Kriterien für Übertragbarkeit auf weitere Branchen
In
der Fleischbranche hat der Gesetzgeber durchgegriffen und für
bessere Arbeitsbedingungen gesorgt. Ein Vorbild für die
Paketzustellung – und auch für andere Wirtschaftsbereiche? Das lotet
eine neue Studie aus, die das Hugo Sinzheimer Institut für Arbeits-
und Sozialrecht (HSI) der Hans-Böckler-Stiftung gefördert hat.*
Die miserablen Arbeitsbedingungen von Migrant*innen, die zu
extrem niedrigen Löhnen bei langen Arbeitszeiten als Beschäftigte
verschachtelter Subunternehmer-Konstruktionen in deutschen
Schlachthöfen schufteten, waren nie ein Geheimnis. Doch erst die
Corona-Ausbrüche in Fleischbetrieben im Jahr 2020 lenkten die
öffentliche Aufmerksamkeit auf eine Branche, in der die Missachtung
von Arbeitsschutzvorschriften an der Tagesordnung war.
Die
Politik reagierte mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz, einem Bündel
von Maßnahmen, die zum Teil rechtliches Neuland darstellten. Unter
anderem darf die Fleischindustrie heute keine Verträge im
Kernbereich ihrer Tätigkeit mit Subunternehmern mehr schließen, um
an billiges Personal zu kommen. Eine aktuelle Branchenstudie zeigt:
Zwar lässt das Lohnniveau immer noch zu wünschen übrig, doch
insgesamt hat sich die Lage der Beschäftigten deutlich verbessert.
Könnten und sollten Regelungen, die das
Arbeitsschutzkontrollgesetz für die Fleischwirtschaft trifft, auf
andere Branchen mit prekären Beschäftigungsbedingungen übertragen
werden? Mit dieser Frage setzt sich das neue Rechtsgutachten im
Auftrag des HSI auseinander. Anneliese Kärcher und Prof. Dr. Manfred
Walser von der Hochschule Mainz haben Anhaltspunkte
herausgearbeitet, die dafür sprechen, dass der Gesetzgeber in einer
Branche mit dem „scharfen Schwert“ des Direktanstellungsgebots
durchgreifen kann, wie er es in den Schlachthöfen getan hat:
- Wesentliche Teile der Arbeitsleistung werden von Fremdpersonal
erbracht, etwa durch die Vergabe von Werk- oder Dienstverträgen an
Subunternehmer und an Soloselbstständige oder durch die
Beschäftigung von Leiharbeitskräften.
- Die Art des
Personaleinsatzes führt zu Intransparenz und unklaren
Verantwortlichkeiten.
- Ein großer Teil der Beschäftigten ist in
einer schwachen Position, zum Beispiel wegen des Aufenthaltsstatus,
eines geringen Ausbildungsniveaus oder fehlender Sprachkenntnisse.
- In der Branche wird „in erheblichem Ausmaß“ gegen
Mindestarbeitsbedingungen verstoßen und illegale Beschäftigung ist
an der Tagesordnung.
- Die Einhaltung der
Arbeitsschutzbestimmungen ist schwer zu kontrollieren.
- Es
fehlen die strukturellen Voraussetzungen, um Missstände mithilfe
„kollektivarbeitsrechtlicher Instrumente“ – wie etwa der
Sozialkassen der Bauwirtschaft – abzustellen.
- Es stehen keine
„milderen“ Regulierungsinstrumente zur Verfügung, die effektiv
wären.
- Die Branche lässt sich klar abgrenzen.
In einer
Gesamtschau dieser Branchenumstände, so Kärcher und Walser, wäre ein
Direktanstellungsgebot wie in der Fleischwirtschaft nach deutschem
und europäischem Recht zulässig – und nötig. Es würde nämlich für
klare Verantwortlichkeiten sorgen und so eine effektive
Rechtswahrnehmung und -durchsetzung ermöglichen. Nicht zuletzt
könnte dann auch Mitbestimmung effektiv ausgeübt werden, was in der
Folge auch den Weg für Tarifverträge ebnen könnte.
Dr.
Ernesto Klengel, wissenschaftlicher Direktor des HSI, sagt: „Prekäre
Arbeitsbedingungen sind kein Naturgesetz, es gibt eine Reihe von
Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Das Gebot, dass Unternehmen die
Arbeitnehmer*innen, die sie im Betrieb einsetzen, selbst
beschäftigen, ist in vielen Branchen ein wirksames und effektives
Instrument.“
Eine Branche, die die Kriterien für ein
Direktanstellungsgebot erfüllt, ist laut der Analyse von Kärcher und
Walser die Paketzustellung. In anderen Wirtschaftsbereichen mit
prekären Beschäftigungsbedingungen, in denen Fremdpersonaleinsatz
keine Rolle spielt, etwa der landwirtschaftlichen Saisonarbeit,
lägen die Voraussetzungen dagegen nicht vor. Um auch in solchen
Branchen Verbesserungen zu erreichen, empfehlen Kärcher und Walser
stattdessen die Einrichtung „zentralisierter Arbeitsinspektorate mit
umfassenden Kompetenzen hinsichtlich der Kontrolle, aber auch
erweiterten Möglichkeiten zur Durchsetzung von
Mindestarbeitsbedingungen“.
Kirche kocht und lädt zum kostenfreien
Mittagessen nach Untermeiderich
In der Evangelischen
Gemeinde Meiderich heißt es einmal im Monat „Kirche kocht“, denn im
Begegnungscafé „Die Ecke“, Horststr. 44a, stehen dann Ehrenamtliche
an den Töpfen und zaubern Leckeres; so zum Beispiel am 22. April,
wenn sie um 12 Uhr Leberkäse mit Stampfkartoffeln und
Salat auftischen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, das Angebot
ist kostenfrei.
„Wir wollen Wärme spenden, schöne
Momente schenken und gemeinsam Mittagessen!“ sagt Yvonne de
Temple-Hannappel, die Leiterin des Begegnungscafés (Tel. 0203 45 57
92 70, E-Mail: detemple-hannappel@gmx.de). Die Menüs für die
nächsten Termine stehen schon fest. Infos zur Gemeinde gibt es im
Netz unter
www.kirche-meiderich.de.

Engagierte
des Begegnungscafés „DIE ECKE“ Untermeiderich (Foto:
www.kirche-meiderich.de).

NRW-Wirtschaft importierte 2024 fast 50 Prozent weniger
Orchideen, Hyazinthen, Narzissen und Tulpen als im Vorjahr
Im Jahr 2024 importierte die NRW Wirtschaft nach vorläufigen
Ergebnissen über 2 000 Tonnen Orchideen, Hyazinthen, Narzissen und
Tulpen mit einem Warenwert von 22,4 Millionen Euro. Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, waren dies 47,8 Prozent weniger als
im Jahr zuvor. Damals wurden rund 4 000 Tonnen Orchideen,
Hyazinthen, Narzissen und Tulpen im Wachstum oder in der Blüte
importiert.
Gemessen an der Importmenge waren 2024 die
Niederlande mit einem Anteil von fast 93 Prozent das bedeutendste
Herkunftsland, gefolgt von Dänemark mit 6,2 Prozent und Polen mit
0,38 Prozent. Außerdem importierte die NRW-Wirtschaft über
3 500 Tonnen Knollen, Kronen und Rhizome (z. B. Ingwer) im Wachstum
oder in der Blüte im Wert von 15,5 Millionen Euro. Damit war die
Importmenge ähnlich zum Vorjahr. Auch hier waren die Niederlande mit
fast 99,0 Prozent (3 477 Tonnen) das wichtigste Herkunftsland.
Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Februar
2025: +0,3 % zum Vormonat
Auftragsbestand im
Verarbeitenden Gewerbe, Februar 2025
+0,3 % real zum Vormonat
(kalender- und saisonbereinigt)
+1,3 % real zum Vorjahresmonat
(kalenderbereinigt)
Reichweite des Auftragsbestands
7,7
Monate'
Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im
Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Ergebnissen des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Februar 2025 gegenüber
Januar 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,3 % gestiegen. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2024 stieg der Auftragsbestand
kalenderbereinigt um 1,3 %.
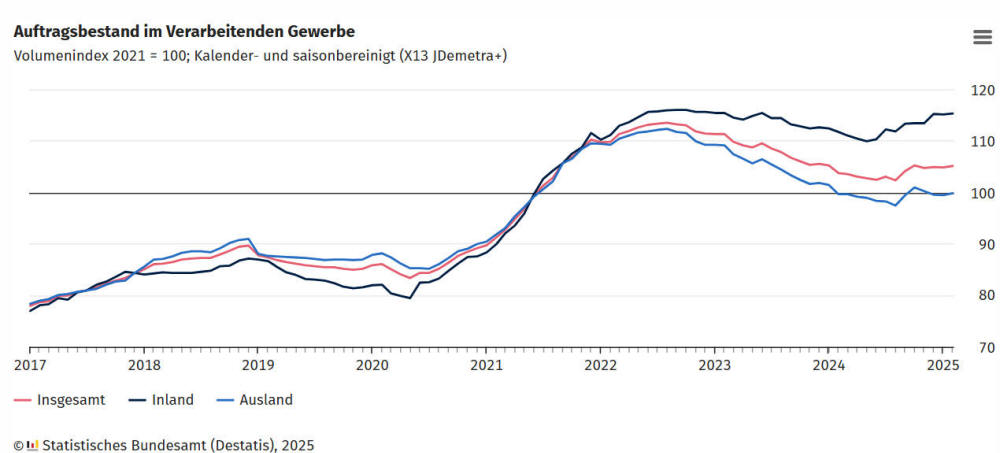
Die leicht positive Entwicklung des
Auftragsbestands im Februar 2025 ist auf Anstiege in der
Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt +0,8 % zum
Vormonat) und im Maschinenbau (+0,4 %) zurückzuführen. Negativ
beeinflusste das Gesamtergebnis der Rückgang in der Metallerzeugung
und -bearbeitung (-1,1 %).
Die offenen Aufträge aus dem
Inland stiegen im Februar 2025 gegenüber Januar 2025 um 0,2 %, der
Bestand an Aufträgen aus dem Ausland erhöhte sich um 0,4 %. Bei den
Herstellern von Vorleistungsgütern sank der Auftragsbestand um 0,1 %
und im Bereich der Konsumgüter um 0,3 %.
Bei den Herstellern
von Investitionsgütern nahm der Auftragsbestand um 0,5 % zu.
Reichweite des Auftragsbestands auf 7,7 Monate gestiegen Im Februar
2025 stieg die Reichweite des Auftragsbestands im Vormonatsvergleich
auf 7,7 Monate (Januar 2025: 7,6 Monate).
Bei den
Herstellern von Investitionsgütern stieg die Reichweite auf
10,5 Monate (Januar 2025: 10,3 Monate), bei den Herstellern von
Konsumgütern stieg die Reichweite auf 3,7 Monate (Januar 2025: 3,6)
und bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb die Reichweite
unverändert bei 4,3 Monaten.
Die Reichweite gibt an, wie
viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue
Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um die vorhandenen
Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem
Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im
betreffenden Wirtschaftszweig berechnet.