






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 17. Kalenderwoche:
24. April
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Freitag, 25. April 2025
Stadtteilbibliothek Neumühl zieht um und erweitert
Öffnungszeiten
Die Stadtteilbibliothek Neumühl erhält
ein neues Zuhause. Aktuell werden gegenüber vom bisherigen Standort
moderne, großzügige Räumlichkeiten auf der Lehrerstraße 4-6 in
Duisburg-Neumühl renoviert. Der letzte Öffnungstag vor dem Umzug in
die neuen Räumlichkeiten ist am Donnerstag, 15. Mai.
Bis zur
Wiedereröffnung bleibt die Bibliothek dann geschlossen. Alle
Leihfristen werden automatisch angepasst.
Die Bibliothek
öffnet am Dienstag, 1. Juli, dort ihre Türen – mit einem völlig
neuen Konzept: Als Open Library wird sie künftig täglich von 7 bis
22 Uhr für Besucherinnen und Besucher mit gültigem
Bibliotheksausweis zugänglich sein. Dabei wird es selbstverständlich
weiterhin Servicezeiten geben, in denen das Team der Bibliothek für
eine persönliche Beratung vor Ort ist.
Mit dem Umzug und der
Umstellung auf die Open Library erwartet die Besucherinnen und
Besucher nicht nur ein moderner Ort zum Lesen, Lernen und Verweilen,
sondern auch deutlich mehr Flexibilität bei der Nutzung – dank
großzügig erweiterter Öffnungszeiten und einem zeitgemäßen
Zugangskonzept. Bis dahin können Kundinnen und Kunden auf die
Bezirksbibliothek Hamborn und natürlich auf alle weiteren Standorte
der Bibliothek ausweichen.
Der Medienbotenservice bringt
Bücher und anderes auf Wunsch auch gerne nach Hause. Fragen
beantwortet das Team der Bibliothek bis zur Schließung gerne
persönlich oder telefonisch unter (0203) 586399.
Die
Öffnungszeiten am bisherigen Standort sind dienstags von 14 bis 18
Uhr, mittwochs und donnerstags von 10.30 bis 13 Uhr sowie von 14 bis
18 Uhr. Alle Informationen rund um die Bibliothek finden sich auch
auf www.stadtbibliothek-duisburg.de.
Lernnächte in der
Zentralbibliothek
Viele Schülerinnen und Schüler nutzen
die Zentralbibliothek an der Steinschen Gasse 26 intensiv als
Lernort. Vor allem während der Abiturvorbereitung sind die dortigen
Arbeitsplätze beliebt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, bietet
die Bibliothek an zwei Terminen im Frühjahr Lernnächte an.
An Freitag, 25. April, und Freitag, 9. Mai, stehen die Türen der
Zentralbibliothek allen Oberstufenschülerinnen und -schülern, die
sich intensiv auf Prüfungen vorbereiten oder konzentriert arbeiten
möchten, jeweils bis 22 Uhr offen. Die Teilnehmenden erwarten
großzügige Lernräume, ideal für Einzel- oder Gruppenarbeit, und
fachliche Unterstützung durch Expertinnen und Experten in einzelnen
Fächern.
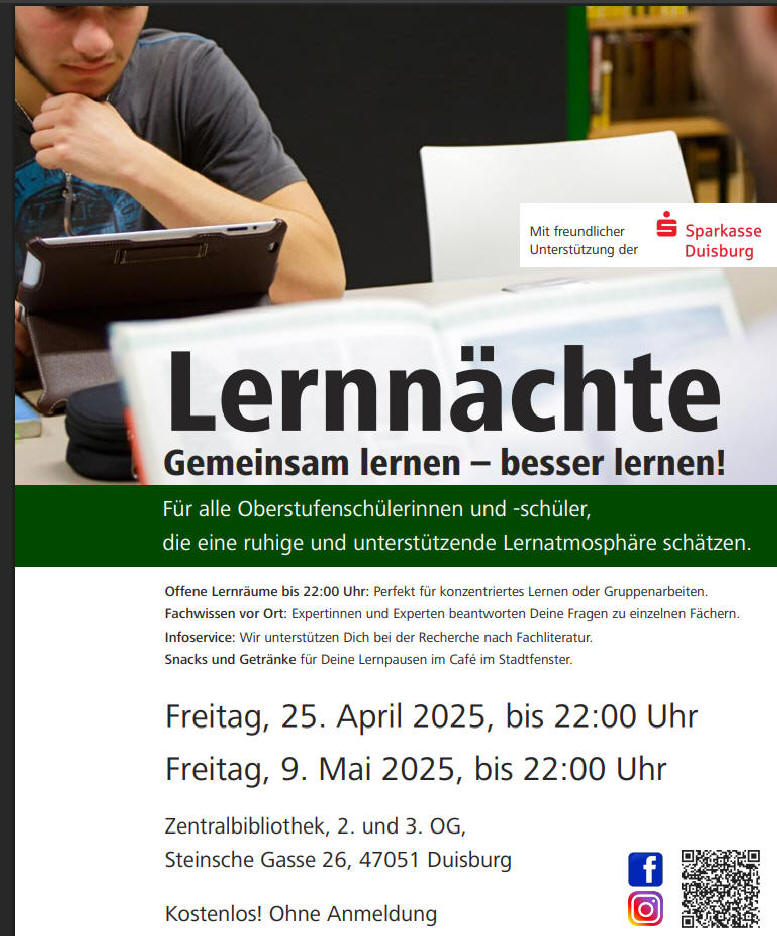
Der Infoservice der Bibliothek unterstützt bei der Recherche
nach Fachliteratur. Für Rückfragen und weitere Informationen steht
das Team der Zentralbibliothek gerne persönlich oder telefonisch
unter 0203 2034218 zur Verfügung. Die Servicezeiten sind montags von
13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, samstags
von 11 bis 16 Uhr.
Spieleabend
in der Rheinhauser Bibliothek
Die Rheinhauser
Bibliothek in der Händelstraße 6 verwandelt sich am Freitag, 25.
April, ab 19 Uhr wieder in einen Treffpunkt für alle, die Freude an
Gesellschaftsspielen haben – egal ob jung oder alt. An zahlreichen
Spieltischen können Besucherinnen und Besucher verschiedene Brett-
und Kartenspiele ausprobieren und sich miteinander messen.
Im Vordergrund steht jedoch das gemeinsame Spielerlebnis in
familiärer Atmosphäre. Wer allein kommt, findet erfahrungsgemäß
schnell Anschluss bei den zahlreichen Stammspielerinnen und
-spielern. Für kleine Snacks und Getränke ist gesorgt. Wer möchte,
kann gerne etwas dazu beisteuern. Der Eintritt ist frei; eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Ruhrgebietsstädte
und IGA 2027 profitieren vom NRW-Städtebauförderprogramm
Vom aktuellen Städtebauförderprogramm der NRW-Landesregierung
profitieren zwei Ruhrgebietsstädte am meisten: Mit 15 Millionen Euro
erhält Gelsenkirchen den größten Zuschuss im Vergleich zu allen
Städten und Gemeinden in NRW. Unterstützt wird das
Sonderfördergebiet "Zukunftspartnerschaft Gelsenkirchen" zur
Beseitigung von Wohnungsüberhängen und Problemimmobilien.
Recklinghausen folgt mit rund 14,7 Millionen Euro für die
Herstellung und Befüllung des "Heidesees", die Herstellung der
Freianlagen auf dem Gelände der ehemaligen Trabrennbahn und die
Umgestaltung des Schulhofs der Grundschule Hillerheide. Neben
Gelsenkirchen und Recklinghausen profitiert auch die Internationale
Gartenausstellung IGA 2027 im Ruhrgebiet.
Fünf IGA-Projekte
erhalten rund 12,9 Millionen Euro aus der Städtebauförderung.
Insgesamt erhalten Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Datteln,
Dortmund, Duisburg, Essen, Haltern am See, Hamm,
Hattingen, Herne, Kamp-Lintfort, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen,
Werne und Witten Mittel aus dem NRW-Städtebauförderprogramm.
Gefördert werden in diesem Jahr 133 Projekte mit rund 302
Millionen Euro. An der Finanzierung der ausgewählten Projekte des
Städtebauförderprogramms 2025 werden sich nach aktueller Planung die
Landesregierung mit rund 150,3 Millionen Euro und der Bund mit rund
149,2 Millionen Euro beteiligen. idr
Wissenschaftsforum diskutiert Wege zu nachhaltiger Mobilität
Wie sich wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele
auf dem Weg zu nachhaltiger Mobilität in Einklang bringen lassen,
diskutieren rund 400 Experten beim Wissenschaftsforum Mobilität am
15. Mai im Duisburger CityPalais. Auf dem Programm stehen zwei
prominent besetzte Podiumsdiskussionen und mehr als 60 Fachvorträge.
Mit seinem breiten Themenspektrum – von modernen
Antriebstechnologien über Mobilitätskonzepte für Stadt und Land bis
hin zu digitalen Services, Wettbewerbsstrategien und KI-gestützten
Lösungen – will das Forum nicht nur den wissenschaftlichen Austausch
fördern, sondern auch praxisnahe Impulse setzen. Organsiert wird die
Veranstaltung von der Universität Duisburg-Essen. idr
Infos:
https://www.wifo-mobilitaet.de
Wasserstoff-Initiative
"TransHyDE 2.0"
Mit dem Ziel, die europäische
Wasserstoff-Infrastruktur voranzubringen, startet am 6. Mai die
Initiative "TransHyDE 2.0" in Berlin. Zu den bundesweit zwölf
Partnern gehören aus dem Ruhrgebiet die Fraunhofer-Einrichtung für
Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG in Bochum, das Gas-
und Wärme-Institut Essen, die Mabanaft GmbH & Co. KG in Duisburg
sowie das Duisburger ZBT - Zentrum für BrennstoffzellenTechnik.
Das Vorhaben ist die Fortsetzung und Erweiterung des Nationalen
Wasserstoff-Leitprojekts "TransHyDE". Jetzt ist die Industrie
eingeladen, ihren weiteren konkreten Entwicklungsbedarf einzubringen
und Umsetzungsprojekte koordiniert auf den Weg zu bringen. Die
Initiative versteht sich als Nukleus neuer
Wasserstoff-Infrastrukturen, Beratungsplattform für Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft sowie als Vermittler zwischen Industrie
und Forschung. idr - Infos:
https://www.transhyde-2-0.de
KI im Alltag
älterer Menschen: 16 neue KI-Lernorte bringen älteren Menschen
Künstliche Intelligenz
Sprachassistenten, automatisierte
Übersetzungen, Chatbots oder smarte Roboter für den Haushalt – viele
Technologien, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basieren, finden
zunehmend Eingang in den Alltag. Doch was genau ist eigentlich KI?
Und wie lässt sie sich sinnvoll im Alter nutzen? Seite Mitte April
bieten 16 neue KI-Lernorte älteren Menschen die Möglichkeit, sich
mit Künstlicher Intelligenz vertraut zu machen und KI-Anwendungen
selbst auszuprobieren.
Die Lernorte werden über das Projekt
„KI für ein gutes Altern“ der BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen durch das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. Damit gibt es
inzwischen deutschlandweit 58 KI-Lernorte für ältere Menschen. Hinzu
kommen 10 bundes- und landesweit aktive Seniorenorganisationen, die
sich seit 2024 am Projekt beteiligen.
Die neuen Angebote sind
bei Seniorenbüros, Mehrgenerationenhäusern, Bildungsstätten und
anderen Einrichtungen der Seniorenarbeit angesiedelt. Sie vermitteln
älteren Menschen einen praktischen Zugang zu Künstlicher Intelligenz
und schaffen Gelegenheiten zum Austausch über deren Nutzen, aber
auch über Grenzen. Die Lernorte werden jeweils mit Technik im Wert
von 2.500 Euro ausgestattet – darunter Sprachassistenten, smarte
Haushaltsgeräte, sogenannte Wearables oder Programme wie ChatGPT.
Zusätzlich werden ehrenamtliche Technikhelferinnen und -helfer
qualifiziert, um die Lernangebote zu begleiten.
Bundesseniorenministerin Lisa Paus sagte: „Künstliche Intelligenz
entwickelt sich rasant in vielen Bereichen unseres Lebens. Umso
wichtiger ist es, dass Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch
Ältere, souverän mit der KI umzugehen lernen. KI kann vieles
erleichtern. Die Lernorte leisten dazu einen wertvollen Beitrag: Sie
ermöglichen es, die Chancen und Herausforderungen von KI in der
Praxis kennenzulernen, Fragen zu stellen und eigene Erfahrungswerte
zu sammeln. So fördert das Bundesseniorenministerium mit dem Projekt
‚KI für ein gutes Altern‘ nicht nur digitale Teilhabe, sondern auch
den selbstbestimmten Umgang mit neuen Technologien.“
Dr.
Regina Görner, Vorstandsvorsitzende der BAGSO, begrüßte die neuen
Standorte: „Damit ältere Menschen von den Möglichkeiten der
Künstlichen Intelligenz profitieren können, brauchen sie Orte, an
denen sie Technik nicht nur erklärt bekommen, sondern selbst
erproben können. Zugleich wird deutlich: Ältere wollen und sollen
Teil dieser Entwicklung sein – nicht nur als Nutzerinnen und Nutzer,
sondern auch als Mitgestaltende. Die Lernorte fördern den Dialog und
regen dazu an, sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von KI
auseinanderzusetzen. Es ist wichtig, dass ältere Menschen ihre
Erfahrungen einbringen und gehört werden.“
2025 beteiligen
sich folgende Organisationen und lokale Initiativen für ältere
Menschen:
Ev. Familienbildungsstätte-Mehrgenerationenhaus
Werra-Meißner
FrauenComputerZentrumBerlin e.V. (FCZB)
Polizeisportverein Rostock e.V.
vhs SüdOst im Landkreis München
GmbH
Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung & Mehrgenerationenhaus
Kreuztal
Karbener Computer Club SeCuZ e.V.
Zentrum 60plus
Heckstraße, DRK-Kreisverband Essen e. V.
60+ SMART iNS iNTERNET
Landau
Christliche Erwachsenenbildung e.V. Merzig
Wertewandel
e.V.
Diakonie Hochfranken Erwachsenenhilfe gGmbH
Hohenkirchen
mit dem "Digital-Café"
Förderverein "Krumme Weide" Ortwig e.V.
Mehrgenerationenhaus der Diakonie MSE
AWO KV Leipzig-Stadt e.V.,
Seniorenbüro West
Groß Wittensee: Digitalstammtische im Amt
Hüttener Berg
Vor 13 Jahren in der BZ: Umbauarbeiten im Carstanjens Garten gehen dem Ende entgegen

Neue Wege

Große Grünfläche mit...

Neupflanzungen

Neue Spiel-

und
Sitzmöglichkeiten

Auf der
Carstanjenspark-Südeite (Carstanjen war eine in Neudorf
ansässige Pappenfabrik) deshalb auch die Pappenstraße im
Neudorfer Norden) ist der Haupteingang des neuen
Kaufmännischen Berufskollegs Mitte, das mittels Public
Private Partnership (PPP) 2009 als Projekt „Neues
Berufskolleg Mitte“ der Stadt Duisburg unter der
Federführung des damaligen Oberbürgermeisters Adolf
Sauerland ab 5. Oktober 2009 auf der Expo Real mit der Firma
GOLDBECK angestoßen wurde.
Es wurde mit rund 55.000
Quadratmeter Fläche zur Bildungsstätte des
Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg (zuvor in der Nähe des
Landfermann Gymnasiumns und des Finanzamtes Süd
angesiedelt), das Kaufmännische Berufskolleg Duisburg-Mitte
(stand dort, wo hueee das neue Permiun Inn Hotel steht) und
Heimat für das Weiterbildungskollegs mit mehr als 3000
Schüler. Das Gbeäude vefügt über eien Aula, eine
Mensa, sowie eine 4Feld-Sporthalle mit integrierter
Besuchertribüne. Auf zwei Tiefgaragenebenen gibt es 450
Stellplätze. Fotos Harald Jeschke
Vor 10 Jahren in der BZ: Bebauungsplan zum Schutz
des gemischten Wohnquartiers
Das Quartier
„Juliusstraße“ zwischen Julius-Weber-Straße, Bungertstraße
und Heerstraße ist ein gemischtes Quartier aus Wohn- und
gewerblichen Nutzungen. Im angrenzenden Straßenzug haben
sich Vergnügungsstätten, Bordelle, bordellartige Betriebe
(z. B. Sauna- oder FKK-Clubs) und Sexshops angesiedelt.
Um eine weitere Ausdehnung des Vergnügungsviertels
Vulkanstraße zu verhindern und den Charakter im Bereich
Juliusstraße zu erhalten, wurde jetzt auf Wunsch vieler
Anwohner hier ein Bebauungsplanverfahren auf den Weg
gebracht, das zum Ziel hat, die städtebauliche Situation
zu erhalten und die vorhandene Wohnnutzung zu sichern und
zu schützen.
Eine weitere Ansiedlung von
Vergnügungsstätten, Bordellen, bordellartigen Betrieben
und Erotikfachgeschäften soll so, entsprechend des
gesamtstädtischen Konzeptes zur Steuerung von
Vergnügungsstätten, ausgeschlossen werden. „Mit diesem
Bebauungsplan schützen und erhalten wir ein intaktes
Mischgebiet mit vorrangiger Wohnnutzung vor einer weiteren
Ausdehnung des Vergnügungsviertels und sichern das
Wohnquartier für die Bewohner“, kommentiert Carsten Tum
den Aufstellungsbeschluss zum B-Plan 1215 Hochfeld –
„Juliusstraße“. Der Rat wird in seiner Sitzung am 27.
April über den Aufstellungsbeschluss entscheiden.
„Gospels and more“
Offenes Chorprojekt in Großenbaum
Annette Erdmann
(Foto: Rolf Schotsch), Kantorin der Evangelischen
Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd weiß , welche positiven
Auswirkungen aktives Singen auf das menschliche Wohlbefinden hat.
Davon berichten ihr Chormitglieder und sie kennt es aus eigener
Erfahrung: „Singen heißt Energie tanken, Stress abbauen und die
Seele befreien“. Und: „Gerade in der aktuellen Zeit tut es gut,
gemeinsam von Hoffnung zu singen.“

Alle, die Freude am Singen haben, sind herzlich eingeladen, beim
Gospelprojekt der Kantorei mitzuwirken. Kraftvolle, mitreißende
Gospels und auch gefühlvolle Balladen stehen auf dem Programm,
darunter auch der bekannte Song „You raise me up“. Geprobt wird
jeweils mittwochs von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr: am 7. und 14. Mai im
Gemeindehaus, Lauenburger Allee 21 oder nach Absprache in der
Versöhnungskirche, Lauenburger Allee 23.
Wer mitmachen
möchte, kann sich bis zum 4. Mai bei Kantorin Annette Erdmann
anmelden (per E-Mail an annette.erdmann@ekir.de oder telefonisch
0203 / 76 77 09). Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.evgds.de.
Meidericher
Gemeinde lädt zur Kirchenkneipe ein
An einem der vier
Freitage jeden Monats öffnet im Gemeindezentrum der Evangelischen
Kirchengemeinde Duisburg Meiderich, Auf dem Damm 8, die
Kirchenkneipe.
So auch am 25. April 2025, wo Besucherinnen und
Besucher nach dem 19-Uhr-Wochenabschlussandacht ab 19.30 Uhr wieder
gute Getränke, leckere Kleinigkeiten und eine gemütliche Atmosphäre
erwarten können, die zum Wohlfühlen einlädt und Platz für nette
Gespräche lässt. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter 0203-4519622.
Pfarrer Müller am nächsten Freitag in der Duisburger
Kircheneintrittsstelle
Immer freitags können Unsichere,
Kirchennahe oder solche, die es werden möchten, in der
Eintrittsstelle in der Salvatorkirche mit Pfarrerinnen, Pfarrern und
Prädikanten ins Gespräch kommen und über die Kirchenaufnahme reden.
Motive für den Kircheneintritt gibt es viele: Die Suche nach
Gemeinschaft, Ordnung ins Leben bringen oder der Wunsch, Taufen,
Hochzeiten, Bestattungen kirchlich zu gestalten. Aufnahmegespräche
führt das Präsenzteam in der Eintrittsstelle an der Salvatorkirche
immer freitags von 14 bis 17 Uhr.

BZ-Foto baje
Am Freitag, 25. April
2025 heißt Pfarrer i.R. Ekkehard Müller Menschen in der Südkapelle
des Gotteshauses neben dem Rathaus herzlich willkommen. Infos zur
Citykirche gibt es unter www.salvatorkirche.de
Die Citykirche kennenlernen - Kostenfreie
Führung durch Salvator
Die Salvatorkirche am
Burgplatz gehört zu Duisburgs bekanntesten und
imponierendsten Gotteshäusern. An jedem ersten Sonntag im
Monat informieren geschulte Gemeindeleute, meist
Ehrenamtliche, über die Geschichte, den Baustil und die
besonderen Fenster der über 700 Jahre alten Stadtkirche
neben dem Rathaus.

Salvator-Fenster - BZ-Foto Manfred Schneider
Am
Sonntag, 4. Mai 2025 um 15 Uhr macht Margret Stohldreier
mit Interessierten an verschiedensten Stellen der Kirche
halt und berichtet dazu Wissenswertes und Kurzweiliges.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig, alle Kirchenführungen
in der Salvatorkirche sind kostenfrei. Infos zum
Gotteshaus gibt es unter
www.salvatorkirche.de

Ein Großteil der importierten Seltenen Erden kamen 2024
aus China
• Deutschland hat mengenmäßig 13 % weniger
Seltene Erden importiert als 2023
• Die EU-Staaten importieren
46 % aller Seltenen Erden aus China
Seltene Erden sind
wichtige Rohstoffe für die Herstellung vieler
Hochtechnologieprodukte wie Akkus, Halbleiter oder Magnete für
Elektro- Motoren. Der Abbau der 17 darunter gefassten Elemente
erfolgt allerdings kaum in Deutschland und der Europäischen Union
(EU) – umso größer ist die Abhängigkeit vom Import.
Deutschland hat im Jahr 2024 weniger Seltene Erden importiert als im
Jahr zuvor: Die eingeführte Menge der begehrten Metalle ging von 5
900 Tonnen (Wert: 66,0 Millionen Euro) im Jahr 2023 auf 5 200 Tonnen
(Wert: 64,7 Millionen Euro) im Jahr 2024 zurück, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit sank die
Importmenge um 12,6 %.
Den mengenmäßigen Höchststand der
vergangenen zehn Jahre hatten die Importe 2018 mit 9 700 Tonnen
(Wert: 38,3 Millionen Euro) erreicht. Im Jahr 2024 kam 65,5 % der
importierten Menge direkt aus China (3 400 Tonnen). Der Anteil ging
damit leicht zurück: 2023 waren noch 69,1 % der importierten Menge
aus China gekommen.
Zweitwichtigstes Herkunftsland war 2024
Österreich mit einem mengenmäßigen Anteil an den Importen von 23,2 %
(1 200 Tonnen). Darauf folgte Estland mit 5,6 % (300 Tonnen). In
diesen beiden Ländern werden Seltene Erden weiterverarbeitet, die
ursprüngliche Herkunft ist statistisch nicht nachweisbar.
Einige der wichtigen Rohstoffe kommen vollständig aus China
Bei
einigen der Seltenen Erden hat China als Herkunftsstaat einen
besonders hohen Anteil. So kamen nach Deutschland importierte
Lanthanverbindungen 2024 zu 76,3 % aus China. Diese Verbindungen,
die unter anderem für die Herstellung von Akkus genutzt werden,
machten gut drei Viertel der gesamten Importmenge Seltener Erden
aus.
Neodym, Praseodym und Samarium, die unter anderem für
Dauermagneten in Elektro-Motoren verwendet werden, wurden nahezu
vollständig aus China importiert. Die EU importiert 46 % der
Seltenen Erden aus China Wie Deutschland importiert auch
die EU Seltene Erden zu einem großen Teil aus China.
Im Jahr
2024 wurden nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat
insgesamt 12 900 Tonnen an Seltenen Erden im Wert von
101 Millionen Euro in die EU Importiert. 46,3 % (6 000 Tonnen)
dieser Importe entfielen auf China. Der zweitwichtigste Partner ist
Russland mit einem Anteil von 28,4 % (3 700 Tonnen), gefolgt von
Malaysia mit 19,9 % (2 600 Tonnen).
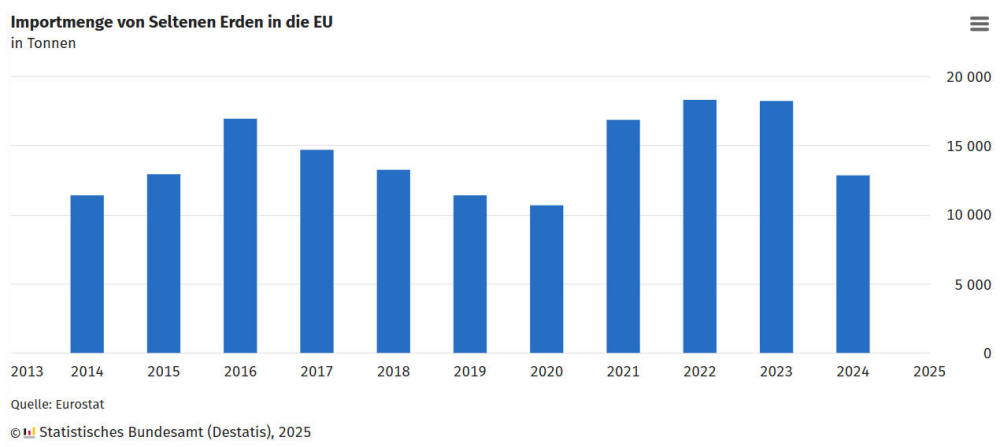
Die EU hat einige Rohstoffe zuletzt als strategisch
wichtig eingestuft. Dazu zählen aufgrund ihrer Verwendung in
Magneten die Seltenen Erden Neodym, Praseodym, Terbium, Dysprosium,
Gadolinium, Samarium und Cer. Aufgrund der strategischen Bedeutung
sollen bis 2030 maximal 65 % des Bedarfs daran durch den Import aus
einem jeweiligen Staat gedeckt werden.
Dazu sollen unter
anderem die Eigenproduktion und das Recycling der Rohstoffe in
der EU gestärkt sowie die Bezugsquellen diversifiziert werden. Bei
einzelnen Seltenen Erden liegt der Anteil Chinas an den Importen in
die EU allerdings noch deutlich höher.
So kamen 14,2 Tonnen
von insgesamt 14,4 Tonnen importiertem Neodym, Praseodym und
Samarium 2024 aus China: das entsprach 97,7 %. Darüber hinaus wurden
72,1 Tonnen und damit 99,3 % der Importmenge an Cer und Lanthan aus
China eingeführt.
Absatzwert der
NRW-Industrieproduktion 2024 um über fünf Prozent gesunken
Im Jahr 2024 sind in den 9 876 produzierenden Betrieben des
Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von
Steinen und Erden zum Absatz bestimmte Waren im Wert von
317 Milliarden Euro hergestellt worden. Wie das Statistische
Landesamt mitteilt, war der NRW-Absatzwert damit nominal um
17,2 Milliarden Euro bzw. 5,1 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.
Gegenüber dem Jahr 2019 stieg der Absatzwert nominal um
23,0 Milliarden Euro bzw. 7,8 Prozent und gegenüber 2014 um
28,0 Milliarden Euro (+9,7 Prozent). Alle Topbranchen in NRW mit
rückläufigen Absatzwerten Innerhalb der 29 Güterabteilungen war 2024
der Bereich „Maschinen” mit einem nominalen Absatzwert von
43,3 Milliarden Euro (−6,7 Prozent gegenüber 2023) die wertmäßig
größte Güterabteilung in NRW.
Es folgten die Herstellung von
„Chemischen Erzeugnissen&rdqupo; (40,5 Milliarden Euro;
−1,0 Prozent), „Nahrungs- und Futtermittel” (39,1 Milliarden Euro;
−2,2 Prozent) und „Metalle” (38,4 Milliarden Euro; −7,6 Prozent).
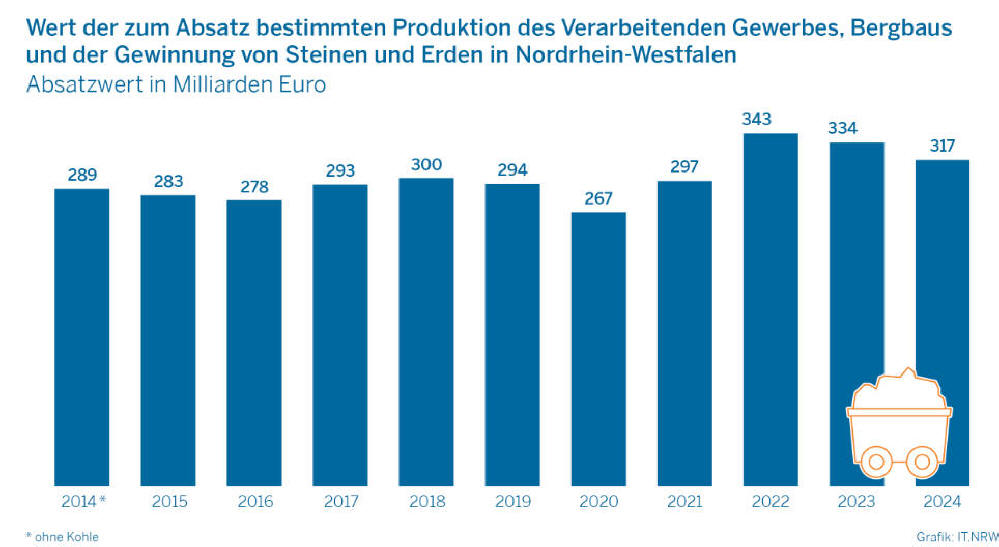
Der Absatzwert von „Metallerzeugnissen” lag bei 30,2 Milliarden
Euro (−7,3 Prozent) und der von „Kraftwagen und Kraftwagenteilen”
bei 17,4 Milliarden Euro (−7,2 Prozent). Höchster Absatzwert im
Kreis Gütersloh – niedrigster in der kreisfreien Stadt Bonn Die
Verteilung der Industrieproduktion war 2024 in den kreisfreien
Städten und Kreisen unterschiedlich.
Den höchsten Anteil am
NRW-Absatzwert ermittelte das Statistische Landesamt mit 5,9 Prozent
für die Betriebe im Kreis Gütersloh; 18,7 Milliarden Euro wurden
dort erzielt. Es folgten die Betriebe im Märkischen Kreis
(4,3 Prozent; 13,8 Milliarden Euro) und in der kreisfreien Stadt
Köln (4,2 Prozent; 13,2 Milliarden Euro). Die geringsten Anteile
erzielten mit jeweils 0,3 Prozent die Betriebe in den kreisfreien
Städten Herne (1,1 Milliarden Euro), Bottrop (1,0 Milliarden Euro)
und Bonn (0,8 Milliarden Euro).