






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 18. Kalenderwoche:
30. April
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 1. Mai 2025
Feierliche Vereidigung von 90 Lehramtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärtern im Duisburger Rathaus
Oberbürgermeister Sören Link hieß am Mittwoch, 30. April, rund 90
neue Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter bei ihrer
feierlichen Vereidigung im Ratssaal des Duisburger Rathauses
herzlich willkommen. Im Anschluss wurden die neuen Lehrkräfte durch
Angela Cornelissen, Leiterin des Zentrums für schulpraktische
Lehrerausbildung Duisburg, vereidigt.

Vereidigung der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter im Duisburger
Ratssal durch v.l.: Bildungsdezernentin Astrid Neese,
Oberbürgermeister Sören Link und Angela Cornelissen, Leiterin der
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
„Lehrkraft zu sein heißt, Verantwortung zu übernehmen, Werte zu
vermitteln und Zukunft mitzugestalten. Für diesen wichtigen Dienst
an unseren Schulen und mit unseren Kindern wünsche ich Ihnen alles
erdenklich Gute und viel Erfüllung in ihrem Beruf“, so
Oberbürgermeister Sören Link.
Die Lehramtsanwärter treten am
Montag, 5. Mai, ihren Dienst an Grundschulen in Duisburg und
Umgebung an. Ihre nächsten Schritte führen die Lehramtsanwärterinnen
und Lehramtsanwärter unter anderem an insgesamt 75 Grundschulen im
Duisburger Stadtgebiet. Dort tragen sie dazu bei, den Unterricht von
gut 21.000 Schülerinnen und Schülern mit frischen Ideen und
pädagogischem Engagement zu bereichern.

Vereidigung der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter im Duisburger
Ratssal durch Bildungsdezernentin Astrid Neese, Oberbürgermeister
Sören Link und Angela Cornelissen, Leiterin der Zentren für
schulpraktische Lehrerausbildung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
Kindersprechstunde mit Oberbürgermeister Sören Link
Wie differenziert Kinder das Stadtleben wahrnehmen, hat
Oberbürgermeister Sören Link bei seiner ersten Kindersprechstunde im
vergangenen Jahr erlebt. Dieser Austausch auf Augenhöhe war ein
Gewinn für Duisburg, sodass auch jetzt wieder junge Duisburgerinnen
und Duisburgern im Alter von sechs bis 13 Jahren zu Wort kommen
sollen: Am Dienstag, 27. Mai, erhalten Kinder die nächste
Möglichkeit, ihre Perspektiven einzubringen.

Die letzte Spechstunde im
November 2024 - Fotos Tanja Pickartz / Stadt
Duisburg
„Ich freue mich auf die
jungen Gäste im Rathaus. Bereits in meiner ersten Kindersprechstunde
habe ich gemerkt, dass die Ideen und Meinungen von Kindern uns alle
weiterbringen können“, sagt Oberbürgermeister Sören Link. „Kinder
geben unserer Stadt ein Gesicht und werden unsere Zukunft in
Duisburg maßgeblich gestalten. Deshalb ist mir der direkte Austausch
mit ihnen wichtig.“
Für die Kindersprechstunde am Dienstag,
27. Mai, in der Zeit von 14:30 bis 16:30 Uhr, können Eltern ihre
Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren anmelden: Termine können bis
zum 13. Mai per E-Mail unter kindersprechstunde@stadt-duisburg.de
oder auch telefonisch unter (0203) 283-6111 angefragt werden.
Die Kindersprechstunde wird in einem der Sitzungsräume des
Duisburger Rathauses, Burgplatz 19, ohne Beteiligung der Eltern
stattfinden. Die Kinder haben dann die Möglichkeit,
Oberbürgermeister Sören Link in offener Runde Fragen zu stellen, zu
erzählen, was ihnen gefällt oder nicht gefällt, und können
Vorschläge machen, was in Duisburg noch besser gestaltet werden
kann.
Verbraucherschutz aktuell Newsletter 30. April 2025

Kostenloser Rundgang durch die Duisburger Innenstadt:
„Der 1. Mai 1933 und der Gewerkschaftermord vom 2. Mai“
Das Zentrum für Erinnerungskultur lädt am Tag der Arbeit,
Donnerstag, 1. Mai, um 15 Uhr zu einem rund 90-minütigen
Stadtrundgang mit Harald Küst, Mitglied der Geschichtsinitiative
„Mercators Nachbarn“ durch die Duisburger Innenstadt ein. Treffpunkt
ist vor dem Kultur- und Stadthistorischen Museum am
Johannes-Corputius-Platz im Innenhafen.

Denkmal zur Erinnerung
an die Zerschlagung der Gewerkschaften - Künstlerin Hede Bühl
Der Rundgang beginnt beim Museum und endet auf der Ruhrorter
Straße 11 in Kaßlerfeld, wo das Haus des Deutschen
Metallarbeiter-Verbands stand. Im Fokus des Rundgangs steht
einerseits die NS-propagandistische Inszenierung des „Tags der
nationalen Arbeit“. Und anderseits die brutale Zerschlagung der
Gewerkschaften am Folgetag, die in Duisburg mit einem Vierfachmord
einherging. NS-Funktionäre verhören und foltern dutzende
Gewerkschaftsfunktionäre.
Vier Männer werden mit
Schaufelstielen erschlagen und ihre Leichen im Hünxer Wald
verscharrt. Anschließend streute die Duisburger NSDAP das Gerücht,
die vier Gewerkschaftler hätten sich beim Streit um die
Gewerkschaftskasse gegenseitig umgebracht…
Harald Küst
beleuchtet bei dem Rundgang, wie die Geschichte ausging und welchen
Stellenwert das Ereignis in der Duisburger Erinnerungskultur
einnimmt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Das vollständige Programm ist im Internet abrufbar
unter: www.stadtmuseumduisburg.de
MSV Duisburg – Wuppertaler SV: DVG setzt zusätzliche
Busse ein
Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen
den Wuppertaler SV am Samstag, 3. Mai, um 14 Uhr in der
Schauinsland-Reisen Arena, setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft
AG (DVG) die Sportlinie 945 ein.
Abfahrtszeiten Buslinie 945
Richtung MSV Arena:
ab „Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um
12.06, 12.16, 12.26 Uhr
ab „Bergstraße“ um 12.11, 12.21 und 12.31
Uhr
ab „Meiderich Bahnhof“ ab 12.15 bis 12.40 Uhr alle fünf
Minuten
ab „Großenbaum Bahnhof Ost“ um 12.50 und 13.05 Uhr
ab
„Betriebshof am Unkelstein“ ab 11.58 bis 12.23 Uhr alle fünf Minuten
ab „Hauptbahnhof“ (Verknüpfungshalle) ab 12.15 bis 13.35 Uhr alle
fünf Minuten
ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen) um 12.33 Uhr .

DVG-Foto
Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt bereit.
Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf
erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die
öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für
die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,
ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.
Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es im Internet unter
www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefonhotline unter der Rufnummer
0203 60 44 555 und in der myDVG Bus&Bahn-App.
Anmelden zum STADTRADELN 2025 - 30. August bis
19. September
Der Termin für das STADTRADELN 2025 in
Duisburg steht fest. Vom 30. August bis zum 19. September findet in
diesem Jahr das STADTRADELN in Duisburg statt. Duisburg ist bereits
zum zwölften Mal dabei. Anmeldungen sind ab sofort unter
www.stadtradeln.de/duisburg möglich.
In diesem Jahr wird es
einige Veränderungen geben, um das STADTRADELN in Duisburg
attraktiver zu gestalten. So wird es eine spezielle Wertung für
Schulen geben. Auch für alle anderen Teilnehmenden gibt es
attraktive Preise. Die Chance darauf haben dabei alle Teilnehmenden,
unabhängig von den erradelten Kilometern. Zum Beginn wird es wieder
eine Eröffnungstour geben.
Über die Details zu dieser Tour,
zu weiteren Veranstaltungen im Aktionszeitraum sowie der
Schulwertung wird die Stadt rechtzeitig vor Beginn des STADTRADELNs
informieren Das STADTRADELN ist in Duisburg mittlerweile zu einer
festen Institution geworden und unter den Radfahrerinnen und
Radfahrern bekannt. 2014 ging es mit 491 Radlerinnen und Radlern los
und es wurden ca. 125.000 km erzielt.
Im letzten Jahr waren
es knapp 2.000 aktive Radlerinnen und Radler, die in 140 Teams
antraten und 391.687 km erradelten. Ereignisse wie Starkregen oder
auch Hitzeperioden lassen es für jeden sichtbar werden: Der
Klimawandel ist da und bedroht uns alle.
Ein wichtiger
Beitrag, um die Folgen des Klimawandels abzumildern, ist die
Verkehrswende, bei der das Fahrrad eine wichtige Rolle spielt.
STADTRADELN möchte für dieses emissionsfreie Fahrzeug Fahrrad werben
und Menschen dazu bewegen, das Auto öfter mal stehen zu lassen.
VHS-Vortrag zur Bedeutung der Infrastruktur
Zurzeit wird in der öffentlichen Diskussion häufig die marode
Infrastruktur in Deutschland beklagt. Wie wichtig Straßen,
Eisenbahnlinien oder Datenleitungen für eine Gesellschaft sind. Bodo
Lück beleuchtet in seinem Vortrag am Montag, 12. Mai, um 20 Uhr in
der VHS im Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in der Stadtmitte
die Bedeutung der Infrastruktur.
Das Teilnahmeentgelt
beträgt fünf Euro. Eine vorherige Anmeldung unter
www.vhs-duisburg.de ist erforderlich. Weiterführende Informationen:
Josip Sosic, 0203 283 3725
Dr. Manfred Lütz
referiert übers Glücklichsein
„Wie Sie unvermeidlich
glücklich werden“ – darüber spricht der Kölner Psychiater,
Psychotherapeut, Theologe und Bestsellerautor Dr. Manfred Lütz in
Duisburg: Am Dienstag, 13. Mai, wird er in der Kulturkirche
Liebfrauen referieren. Seine Thesen hat er in seinem Buch „Wie Sie
unvermeidlich glücklich werden“ bereits ausführlich verarbeitet.
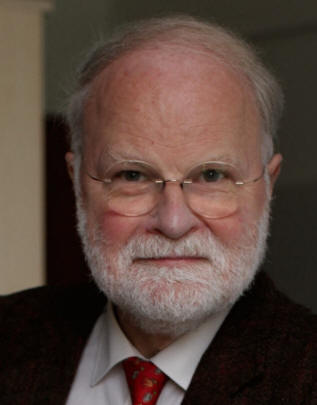
(C) Manfred Lütz
Das Publikum erwartet ein amüsanter, aber
auch nachdenklicher und kabarettistischer Abend. Der Eintritt zu
dieser Veranstaltung der VHS in Zusammenarbeit mit dem
Seniorenbeirat der Stadt Duisburg ist frei, eine vorherige Anmeldung
ist erforderlich:
https://www.vhs-duisburg.de/kurssuche/kurs/Wie-Sie-unvermeidlichgluecklich-werden/251SZ1126
Zukunft gestalten: Deutscher Ingenieurtag 2025 mit
Hendrik Wüst MdL, Yasmin Fahimi und Veronika Grimm im Livestream
Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Gesellschaft diskutieren beim „Deutschen Ingenieurtag“
(DIT) am 15.5.2025 über Innovationen und Strategien zur Stärkung des
Wirtschafts- und Technologiestandorts Deutschland. Ein Highlight des
Tages wird die Vorstellung und Überreichung eines 5-Punkte-Plans
durch VDI-Präsident Prof. Dr.-Ing. Lutz Eckstein an Hendrik Wüst MdL
sein.

Mit dem Plan setzt der VDI konkrete Impulse für die
Zukunftsgestaltung Deutschlands durch eine langfristige Technologie-
und Innovationsstrategie. Der DIT findet in Düsseldorf statt.
Veranstaltungsdetails: Datum: Donnerstag, 15. Mai 2025 Uhrzeit: 10 –
13 Uhr (Livestream)
Position: „Medienverbot?
Alter Reflex mit wenig Zukunft!“
- Klare Position des
JFF gegen ein Verbot von Social Media Angeboten
- Institut für
eine aktive Einbindung von Smartphones und digitaler Netzwerke in
Bildungskontexten
- Schlüssel liegt in frühestmöglicher
Förderung von Medienkompetenz
Das JFF – Institut für
Medienpädagogik spricht sich in einem Positionspapier klar gegen ein
grundsätzliches Verbot von mobilen Endgeräten (v.a. Smartphones) im
Unterricht aus. Darüber hinaus betrachtet es das JFF als
kontraproduktiv, wenn digitale Netzwerke und Plattformen tabuisiert
werden und Heranwachsende von deren Nutzung ausgeschlossen werden
sollen.
Ein solches realitätsfernes Verbot konterkariere
medienpädagogische Bemühungen um größtmögliche Befähigung junger
Menschen für eine kritische Mediennutzung und die Förderung von
medial gestützter Teilhabe an gesellschaftlichen Diskursen.
Im Positionspapier, das das Institut nun veröffentlicht hat, heißt
es dazu u.a.: „… Verbote können Menschen schützen. Ganz zentral
dabei ist, dass geklärt ist, wer wen vor was schützt. Schützen wir
bestimmte Altersgruppen vor Inhalten, die sie möglicherweise
gefährden oder schützen wir sie vor sich selbst, weil wir ihnen das
Recht der (Mit)Gestaltung absprechen?“

Social Media Angebote nicht grundsätzlich für Kinder und Jugendliche
verbieten, sondern sinnvoll in Bildungsprozesse integrieren.
Lern- und Lebensräume gestalten, statt sie zu verbieten
Weiter stellt das JFF fest: „… Ein reflektiertes Zusammenspiel aus
privater und lernorientierter Nutzung (von Online-Medien und
Endgeräten) ist zielführend. Bildungsorte müssen Lern- und
gleichermaßen auch Lebensräume für Kinder und Jugendliche sein und
somit an der Lebenswelt ansetzen.
Verbote sind entsprechend
nicht hilfreich. […] Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gefahren,
ebenso wie das Recht auf Zugang zu Informationen, auf freie
Meinungsäußerung und auf Kultur, Freizeit und Spiel. Verbieten hat
sich bisher im Allgemeinen in sehr wenigen Fällen als gelingende
pädagogische oder erzieherische Strategie erwiesen. Wenn mit
Verboten gearbeitet wird, ist es notwendig, die dahinterliegende
Zielsetzung zu betrachten, ein Verbot pädagogisch zu flankieren,
alternative Angebote zu machen und sich umso mehr mit dem Angebot
und den Nutzungsmotiven auseinanderzusetzen.“
Das JFF sieht
in einem undifferenzierten Verbot von mobilen Endgeräten und
Inhalten auf digitalen Plattformen die Gefahr, dass dadurch die
notwendige Ausbildung von Zukunftskompetenzen bei Kindern und
Jugendlichen auf der Strecke bleibt, die Stärkung von
Selbstbewusstsein leidet und das soziale Lernen mit Medien als
unabdingbare Herausforderung nicht berücksichtigt wird. Das schade
in erheblichem Maße der individuellen Entwicklung der
Heranwachsenden und dem Erleben von Selbstwirksamkeit in einer
mediatisierten Welt.
Sichere Räume und eine starke
Medienpädagogik
Statt die Thematik durch ein Verbot zu
tabuisieren, fordert das JFF die Schaffung sicherer und geschützter
Online-Räume für unterschiedliche Altersgruppen. So werden die
Potenziale von Social Media genutzt und die medialen Lebenswelten
von Kindern und Jugendlichen ernstgenommen. Statt lebensferner
Verbotsdebatten, werden gebraucht:
Stärkung der Fachdisziplin
Medienpädagogik
früh ansetzende Medienbildung
enge Begleitung
aller Eltern und Fachkräften
fundiertes Wissen über
Medienangebote, Risiken und Chancen
Verstetigung innovativer
Ansätze in Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention
klare Verantwortungsübernahme durch Plattformen
lebenslange
Förderung von Medienkompetenz
Zukunft gestalten heißt,
Medienkompetenz stärken
Kathrin Demmler, Direktorin des JFF: „Wir
müssen insbesondere junge Menschen darin bestärken, ihre
Gestaltungsfähigkeiten in und mit Medien zu entwickeln. Es geht
darum, Veränderungen aktiv und konstruktiv zu begegnen, Probleme zu
lösen, flexibel zu handeln und selbstständig zu agieren. Die
Medienpädagogik eröffnet hierfür vielfältige Möglichkeiten. Verbote
laufen dieser pädagogischen Zielsetzung vollkommen entgegen.“
Seit 1949 befasst sich das JFF mit Medien und medialen
Phänomenen, mit Trends und Entwicklungen, mit Chancen und möglichen
Schwierigkeiten aus Sicht von Kindern und Jugendlichen. Die
Ergebnisse der interdisziplinären Arbeit aus Forschung und Praxis
werden für verschiedene Arbeitsfelder aufbereitet und sind Basis für
innovative Projekte und Modelle in der Erziehungs-, Bildungs- und
Kulturarbeit. Ziel all dieser Aktivitäten ist eine breite,
umfassende und nachhaltige Förderung von Medienkompetenz.
Personalknappheit: Oft spielen auch widrige
Arbeitsbedingungen und fehlende Investitionen in Aus- und
Weiterbildung eine Rolle
Dass in vielen Betrieben
Arbeitskräfteknappheit herrscht, hängt auch mit unzureichenden
Löhnen, widrigen Arbeitsbedingungen und fehlenden Investitionen in
Aus- und Weiterbildung zusammen. Ein knappes Fünftel der Unternehmen
mit Personalmangel baut sogar gleichzeitig Stellen ab. Einige
verzichten anscheinend auf die Möglichkeit, über Qualifizierungen
vorhandene Arbeitskräfte fit für neue Aufgaben zu machen.
Betriebs- und Personalräte setzen sich für eine vorausschauende
Personalpolitik zur Fachkräftesicherung ein, ein Teil der Betriebe
steuert mittlerweile um. Das zeigt eine neue Untersuchung des
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der
Hans-Böckler-Stiftung.*
•
Fachkräftemangel ist ein Problem, das Arbeitgeber regelmäßig
beklagen. Wie sich die Situation aus Sicht der Beschäftigten
darstellt, hat WSI-Forscherin Dr. Elke Ahlers untersucht. Dafür hat
sie Daten der WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2023, die sich
auf über 3700 Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten beziehen,
sowie der 13. Welle der WSI-Erwerbspersonenbefragung analysiert, an
der mehr als 7000 Erwerbstätige und Arbeitsuchende Ende 2024
teilgenommen haben.
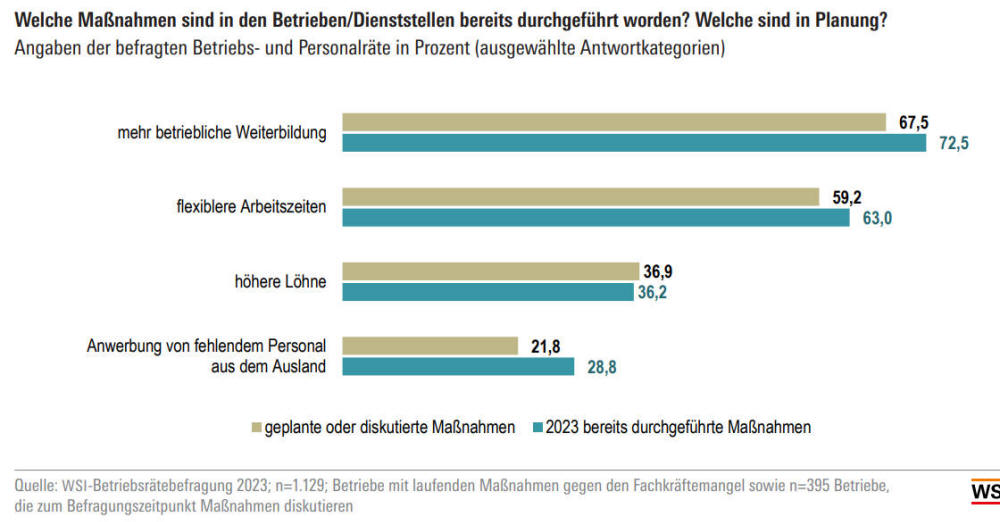
Der Auswertung zufolge sind Personalengpässe tatsächlich ein
weit verbreitetes Phänomen: 92 Prozent der
Arbeitnehmer*innenvertretungen berichten von entsprechenden
Problemen in ihrem Betrieb, 83 Prozent geben an, dass Stellen länger
als drei Monate unbesetzt geblieben sind. Von den befragten
Erwerbspersonen arbeitet die Hälfte in einem Betrieb, der von
Personalknappheit betroffen ist. Als Ursache nennen rund neun
Zehntel der betrieblichen Interessenvertretungen zu wenige
Bewerber*innen auf dem Arbeitsmarkt.
Gleichzeitig halten 53
Prozent der Betriebsräte und 65 Prozent der Personalräte
unattraktive Arbeitskonditionen für ein Problem. Unzureichende Löhne
stellen laut 45 beziehungsweise 47 Prozent ein Hindernis dar.
Ungünstige Arbeitszeiten machen in der Privatwirtschaft 40 Prozent
der Interessenvertretungen verantwortlich, im öffentlichen Dienst 22
Prozent, zu wenig Aus- und Weiterbildung jeweils 36 Prozent.
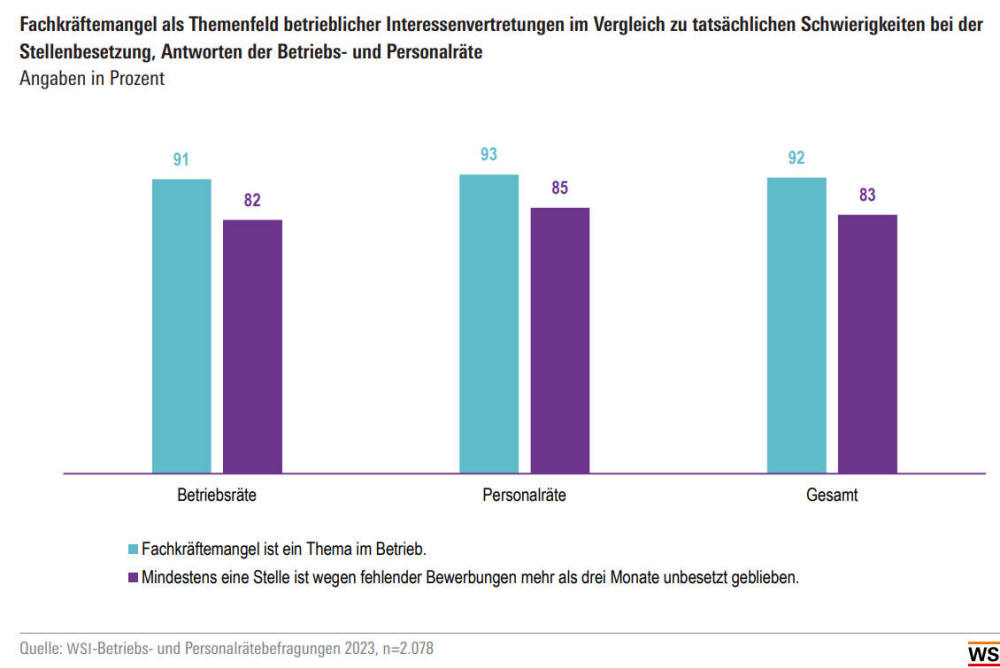
Ein „scheinbares Paradox“ bestehe darin, dass es teilweise parallel
zu Entlassungen und Personalengpässen kommt, schreibt Ahlers. 18
Prozent der Betriebe, bei denen Stellen seit über drei Monaten
vakant sind, bauen nach Angaben der Betriebs- und Personalräte
andererseits Personal ab. Offenbar nutzen einige Arbeitgeber nicht
die Möglichkeit, mit vorhandenen Arbeitskräften auf veränderte
Anforderungen zu reagieren, beispielsweise durch Umschulungen.
„Solche Befunde legen nahe, dass ein Teil der Arbeitgeber zwar über
Arbeitskräftemangel klagt, aber noch nicht verstanden hat, dass
Investition in die Beschäftigten ein wichtiger Lösungsansatz ist“,
sagt dazu Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin
des WSI.
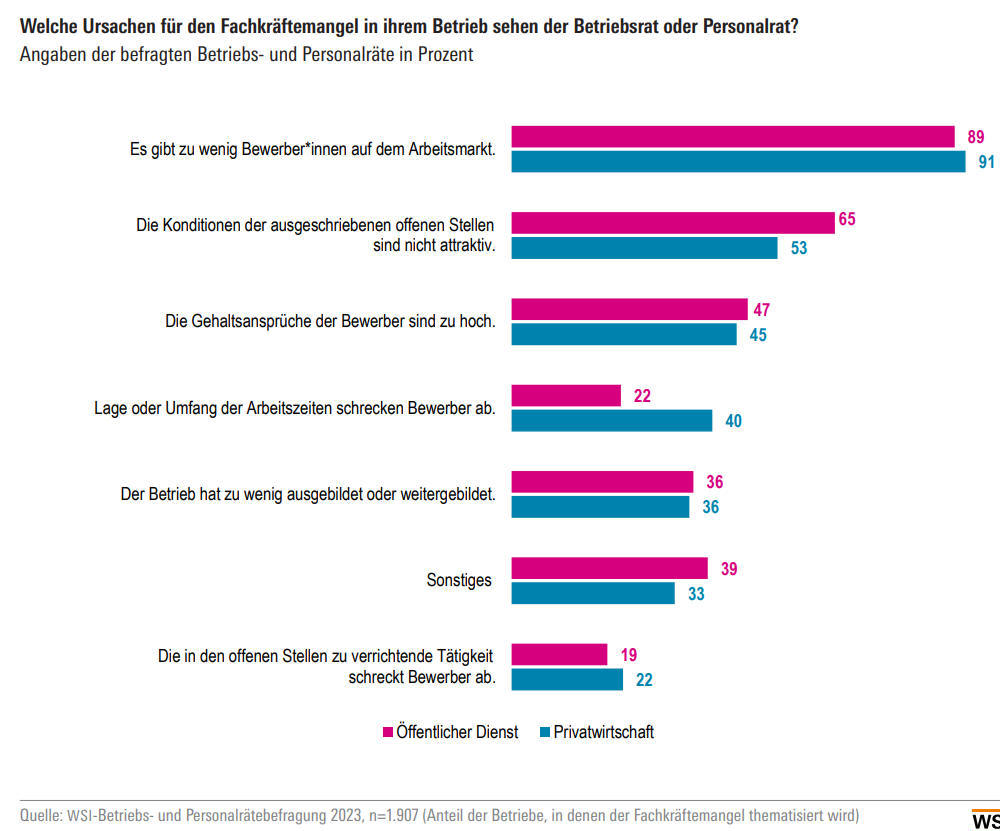
•
Teufelskreis aus Personalmangel und schlechteren
Arbeitsbedingungen droht
Personalengpässe wirken sich der
Studienautorin Elke Ahlers zufolge sowohl betriebswirtschaftlich als
auch auf die Arbeitsbedingungen aus. 93 Prozent der befragten
Interessenvertretungen nennen als eine Konsequenz, dass Beschäftigte
mehr arbeiten müssen. Nach Angabe von 60 Prozent der Betriebsräte
und 67 Prozent der Personalräte können betriebliche Pläne nicht
umgesetzt, laut 26 beziehungsweise 47 Prozent Aufträge nicht erfüllt
werden.
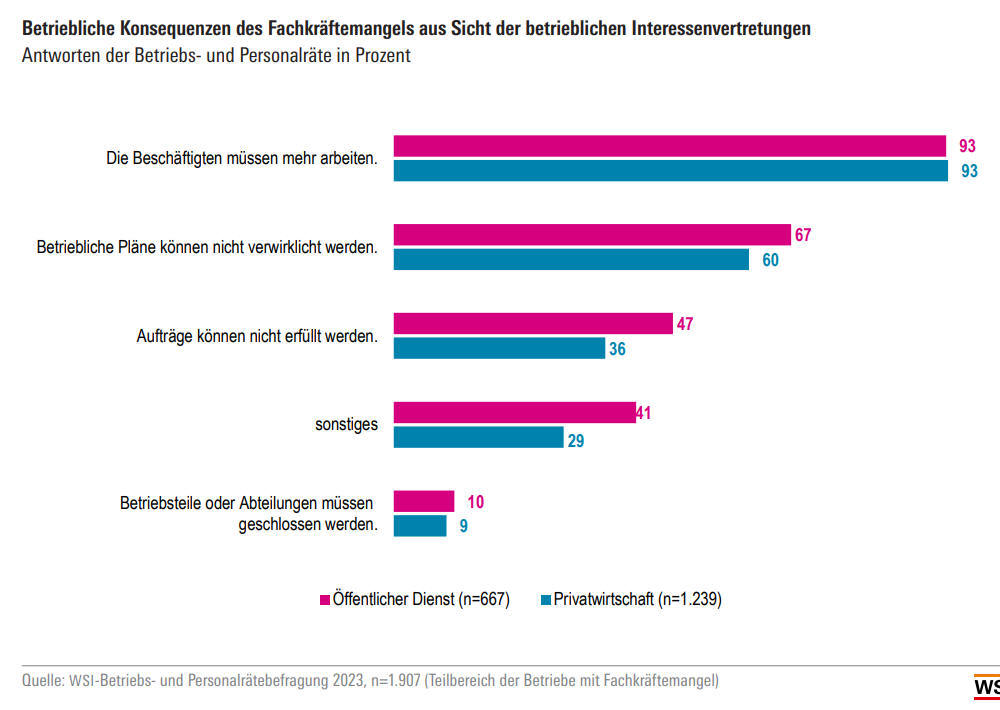
Von den betroffenen Erwerbspersonen stimmen 37 Prozent der
Aussage voll und ganz zu, dass Mehrarbeit und Arbeitsintensität
durch den Personalmangel zunehmen. 27 Prozent bestätigen, dass die
Qualität der Arbeitsergebnisse leidet, 25 Prozent, dass die
Fehlzeiten zunehmen, 23 Prozent, dass das Betriebsklima sich
verschlechtert. Damit drohe ein Teufelskreis, heißt es in der
Studie: Zunehmender Arbeitsdruck erhöht Unzufriedenheit, Ausfälle
und Fluktuation und verschärft so die Personalnot.
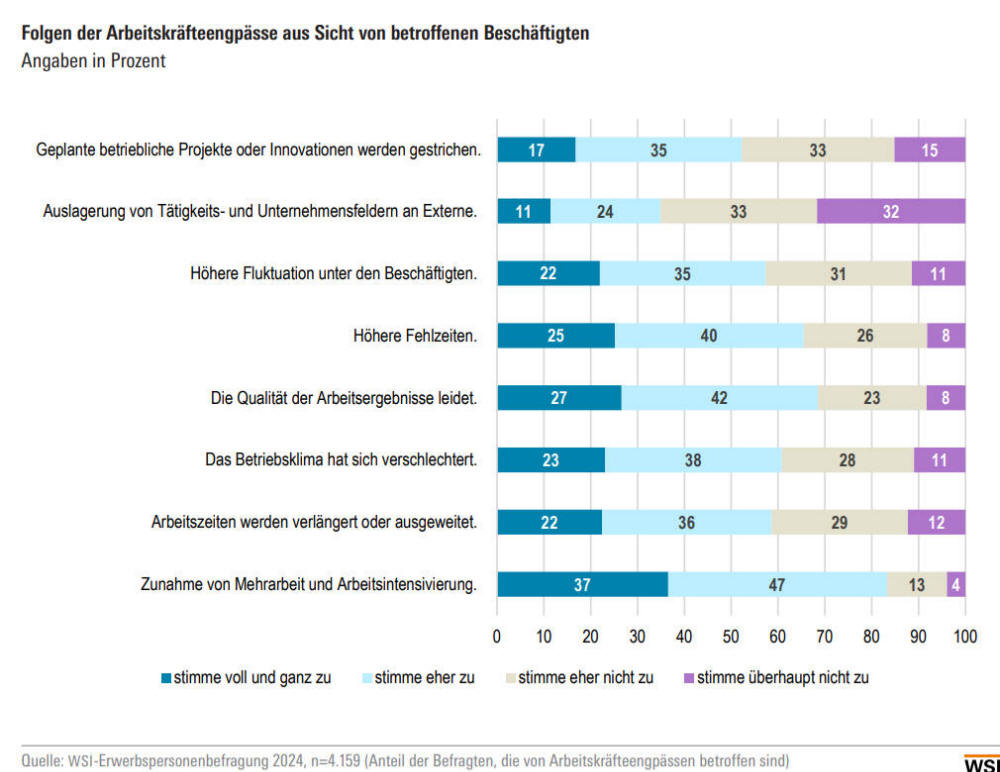
•
Mittlerweile werden etliche Gegenmaßnahmen erprobt: 30
Prozent aller Betriebe gehen laut den Arbeitnehmer*innenvertretungen
gezielt gegen den Fachkräftemangel vor, weitere 11 Prozent planen
das. Von den Betrieben, die aktiv werden, bieten 73 Prozent mehr
Weiterbildung an, 59 Prozent mehr Ausbildungsplätze, 70 Prozent
Homeoffice, 63 Prozent flexible Arbeitszeiten. Mit höheren Löhnen
versuchen es 36 Prozent, 29 Prozent senken die Anforderungen an
Bewerber*innen. Personal aus anderen Regionen werben 58 Prozent an,
aus dem Ausland 29 Prozent.
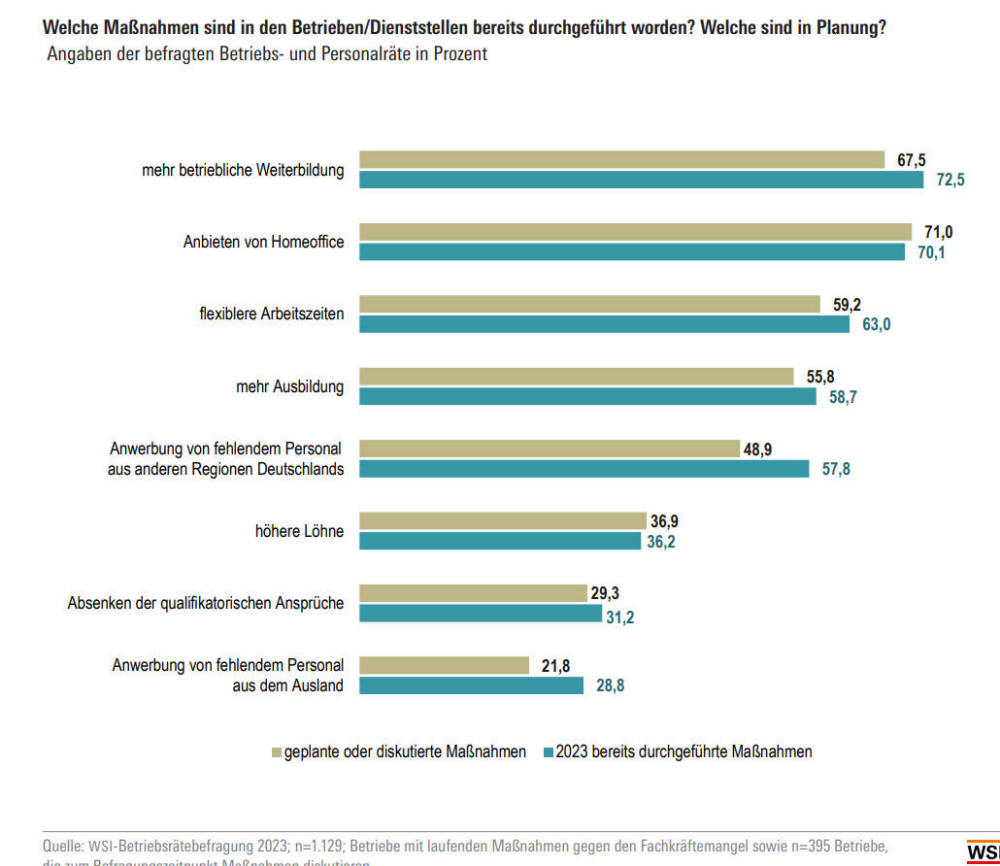
„Personalengpässe und Fachkräftesicherung sind für die
betrieblichen Interessenvertretungen zentrale Themen“, so Ahlers. Um
das Problem in den Griff zu bekommen, sei eine vorausschauende
Personalpolitik nötig, die auch auf Aus- und Weiterbildung setzt.
Gleichzeitig bedürfe es attraktiver Arbeitsbedingungen. Bessere
Kinderbetreuungsangebote wären geeignet, mehr Frauen eine
Berufstätigkeit zu ermöglichen. Darüber hinaus könnten passfähigere
Arbeitszeiten und ein partizipatives Gesundheitsmanagement zur
Linderung des Fachkräftemangels beitragen.
Großer Neumühl-Tag am 1. Mai - mit Vereins- und
Bürgerbaum und Ökumenischen Open-Air-Gottesdienst auf dem Marktplatz
Wenn am 1. Mai, in diesem Jahr ein Donnerstag, in Neumühl der
Vereins- und Bürgerbaum aufgestellt wird, gibt es seit einigen
Jahren stets zu Beginn um 11 Uhr einen Ökumenischen Gottesdienst,
der bei gutem Wetter von mehreren hundert Menschen auf dem
Hohenzollernplatz besucht wird. Der Neumühler Markt ist dann eine
große „Open-Air-Kirche“.

"Wie in den Jahren zuvor gibt es auch diesmal am 1. Mai wieder einen
Ökumenischen Open-Air-Gottesdienst auf dem Neumühler Markt, dem
Hohenzollernplatz. Ehrenamtliche Teams aus der Evangelischen
Kirchengemeinde und der Katholischen Gemeinde Herz-Jesu haben auch
diesen intensiv vorbereitet." (Foto: Kurt Niedermeier)
Seit
2004 stellen die Neumühler unter der Regie der Aktionsgemeinschaft
Neumühler Kaufleute (AGNK) jedes Jahr am 1. Mai ihren stets
imposanten Vereins- und Bürgerbaum am Marktplatz auf. Ein Jahr
zuvor, an Christi Himmelfahrt 2003, gab es zum 650. Geburtstag des
Stadtteils einen großen Ökumenischen Gottesdienst auf dem
Marktplatz.
Und daran wurde 2014 auf Anregung der AGNK wieder
angeknüpft. Der vor über zehn Jahren mit über 600 Teilnehmern
bestens besuchte Gottesdienst unter freiem Himmel mit dem
Leitgedanken „Ein Leib – Viele Glieder, Ein Baum – Viele Schilder,
Ein Stadtteil – Viele Nationen“ war ein mitnehmender Einstieg in den
Neumühl-Tag und setzte Zeichen für ein friedliches Miteinander in
Respekt, Achtung, Toleranz und Nächstenliebe.
Seitdem ist der
Open-Air-Gottesdienst auf dem Marktplatz Tradition. Auch in diesem
Jahr beginnt er wieder um 11 Uhr und bietet reichlich Gelegenheit
zum Innenhalten, Denken, Nachdenken, Beten und Singen. Unter der
Leitung des evangelischen Pfarrers Sören Asmus und der katholischen
Pastoralen Mitarbeiterin Schwester Ursula Preusser mit musikalischer
Begleitung von Christian Woiczinski aus der Neumühler
Herz-Jesu-Gemeinde geht es los mit dem Lied „Danke für diesen guten
Morgen“.
Und genau den wünscht sich das Gottesdienst-Team
aus der katholischen Kirchengemeinde Herz-Jesu und der evangelischen
Kirchengemeinde Neumühl. Jedes Mal gab es bisher ein Leitthema und
etwas ganz Besonderes. Diesmal stehen Heimat, Glaube, Arbeit,
Geschichte und vor allen die Gemeinschaft und das Miteinander in
Neumühl im Vordergrund. So lautet das diesjährige Motto auch
„Gemeinsam sind wir stark".
Es gibt Texte, Gebete, Fürbitten
und viele mit- und einnehmende Lieder wie etwa „Gott gab uns Atem“,
„Meine Hoffnung, meine Freude“ oder „Vertraut den neuen Wegen“. Die
beim Gottesdienst gesammelte Kollekte ist für Ferien- und
Freizeitangebote der Seniorenarbeit der in beiden Gemeinden
bestimmt.
Nach dem Gottesdienst geht es dann weiter mit dem
Familientag der Neumühler Vereine, Institutionen, Schulen,
Organisationen, Parteien und natürlich der Bürgerinnen und Bürger
geworden. Auch diesmal wird es wieder eine kleine Völkerwanderung
zum Neumühler Markt, dem Hohenzollernplatz, geben.
Beim
Aufstellen des Vereins- und Bürgerbaums sind wie in den Jahren viele
engagierte Menschen mit im Boot, die sich nicht nur präsentieren und
informieren, sondern auch in betont vielfältiger Art und Weise für
den richtigen Zusammenhalt von Leib und Seele sorgen. Es gibt kaum
einen Verein, der nicht mit von der Partie ist. Deren Angebote an
Getränken und Leckereien sind riesig.
Die Schirmherrschaft
hat in diesem Jahr Gabi Pletziger inne. Die Präsidentin der KG
Rot-Weiß Schmidthorst ist ein Neumühler „Vorzeige-Aktivposten“ und
hat als frühere Schützenkönigin und Bürgerin des Jahres Zeichen des
Zusammenhalts gesetzt.
Im Rahmen der Gesamtveranstaltung werden
zudem traditionell die beliebten Neumühler Vereinsmeisterschaften
ausgetragen, moderiert von Andrea Scharf-Drüke und Inge Hanßen.
Jetzt hoffen die Neumühler auf gutes Wetter. Reiner Terhorst

Früheres, wie immer gut besuchtes 1.-Mai-Fest am Neumühler Markt
(Foto: Reiner Terhorst)

Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2025 um 0,2 % höher
als im Vorquartal
Deutsche Wirtschaft startet mit
leichtem Zuwachs ins Jahr 2025
0,2 % zum Vorquartal (preis-,
saison- und kalenderbereinigt)
-0,4 % zum Vorjahresquartal
(preisbereinigt)
-0,2 % zum Vorjahresquartal (preis- und
kalenderbereinigt)
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 1.
Quartal 2025 gegenüber dem 4. Quartal 2024 – preis-, saison- und
kalenderbereinigt – um 0,2 % gestiegen, nachdem es zum Jahresende
2024 zurückgegangen war (-0,2 % im 4. Quartal 2024 zum 3. Quartal
2024). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,
waren sowohl die privaten Konsumausgaben als auch die Investitionen
höher als im Vorquartal.
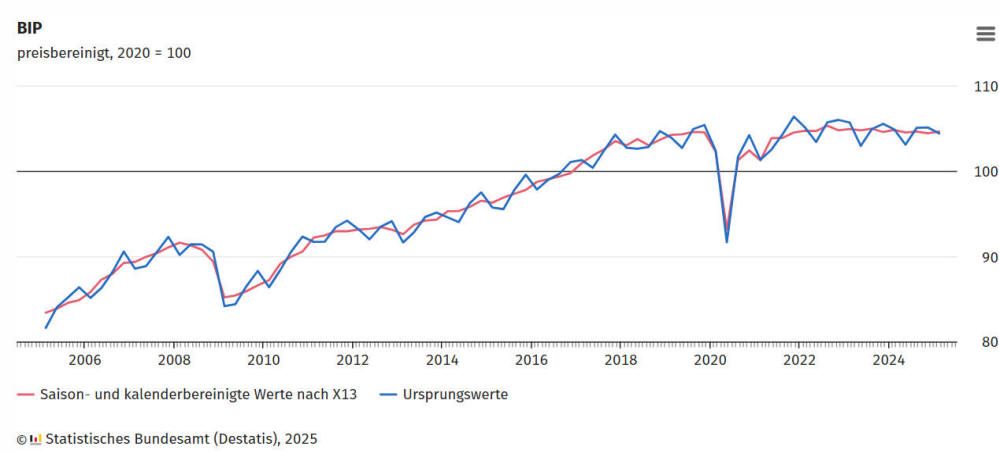
Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich gesunken
Im
Vorjahresvergleich war das BIP im 1. Quartal 2025 preisbereinigt um
0,4 % niedriger als im 1. Quartal 2024. Preis- und kalenderbereinigt
war das BIP um 0,2 % niedriger als im Vorjahresquartal.
Revision der bisherigen Ergebnisse
Neben der Berechnung des
1. Quartals 2025 hat das Statistische Bundesamt wie üblich auch die
bisher veröffentlichten Ergebnisse des Vorjahres überarbeitet und
neu verfügbare statistische Informationen in die Berechnungen der
Ergebnisse einbezogen. Dabei ergaben sich für das vierteljährliche
preisbereinigte BIP keine Änderungen der bisherigen Ergebnisse.
NRW: Rekordtief bei Stromeinspeisung mit Kohle
Im Jahr 2024 sind in Nordrhein-Westfalen 87 663 Gigawattstunden
Strom erzeugt und in das Netz zur allgemeinen Versorgung eingespeist
worden. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt anhand der Monatserhebung über die Stromein-
und -ausspeisung bei Netzbetreibern mitteilt, wurde 46,9 Prozent des
Stroms (41 114 GWh) aus dem Energieträger Kohle gewonnen.
Der Anteil reduzierte sich im Vergleich zu 2018 (damals:
69,6 Prozent) um 22,7 Prozentpunkte und erreichte ein neues
Rekordtief. Die Stromeinspeisung in NRW wies im Jahr 2024 den
niedrigsten Wert im Zeitvergleich seit 2018 auf. So wurden im
vergangenen Jahr 7,6 Prozent weniger Strom als 2023 (damals:
94 826 GWh) bzw. 36,5 Prozent weniger Strom als 2018 (damals:
137 974 GWh) in das nordrhein-westfälische Stromnetz eingespeist.

Mehr als ein Viertel des eingespeisten Stroms stammte aus
erneuerbaren Energieträgern 23 495 Gigawattstunden (26,8 Prozent)
des eingespeisten Stroms in 2024 sind auf erneuerbare Energieträger
zurückzuführen. Der Großteil des Stroms aus erneuerbaren
Energieträgern stammte aus Windkraft (53,9 Prozent); gefolgt von
Photovoltaik (24,5 Prozent) und Biogas (10,8 Prozent).
Staatsquote 2024 auf 49,5 % angestiegen
•
Staatsquote damit 2,2 Prozentpunkte über dem langjährigen
Durchschnitt seit 1991
• EU-Durchschnitt im Jahr 2024 bei 49,2 %
Höhere Staatsausgaben haben im Jahr 2024 zu einem Anstieg
der Staatsquote auf 49,5 % geführt. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, verzeichnete die Staatsquote damit gegenüber
dem Vorjahr einen Zuwachs von 1,1 Prozentpunkten (2023: 48,4 %). Der
aktuelle Anstieg ist vor allem auf deutlich gestiegene monetäre
Sozialleistungen, etwa für Renten, Pflege- oder Bürgergeld, sowie
auf höhere soziale Sachleistungen wie für Klinikbehandlungen oder
Pflege zurückzuführen.
Damit lag der Wert des Jahres 2024 um
2,2 Prozentpunkte über dem langjährigen Durchschnitt der Jahre 1991
bis 2024, der 47,3 % beträgt. Die Staatsquote gibt das Verhältnis
der Staatsausgaben zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) wieder.