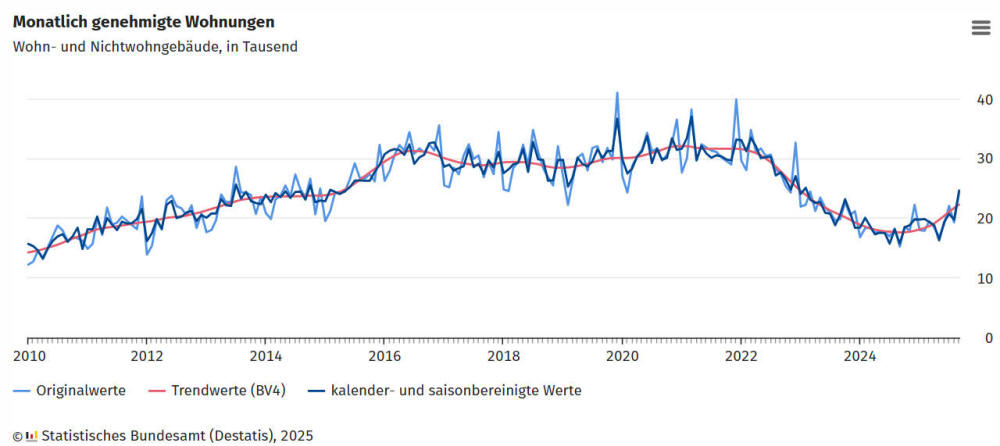|
NATO-Generalsekretär besucht
Berlin
|
|
Berlin 11. Dezember 2025 - Am 11. Dezember
2025 besuchte NATO-Generalsekretär Mark Rutte Berlin zu
Gesprächen mit Bundeskanzler Friedrich Merz und
Bundesaußenminister Johann Wadephul. In einer gemeinsamen
Pressekonferenz mit der deutschen Bundeskanzlerin dankte der
Generalsekretär Herrn Merz für Deutschlands Beiträge zur NATO
und seine beständige Unterstützung der Ukraine.

Mark Rutte fuhr fort: „Deutschland geht mit gutem Beispiel
voran und sendet ein wichtiges Signal. Ein Signal, dass
Europa bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen (…), dass
Lastenteilung nicht nur ein Slogan, sondern eine konkrete
Verpflichtung ist. Und ein Signal an jeden Gegner, dass die
NATO stark, geeint und voll fähig ist, unser Territorium zu
verteidigen.“
Später am Tag hielt der Generalsekretär
im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede ,
in der er betonte: „Die Verteidigungsausgaben und die
Produktion der Alliierten müssen rasch steigen, unsere
Streitkräfte müssen über die notwendige Ausrüstung verfügen,
um unsere Sicherheit zu gewährleisten, und die Ukraine muss
die nötige Ausrüstung erhalten, um sich selbst zu
verteidigen.“ Er hob hervor: „Es ist Zeit zu handeln.“
|
|
Einfaches Bauen nach dem
Gebäudetyp E: BMJV und BMWSB starten Stakeholderprozess
|
|
Berlin, 10.
Dezember 2025 - Das Bauen von Wohnungen in Deutschland soll
künftig günstiger und schneller möglich sein. Dazu soll das
einfache Bauen – Bauen nach dem sogenannten Gebäudetyp E –
erleichtert werden. Heute startet ein gemeinsamer
Stakeholderprozess des Bundesministeriums der Justiz und für
Verbraucherschutz und des Bundesministeriums für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen zum Gebäudetyp E. Die jüngst
vorgelegten Eckpunkte zum Gebäudetyp E sollen in dem Prozess
mit den Stakeholdern gemeinsam weiterentwickelt werden.
„Gebäudetyp E“ steht für einfaches, bedarfsgerechtes
Bauen. Beim Gebäudetyp E wird auf die Einhaltung
kostspieliger Baustandards verzichtet, die gesetzlich nicht
zwingend sind. Diese können beispielsweise die Konstruktion
und Technik betreffen, aber auch die Ausstattung einer
Wohnung (etwa nutzerorientierte und wartungsarme Haustechnik,
langlebige Materialien). Bauen nach dem Gebäudetyp E ist
sowohl beim Neubau als auch bei Umbau- und
Modernisierungsmaßnahmen möglich.
Ein konkreter
Gebäudetyp mit spezifizierten baulichen Eigenschaften ist
nicht gemeint. Wesentliche Abstriche bei der Wohnqualität
sind mit dem Gebäudetyp E nicht verbunden. Das
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und
das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen haben am 20. November 2025 gemeinsame Eckpunkte zum
Gebäudetyp E vorgelegt. Diese sehen vor, dass es zukünftig
für Vertragsparteien einfach und rechtssicher möglich sein
soll, einen Gebäudetyp E zu vereinbaren.
Zugleich
soll der Gebäudetyp E in der Praxis etabliert werden. Die
heutige Auftaktveranstaltung eröffnet den Stakeholderprozess
zu den Eckpunkten. Bei der Auftaktveranstaltung werden die
Eckpunkte den Stakeholdern im Einzelnen vorgestellt und das
weitere Verfahren zum Beteiligungsprozess erläutert. Es gibt
zudem die Gelegenheit für erste Stellungnahmen der
Stakeholder zu den Eckpunkten.
Zu dem
Stakeholderprozess sind verschiedene Interessengruppen und
Institutionen eingeladen, insbesondere die Bau- und
Planungspraxis, Verbraucher- und Mieterschutzverbände, die
Bundesländer sowie die Justiz. In den kommenden Monaten soll
gemeinsam mit den Stakeholdern konkretisiert werden, wie die
zivilrechtlichen Regelungen des Gebäudetyp-E-Vertrags
aussehen können.
Außerdem sollen gemeinsam
Einzelmaßnahmen erarbeitet werden, um den Gebäudetyp E in der
Praxis zu etablieren. Das Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz und das Bundesministerium für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen werden hierzu jeweils
fachlich-thematische Untergruppen einsetzen. In diesen
Untergruppen soll ein intensiver Austausch auf der Grundlage
der Eckpunkte stattfinden.
Die Ergebnisse des
Stakeholderprozesses werden anschließend die Grundlage dafür
sein, praxistaugliche gesetzliche Regelungen zum
Gebäudetyp-E-Vertrag zu erarbeiten. Der Stakeholderprozess
zum Gebäudetyp E soll bis zum Frühjahr 2026 abgeschlossen
werden. Direkt im Anschluss soll ein Gesetzentwurf erarbeitet
werden. Das Eckpunktepapier zum Gebäudetyp E einschließlich
ergänzender Beispiele für die Planung und Bauausführung
finden Sie
hier.
|
|
Schutz vor Einschüchterungsklagen:
Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf zur Umsetzung von
EU-Richtlinie
|
|
Berlin, 10.
Dezember 2025 - erichte sollen bessere Möglichkeiten
erhalten, mit sogenannten Einschüchterungsklagen umzugehen.
Einen entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin
Dr. Stefanie Hubig hat das Kabinett heute beschlossen. Unter
Einschüchterungsklagen werden unbegründete Klagen verstanden,
die darauf abzielen, missliebige Beiträge zur öffentlichen
Meinungsbildung zu unterdrücken.
Sie richten sich zum
Beispiel gegen Journalistinnen und Journalisten,
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder
Nichtregierungsorganisationen. Auf Englisch werden sie auch
als SLAPP bezeichnet („Strategic Lawsuits Against Public
Participation“). Der heute beschlossene Gesetzentwurf geht
zurück auf die Anti-SLAPP-Richtlinie der EU, die damit ins
deutsche Recht umgesetzt werden soll.
Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr.
Stefanie Hubig erklärt dazu: „Es gibt keine Demokratie ohne
freie Presse, ohne kontroverse öffentliche Debatte, ohne
Menschen, die den Mund aufmachen und sich engagieren. Deshalb
dürfen wir es nicht zulassen, dass kritische Stimmen mundtot
gemacht werden – durch Einschüchterung oder gar Bedrohung.
Einschüchterungsklagen sind in manchen europäischen
Ländern in den letzten Jahren zu einem echten Problem
geworden. Die EU hat darauf reagiert und Regeln erlassen, mit
denen Gerichte solche Klagen besser verhindern können. Diese
Vorgaben setzen wir ins deutsche Recht um. Das deutsche
Zivilprozessrecht ist schon heute gut aufgestellt, um solchen
missbräuchlichen Klagen zu begegnen. Mit den neuen Regeln
erhalten die Gerichte weitere Instrumente an die Hand, um
Klagemissbrauch einzudämmen.“
Der Gesetzentwurf setzt
die Vorgaben der EU-Richtlinie nach dem 1:1-Prinzip um. Nach
dem Entwurf sollen die neuen Regelungen deshalb allein auf
Einschüchterungsklagen mit grenzüberschreitendem Bezug
Anwendung finden. Für Sachverhalte ohne grenzüberschreitenden
Bezug sollen sich keine Änderungen ergeben.
Von einer
Einschüchterungsklage ist nach dem Gesetzentwurf unter
folgenden Voraussetzungen auszugehen:
(1) der Hauptzweck
des Rechtsstreits besteht darin, die Beteiligung des
Beklagten am öffentlichen Meinungsprozess zu verhindern,
einzuschränken oder zu sanktionieren; (2) und der fragliche
Rechtsstreit wird unter Berücksichtigung aller Umstände
missbräuchlich geführt. Eine Beteiligung am öffentlichen
Meinungsbildungsprozess ist zum Beispiel die Teilnahme an
einer Demonstration, die Veröffentlichung eines Artikels in
einer Zeitung, ein Post in den sozialen Netzwerken oder die
Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Studie.
Für
Einschüchterungslagen im vorstehenden Sinne (mit
grenzüber-schreitendem Bezug) sollen dann die folgenden
Regelungen gelten: Vorrang- und Beschleunigungsgebot Es soll
ein Vorrang- und Beschleunigungsgebot für die Verhandlung und
Entscheidung gelten. So soll gewährleistet, dass
missbräuchliche Klagen im frühestmöglichen Zeitpunkt
abgewiesen werden können, ohne den gerichtlichen
Prüfungsmaßstab einzuschränken.
Verpflichtung der
Klägerseite zur Leistung von Prozesskostensicherheit Auf
Antrag der Beklagtenseite und Anordnung des Gerichts soll die
Klägerseite verpflichtet werden können, für die
voraussichtlichen Prozesskosten einschließlich der Kosten der
Rechtsverteidigung der Beklagtenseite Sicherheit zu leisten.
Erweitere Kostenerstattung Rechtsanwaltskosten der
obsiegenden Beklagtenseite sollen künftig auch über die
gesetzlichen Gebührensätze hinaus erstattungsfähig sein, es
sei denn, diese Kosten sind überhöht.
Möglichkeit zu
Festsetzung Sanktionsgebühr
In der Kostenentscheidung
soll das Gericht der Klägerin oder dem Kläger als Sanktion
eine besondere Gerichtsgebühr auferlegen können. Diese darf
maximal doppelt so hoch sein wie der allgemeine Gebührensatz
des Verfahrens. Veröffentlichungspflicht von Urteilen Für
rechtskräftige Urteile von Gerichten in zweiter und dritter
Instanz soll eine Veröffentlichung verpflichtend werden. Die
Veröffentlichung soll elektronisch und leicht zugänglich
sowie anonymisiert oder pseudonymisiert erfolgen.
Den
Regierungsentwurf sowie weitere Informationen sind
hier ab
rufbar.
|
|
Modernisierung,
Entbürokratisierung und Digitalisierung im Recht der Schiffe:
Kabinett beschließt Gesetzentwurf
|
|
Berlin, 10.
Dezember 2025 - Das Flaggenrecht, das Schiffsregisterrecht
und das Seefischereirecht sollen modernisiert,
entbürokratisiert und an die Digitalisierung angepasst
werden. Damit soll auch die Registrierung von Schiffen unter
deutscher Flagge attraktiver gemacht werden.
Das
sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett heute auf
den gemeinsamen Vorschlag des Bundesministeriums für Verkehr,
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
und des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und
Heimat beschlossen hat.
Flaggenrecht
Mit dem
heute beschlossenen Gesetz soll das Flaggenrecht modernisiert
werden. Hierzu werden Zuständigkeiten klarer geregelt,
Regelungen verständlicher gefasst, Regelungslücken
geschlossen, veraltete und nicht mehr relevante Regelungen
aufgehoben und Bürokratie abgebaut. Einige der Regelungen
dienen zudem der Stärkung der deutschen Flagge.
Schiffsregister Auch das Schiffsregisterrecht soll
modernisiert werden.
Der Gesetzentwurf der
Bundesregierung knüpft dabei an eine Gesetzesinitiative des
Bundesrates an. Er ermächtigt die Länder, ihre
Schiffsregister für jedermann auch online einsehbar zu
machen. Das soll den Rechtsverkehr mit Schiffen erleichtern
und trägt zur Digitalisierung bei.
Seeschiffe, die
die deutsche Flagge führen, müssen in das Schiffsregister
eingetragen werden. Nur wenn ein Schiff im Schiffsregister
steht, kann eine Schiffshypothek eingetragen werden. Die bei
den Amtsgerichten geführten Schiffsregister erfüllen also
eine wichtige Funktion – ähnlich wie das Grundbuch für
Grundstücke. Anders als das Grundbuch ist das Schiffsregister
aber seit jeher öffentlich und kann von jeder und jedem ohne
Angabe von Gründen eingesehen werden.
Die Einsicht
ist bislang nicht online möglich. Daher sollen die Länder
ermächtigt werden, künftig für jedermann auch eine digitale
Einsicht in die bei den Amtsgerichten geführten
Schiffsregister zuzulassen. Seefischerei Schließlich sollen
Änderungen im Seefischereigesetz vorgenommen werden. Sie
betreffen zum einen Fanglizenzinhaber ohne Wohnsitz oder Sitz
im Inland. Zum anderen soll die Regelung über die nationale
Verstoßdatei ergänzt werden, um Einklang mit Unionsrecht
herzustellen. Den Regierungsentwurf finden Sie
hier.
|
|
Absolute Mehrheit für Rentenpaket 2025 -
318-Ja-Stimmen |
|
Berlin, 5. Dezember 2025 - Der Deutsche
Bundestag hat das Rentenpaket 2025 mit absoluter Mehrheit
beschlossen. Es enthält zentrale rentenpolitische Vorhaben
des Koalitionsvertrages der Bundesregierung. „Der erste
Schritt in die richtige Richtung ist gemacht”, so
Bundeskanzler Merz.
„Das ist nicht das Ende unserer
Rentenpolitik, sondern erst der Anfang”, so Bundeskanzler
Friedrich Merz nach der Abstimmung im Deutschen Bundestag zum
Rentenpaket 2025. Ein erster Schritt „in die richtige
Richtung” sei gemacht.
Haltelinie verlängert, Mütterrente
ausgeweitet
Ohne das Rentenpaket würde das
Rentenniveau ab 2026 von der Lohnentwicklung abgekoppelt und
bis 2031 voraussichtlich um rund einen Prozentpunkt auf 47
Prozent absinken. Die Verlängerung der Haltelinie
stabilisiert das Niveau bei 48 Prozent. Zudem soll mit der
Ausweitung der „Mütterrente” ab 1. Januar 2027 die
Erziehungsleistung von Müttern oder Vätern in den ersten drei
Lebensjahren jedes Kindes, unabhängig vom Geburtsjahr,
gleichermaßen gewürdigt werden.
Das Rentenpaket steht
außerdem im engen Zusammenhang mit weiteren rentenpolitischen
Maßnahmen, die die Bundesregierung auf den Weg bringt: der
Frühstartrente, der Aktivrente und der Stärkung der
Betriebsrente.
Rentenreform angekündigt
Der Kanzler
kündigte zudem eine Rentenreform an. Zunächst werde eine
Kommission Mitte 2026 dafür Vorschläge machen. Die
Bundesregierung werde sich damit zügig befassen und die
Rentenreform dann auf den parlamentarischen Weg bringen.
„Unser Sozialstaat wird auch in Zukunft finanzierbar,
leistungsstark und generationengerecht ausgestaltet sein”,
versicherte Bundeskanzler Friedrich Merz. Das sei ein
Versprechen allen Generationen gegenüber.
Lesen Sie hier
die Mitschrift des Statements:
Bundeskanzler Friedrich
Merz:
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen! Der
Deutsche Bundestag hat heute, wie Sie alle wissen, den Weg
für das Rentenpaket 1 der Koalition freigemacht. Dieser
Entscheidung waren intensive Debatten um die
Zukunftsfähigkeit unseres Rentensystems vorausgegangen. Diese
Debatte war notwendig. Sie war auch richtig, denn sie hat uns
vor Augen geführt, wie groß die Herausforderungen sind, vor
denen unser Land steht.
Der Bundestag hat heute einen
ersten Teil einer Antwort gegeben. Dazu zählt die Aktivrente,
die wir nun zum 1. Januar 2026 einführen können. Diese
Aktivrente weist den Weg in die Zukunft. Sie schafft Anreize,
über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus freiwillig
weiterzuarbeiten. Zur heutigen Entscheidung zählt auch die
Mütterrente. Dazu zählt aber auch die Haltelinie, über die
wir ja intensiv diskutiert haben. Ich bedanke mich für diese
Diskussion, auch für die Intensität der Auseinandersetzung,
weil sie uns allen deutlich vor Augen geführt hat, welche
wegweisende Entscheidung noch vor uns steht.
Lassen
Sie mich wiederholen, was ich seit Langem sage: Das ist nicht
das Ende unserer Rentenpolitik, sondern erst der Anfang. Die
Koalition hat beschlossen, dass sie schon im nächsten Jahr
eine umfassende Rentenreform vorschlagen wird. Zunächst wird
dazu eine Rentenfachkommission Vorschläge unterbreiten. Dann
werden wir uns in der Bundesregierung zügig damit befassen
und dann eine Rentenreform auf den parlamentarischen Weg
bringen. So haben wir es im Koalitionsvertrag beschlossen; so
haben wir es in der letzten Woche auch im Koalitionsausschuss
wiederholt. Diese Rentenreform 2 wird dann zu einem zentralen
Baustein unseres sozialen Sicherungssystems werden.
Unser Sozialstaat wird auch in Zukunft finanzierbar,
leistungsstark und generationengerecht ausgestaltet sein.
Dieses Versprechen haben wir uns in der Koalition gegeben.
Das ist ein Versprechen allen Generationen in unserem Lande
gegenüber, den Jungen wie den Älteren. Eine umfassende
Rentenreform kann auch nur dann gerecht sein, wenn sie in der
großen Breite unserer Gesellschaft auf Akzeptanz stößt.
Lassen Sie uns also gemeinsam im nächsten Jahr diese
grundlegende Reform angehen. Ich freue mich auf die
Diskussion. Es wird eine nicht ganz einfache Aufgabe für uns
werden. Aber ich bin nach den Diskussionen, die wir in den
letzten Tagen geführt haben, nicht nur in der
Bundestagsfraktion, sondern auch in der gesamten Koalition,
sehr zuversichtlich, dass uns dies gelingt. Die Arbeit liegt
jetzt vor uns, und der erste Schritt in die richtige Richtung
ist mit dem heutigen Tag gemacht.
|
|
Bundeskabinett beschließt den Siebten Armuts- und
Reichtumsbericht |
|
Berlin, 3. Dezember 2025 - Mit dem
heutigen Beschluss des Siebten Armuts- und Reichtumsberichtes
durch das Bundeskabinett kommt die Bundesregierung dem
Auftrag des Deutschen Bundestags nach, in jeder
Legislaturperiode einen Bericht über die Entwicklung von
Armut und Reichtum vorzulegen. Der Berichtszeitraum umfasst
die COVID-19-Pandemie sowie die Inflations- und
Energiepreiskrise in Folge des russischen Angriffskrieges auf
die Ukraine. Die Auswirkungen auf die sozialen und
materiellen Lebensverhältnisse werden auf Grundlage der
amtlichen Statistik und von Forschungsergebnissen
dargestellt.
Zu den neu gesetzten Schwerpunkten des
Siebten Armuts- und Reichtumsberichtes gehört die vertiefte
Auseinandersetzung mit der Nichtinanspruchnahme von
Mindestsicherungsleistungen, da diese die Wirksamkeit von
Armutsbekämpfung und sozialpolitischen Maßnahmen einschränkt.
Ebenfalls neu war die Durchführung eines eigenständigen
Beteiligungsprozesses, mit dem Menschen mit Armutserfahrung
stärker einbezogen wurden. Zudem werden erstmals in einem
Armuts- und Reichtumsbericht die sozialen Herausforderungen
und Chancen im Kontext von Klimawandel und Dekarbonisierung
thematisiert.
Den Erstellungsprozess zum Siebten
Armuts- und Reichtumsbericht haben der Beraterkreis, dem eine
Vielzahl an Verbänden, Institutionen und Vertreterinnen und
Vertreter der Bundestagsfraktion angehören, und das
Wissenschaftliche Gutachtergremium begleitet. In einer Reihe
von Symposien hat das BMAS kontinuierlich und transparent
über die Schwerpunkte und Ergebnisse der Begleitforschung
berichtet.
Der Bericht sowie die Begleitgutachten
können unter http://www.armuts-und-reichtumsbericht.de
abgerufen werden. Darüber hinaus sind dort umfangreiche
Informationen zum Erstellungsprozess sowie eine Übersicht
aller relevanten Indikatoren dargestellt.
|
|
Sozialer Wohnungsbau 2026/2027:
Bundesministerin Hubertz unterzeichnet
Verwaltungsvereinbarung
|
|
Berlin, 28.
November 2025 - Bundesbauministerin Verena Hubertz hat am 27.
November 2025 für den Bund die Verwaltungsvereinbarungen für
den Sozialen Wohnungsbau und das Sonderprogramm Junges
Wohnen für die Jahre 2026 und 2027 unterzeichnet. Die
Verwaltungsvereinbarungen werden nach Unterzeichnung aller 16
Bundesländer in Kraft treten.
Dazu Verena
Hubertz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen: “Um mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu
schaffen, ist
der Soziale Wohnungsbau ein entscheidender Schlüssel. Hierfür
investiert der Bund für die Programmjahre 2026 und 2027
insgesamt neun Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau
der Länder.
Die Mittel für das Junge Wohnen werden
wir ab 2027 auf dann eine Milliarde Euro jährlich verdoppeln.
Damit wollen wir die Trendwende bei den Sozialwohnungen
schaffen und den Bestand an bezahlbaren Wohnungen Schritt für
Schritt wieder erhöhen.
Dabei schauen wir
auch gemeinsam auf die Effizienz der eingesetzten Gelder.
Wir haben uns mit den Ländern darüber verständigt, das
serielle, modulare und systemische Bauen nun verstärkt auch
im Sozialen Wohnungsbau zu fördern, denn das spart Zeit und
Geld. Besonders freue ich mich, dass wir
erstmals die Verwaltungsvereinbarungen über zwei
Jahre abschließen werden. Das schafft Planungssicherheit und
reduziert für Bund und Länder den Verwaltungsaufwand
deutlich.”
Der soziale Wohnungsbau hat sich in den
letzten Jahren zu einem wichtigen Stabilitätsanker für den
gesamten Wohnungsbau entwickelt. Im Jahr 2024 wurden von den
Ländern insgesamt rund 62.000 Wohneinheiten im Bereich des
sozialen Wohnungsbaus gefördert.
Das waren rund 51
Prozent mehr als in 2022 und rund 25 Prozent mehr als im
Vorjahr – und das trotz gestiegener Bau- und
Finanzierungskosten und sinkender Baugenehmigungen im
Gesamtmarkt. Mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland
schaffen, steht für das Bundesbauministerium an erster
Stelle.
Deshalb bauen wir den Sozialen Wohnungsbau weiter
aus. Bis zum Jahr 2029 investiert der Bund die Rekordsumme
von 23,5 Milliarden Euro. Zusammen mit den Mitteln der Länder
steht so erfahrungsgemäß eine mehr als doppelt so hohe Summe
zur Verfügung.
|
|
Nationale Weiterbildungskonferenz |
|
Weiterbildungsoffensive 2030
gestartet – Chancen eröffnen, Qualifizierung stärken, Zukunft
sichern!
Berlin, 27. November 2025 - Mit der
heutigen Nationalen Weiterbildungskonferenz in Berlin setzen
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und das
Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMBFSFJ) zusammen mit den Partnern der Nationalen
Weiterbildungsstrategie den Auftakt für eine gemeinsame
Weiterbildungsoffensive. Ziel ist es, lebensbegleitendes
Lernen als selbstverständlichen Bestandteil der Arbeits- und
Lebenswelt in Deutschland zu verankern.
Die Nationale
Weiterbildungskonferenz ist die zentrale Veranstaltung zur
berufsbezogenen Weiterbildungspolitik in Deutschland. Die
eintägige Veranstaltung im Gasometer auf dem EUREF-Campus in
Berlin bringt ca. 500 Vertreterinnen und Vertreter aus
Politik, Wissenschaft, Sozialpartnern und
Weiterbildungspraxis zusammen.
Gemeinsam werden Wege
diskutiert, wie Weiterbildung transparenter, zugänglicher und
wirksamer gestaltet werden kann – für Beschäftigte,
Unternehmen und alle, die neue berufliche Chancen suchen. Die
Konferenz markiert zugleich den Auftakt zur Fortführung der
Nationalen Weiterbildungsstrategie und stellt das gemeinsam
von 17 Partnern aus Bund, Länder, Sozialpartnern, Kammern und
der Bundesagentur für Arbeit erarbeitete Fortsetzungspapier
„Weiterbildung 2030 – Chancen eröffnen, Qualifizierung
stärken, Zukunft sichern!“ in den Mittelpunkt. (der Link ist
ab 9 Uhr freigeschaltet)
Bärbel Bas,
Bundesministerin für Arbeit und Soziales:
„Wir
erleben einen tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt -
getrieben durch Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und
die demografische Entwicklung. Wir wollen Arbeitslosigkeit
verhindern, bevor sie entsteht – das ist der Anspruch einer
vorausschauenden Arbeitsmarktpolitik.
Weiterbildung
ist der Schlüssel dazu: Sie unterstützt die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und befähigt Menschen,
im Wandel voranzukommen. Mit der heutigen Konferenz setzen
wir einen Startschuss für unsere Weiterbildungsoffensive. Wir
brauchen eine neue Lernkultur, die Lust auf Veränderung
macht. Weiterbildung ist kein Luxus, sondern
Zukunftssicherung – für jede und jeden von uns.“
Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend:
„Gute Bildung im
gesamten Lebensweg ist die Voraussetzung für ein erfülltes
Leben, gesellschaftliche Teilhabe und Beschäftigungsfähigkeit
– die berufsbezogene Weiterbildung nimmt hier einen großen
Stellenwert ein und befähigt jeden Einzelnen, sein Potenzial
auszuschöpfen und Chancen, auch zur Integration, zu nutzen.
Integration von Kräften aus dem Ausland geht mit
Herausforderungen im Bildungssystem einher, denen wir uns
stellen. Wer sich weiterbildet, gestaltet mit. Wer Neues
lernt, verliert die Angst vor Veränderung. Wer Chancen
bekommt, bleibt Teil des Fortschritts und in unserer Mitte.
Weiterbildung stärkt nicht nur jeden Einzelnen, sondern auch
die Wirtschaft, unsere Demokratie als Ganzes und ist ein
wichtiger Teil der gesamten Bildungslaufbahn.“
Die
Partner der Nationalen Weiterbildungsstrategie setzen ein
klares Signal für eine ambitionierte Fortsetzung und
Weiterentwicklung der Nationalen Weiterbildungsstrategie. Mit
deren Umsetzung tragen die Partner dazu bei, das Ziel der
Bundesregierung im Rahmen der EU-2030-Strategie zu erreichen,
die Weiterbildungsbeteiligung bis 2030 um 11 Prozentpunkte
auf 65 Prozent zu steigern. Damit wird ein zentraler Beitrag
für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit und zur
Förderung individueller Chancen und der beruflichen
Entwicklung geleistet.
Für die dritte Phase der NWS
haben sich die Partner auf folgende Ziele verständigt:
1.
Menschen ohne Berufsabschluss oder ohne passfähige
Qualifikationen für den Arbeitsmarkt qualifizieren
2.
Beschäftige und Unternehmen bei der Weiterbildung im
Strukturwandel stärken
3. Chancen der Digitalisierung und
von Künstlicher Intelligenz für die Weiterbildung nutzen und
die Herausforderungen erfolgreich gestalten
Über diese
und weitere Themen diskutieren die Bundesministerinnen Bärbel
Bas und Karin Prien, die parlamentarischen
Staatssekretärinnen Katja Mast und Mareike Wulf sowie
Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Sozialpartner, der
Bundesländer, von Unternehmen, der Bundesagentur für Arbeit
und des Bundesinstituts für Berufsbildung. Darüber hinaus
wird der OECD-Generalsekretär Mathias Cormann für eine
internationale Keynote live von Paris aus zugeschaltet.
Das Hauptprogramm der NWK - beide Keynotes und
Paneldiskussionen - werden aus dem Plenum live übertragen.
Hintergrund:
Nationale Weiterbildungsstrategie und
Nationale Weiterbildungskonferenz
Die 2019 gestartete
Nationale Weiterbildungsstrategie steht für einen
kontinuierlichen und partnerschaftlichen Austausch von
zentralen Akteuren zur Zukunft der Weiterbildung in
Deutschland.
In den vergangenen Jahren hat sie Strukturen
der Koordination und Kooperation in der Weiterbildungspolitik
neu geschaffen, zahlreiche Maßnahmen angestoßen und Projekte
gemeinsam umgesetzt. Jetzt startet die Strategie in ihren
dritten Zyklus und greift die Erfahrungen der vergangenen
Jahre auf, um Weiterbildung noch transparenter, zugänglicher
und wirksamer zu gestalten.
Das vollständige Programm
der Konferenz, den Link zur Live-Übertragung sowie weitere
Informationen finden Sie hier: Nationale
Weiterbildungskonferenz - BMAS
|
|
Neustart der „Energetischen Stadtsanierung“ |
|
Kommunen erhalten wieder
Fördermittel für den klimafreundlichen Umbau ihrer Quartiere
Berlin. 26. November 2025 - Nach dem Förderstopp
am Ende des Jahres 2023 nimmt das Bundesministerium für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) in
Zusammenarbeit mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
das erfolgreiche Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“
(KfW 432) wieder auf.
Ziel des Förderprogramms ist
es, Kommunen und ihre Partner beim klimagerechten Umbau von
Stadtquartieren zu unterstützen und damit zur Erreichung der
Klimaneutralität bis 2045 beizutragen. Das Programm fördert
Konzepte für energetische Sanierungen und für die
Dekarbonisierung der Energieversorgung im Quartier sowie ein
Sanierungsmanagement, das die Umsetzung dieser Konzepte
begleitet.
Dazu Verena Hubertz, Bundesministerin für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: „Mit dem Neustart des
Förderprogramms ‚Energetische Stadtsanierung‘ setzen wir ein
starkes Signal für den Klimaschutz und die Zukunftsfähigkeit
im Gebäudesektor. Wir unterstützen Kommunen,
Gebäudeeigentümer, Stadtwerke und Wohnungsunternehmen dabei,
ihren Gebäudebestand fit für die Zukunft zu machen. Serielles
Sanieren, Nahwärmenetze oder die Nutzung von Abwärme aus
benachbartem Gewerbe – vor Ort zeigen sich viele effiziente
Wege, um den Energieverbrauch zu senken und den Anteil
erneuerbarer Energien zu steigern. So entstehen vor Ort
innovative Lösungen, die Energie sparen, erneuerbare Quellen
stärken und unsere Stadtquartiere lebenswerter machen.“
Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung zur
Erreichung der Klimaziele im Gebäudesektor unter anderem
vorgenommen, den Quartiersansatz zu stärken. Mit der
Neuauflage des Förderprogramms geht die Bundesregierung einen
weiteren bedeutenden Schritt hin zu nachhaltigeren und
klimafreundlicheren Städten – für die Umwelt und für die
Menschen, die hier leben.
Im Vordergrund steht die
Minderung von CO2-Austoß, zugleich werden jedoch auch
städtebauliche, denkmalpflegerische, wohnungswirtschaftliche
und soziale Aspekte in das Programm mit einbezogen. Neben der
CO2-Reduktion können auch Maßnahmen zur Klimaanpassung, der
Ausbau von Stadtgrün oder der Einsatz digitaler Technologien
berücksichtigt werden.
Somit bietet das
Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ die Chance, den
für den Klimaschutz notwendigen Umbau der Stadtquartiere
gleichzeitig für die Entwicklung nachhaltiger Quartiere mit
hoher Lebensqualität zu nutzen. Zudem ist das Programm ein
wichtiger Baustein, um in den kommenden Jahren die Umsetzung
der Wärmeplanung voranzubringen. Ab heute können Kommunen,
kommunale Unternehmen und weitere Akteure erneut
Förderanträge bei der KfW stellen.
Im Rahmen des
Programms erhalten geförderte Kommunen Zuschüsse von bis zu
75%, in Haushaltsnotlagen sind sogar bis zu 90% Förderung
möglich. Insgesamt stehen für das Programm im Jahr 2025 und –
vorbehaltlich des Beschlusses des Haushaltes 2026 – jeweils
75 Mio. Euro zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie
unter www.kfw.de/432 auf
der Website der KfW re
|
|
Mindestlöhne in der Altenpflege sollen erneut steigen |
|
Berlin, 25 November 2025 - Am 19. November
2025 hat sich die Pflegekommission einstimmig auf höhere
Mindestlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege geeinigt:
Bis zum 1. Juli 2027 sollen die Mindestlöhne für Pflegekräfte
in Deutschland in zwei Schritten steigen. Die
Pflegemindestlöhne werden hierbei wie schon bei den letzten
Beschlüssen dieser und früherer Pflegekommissionen, nach
Qualifikationsstufe gestaffelt.
Für Pflegehilfskräfte
empfiehlt die Pflegekommission eine Anhebung auf 16,95 Euro
pro Stunde, für qualifizierte Pflegehilfskräfte eine Anhebung
auf 18,26 Euro pro Stunde und für Pflegefachkräfte auf 21,58
Euro pro Stunde. Sie gelten einheitlich im gesamten
Bundesgebiet.
Für Beschäftigte in der Altenpflege
empfiehlt die Pflegekommission weiterhin einen Anspruch auf
zusätzlichen bezahlten Urlaub über den gesetzlichen
Urlaubsanspruch hinaus. Dieser soll weiterhin neun Tage pro
Kalenderjahr (bei einer 5-Tage-Woche) betragen. Die
Pflegekommission hat sich bei ihrer Empfehlung für eine
Laufzeit bis zum 30. September 2028 ausgesprochen.

Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Bas: „Jeden
Tag, jede Nacht, jedes Wochenende leisten unsere Pflegekräfte
Herausragendes. Für dieses Anpacken und Dabeibleiben sind
gute Löhne zentral - damit sich auch in Zukunft Menschen gern
für den Pflegeberuf entscheiden, und die Versorgung von
Pflegebedürftigen sichergestellt ist. Ich begrüße die
aktuelle und einstimmig beschlossene Empfehlung der
Pflegekommission: Sie bringt spürbare Lohnsteigerungen für
unsere Pflegekräfte. Das ist ein starkes Zeichen und eine
gute Nachricht für alle Pflegebedürftigen, Angehörigen und
die ganze Pflegebranche.“

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken: „Es ist ein gutes
Signal, dass sich die Pflegekommission für die kommenden
beiden Jahre auf höhere Mindestlöhne in der Pflege
verständigt hat. Unabhängig von dieser Entscheidung haben
sich die Löhne für Pflege- und Betreuungskräfte in den
vergangenen Jahren bereits spürbar verbessert: Sie erhalten
in den Pflegeeinrichtungen für ihre anspruchsvolle berufliche
Tätigkeit durchschnittlich bereits wesentlich höhere Löhne
auf Tarifniveau, als von der Pflegekommission nun festgelegt.
Neben der finanziellen Komponente wollen wir die Berufe in
der Pflege durch mehr Befugnisse und weniger Bürokratie
stärken, um die Attraktivität dieser Berufsbilder weiter zu
erhöhen.“
Beauftragte des BMAS für die
Pflegekommission und ehemalige Hamburger
Gesundheitssenatorin, Cornelia Prüfer-Storcks:
„Auch in
diesem Jahr hat sich die Pflegekommission einstimmig auf
höhere Mindestlöhne in der Pflegebranche geeinigt. Das ist in
schwierigen wirtschaftlichen Zeiten für die Pflegebranche
keine Selbstverständlichkeit. Der Pflegemindestlohn ist
weiterhin wichtig als einziger individuell einklagbarer
Rechtsanspruch der Beschäftigten in der Pflege. Gleichzeitig
gibt der Beschluss den Pflegeeinrichtungen im Hinblick auf
die Mindestentgelte Planungssicherheit für die nächsten
Jahre.“
Die nach der neuen Empfehlung der Kommission
geplanten Erhöhungsschritte der Pflegemindestlöhne lauten im
Einzelnen wie folgt:
(1) Für Pflegehilfskräfte:

(2) Für qualifizierte Pflegehilfskräfte (Pflegekräfte mit
einer mindestens 1-jährigen Ausbildung und einer
entsprechenden Tätigkeit):

3) Für Pflegefachkräfte:

Rund 1,3 Millionen Beschäftigte arbeiten in
Einrichtungen, die unter den Pflegemindestlohn fallen. Die
aktuell gültige Pflegemindestlohn-Verordnung ist noch bis 30.
Juni 2026 gültig und sieht vor, dass die Mindestlöhne für
Pflegehilfskräfte derzeit 16,10 Euro, für qualifizierte
Pflegehilfskräfte 17,35 Euro und für Pflegefachkräfte 20,50
Euro betragen.
Dort, wo der spezielle
Pflegemindestlohn nicht zur Anwendung kommt (zum Beispiel in
Privathaushalten), gilt der allgemeine gesetzliche
Mindestlohn von aktuell 12,82 Euro pro Stunde. Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales strebt an, auf
Grundlage der Empfehlung der Pflegekommission die neuen
Pflegemindestlöhne auf dem Weg einer Verordnung festzusetzen.
Damit werden die empfohlenen Pflegemindestlöhne wie
auch der Anspruch auf Mehrurlaub allgemein verbindlich -
ungeachtet etwaiger höherer Ansprüche aus Arbeits- oder
Tarifvertrag. Der Pflegekommission nach dem
Arbeitnehmer-Entsendegesetz gehören Vertreterinnen und
Vertreter von privaten, freigemeinnützigen sowie kirchlichen
Pflegeeinrichtungen an.
Arbeitgeber bzw. Dienstgeber
und Arbeitnehmer bzw. Dienstnehmer sind paritätisch
vertreten. Die fünfte Pflegekommission hat ihre Arbeit unter
dem Vorsitz der ehemaligen Gesundheitssenatorin Cornelia
Prüfer-Storcks im Dezember 2021 aufgenommen und amtiert für
fünf Jahre.
|
|
1059. Sitzung des Bundesrates am 21. November 2025
|
|
Berlin, 21. November 2025: Die
Beschlüsse
- Zustimmung zur Finanzierung des
Deutschlandtickets bis
2030
- Besserer
Jugendschutz bei Online-Spielen
- Gesetz zur Rückgabe von
Elektroschrott und E-Zigaretten passiert den Bundesrat
- Aktivrente: Länder
fordern Kompensation der Steuerausfälle
- Bundesrat fordert bessere
Gewaltprävention für
medizinisches Personal
- Anpassung der
Krankenhausreform - Länder fordern Änderungen
- Bundesrat für mehr Transparenz bei
Benzinpreisen an Tankstellen
- Länder rufen Vermittlungsausschuss zum
Pflegekompetenzgesetz
an
Zustimmung zur Finanzierung des
Deutschlandtickets bis 2030
Die Finanzierung des Deutschlandtickets für die nächsten
Jahre ist gesichert: Der Bundesrat stimmte am 21. November
2025 der elften Änderung des Regionalisierungsgesetzes zu.
Finanzierung bis zum Jahr 2030
Das Gesetz regelt die
weitere finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets bis
zum Jahr 2030 – bislang war diese nur für die Jahre 2023 bis
2025 gesetzlich festgeschrieben. Der Bund beteiligt sich auch
in den kommenden Jahren mit einem Betrag in Höhe von 1,5
Milliarden Euro am Ausgleich der durch das Deutschlandticket
entstehenden Mindereinnahmen.
Die Länder, die
ebenfalls 1,5 Milliarden beisteuern, reichen diese Gelder an
die Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr
und diese wiederum an die Verkehrsunternehmen weiter. Das
Gesetz enthält einen Schlüssel, wie die Bundesmittel konkret
auf die 16 Länder zu verteilen sind. Diese weisen dem Bund
jährlich nach, dass die Gelder zweckentsprechend verwendet
wurden.
Mit dem Gesetz wird eine Vereinbarung der
Regierungsparteien aus dem Koalitionsvertrag sowie ein
Beschluss der Verkehrsministerkonferenz vom September dieses
Jahres umgesetzt.
Forderungen des Bundesrates
berücksichtigt
Der Bundesrat hatte am 26. September 2025
zu dem ursprünglichen Gesetzentwurf der Bundesregierung
Stellung genommen und unter anderem kritisiert, dass dieser
eine Finanzierung lediglich für das Jahr 2026 vorsah. Neben
der dauerhaften Absicherung des Deutschlandtickets forderte
der Bundesrat, auch die anderen Regionalisierungsmittel zu
erhöhen, um für die Bürgerinnen und Bürger ein attraktives
Nahverkehrsangebot aufrechterhalten zu können.
Der
Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf am 7. November 2025
auf Grundlage des Beschlusses seines Verkehrsausschusses in
geänderter Fassung angenommen und damit einige Forderungen
des Bundesrates umgesetzt.
Inkrafttreten
Mit der
Zustimmung des Bundesrates kann das Gesetz nun ausgefertigt
und verkündet werden. Es tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft.
Besserer Jugendschutz
bei Online-Spielen
Glücksspielähnliche
Mechanismen wie Lootboxen bei Video- und Onlinespielen
stärker zu reglementieren: Das schlägt der Bundesrat mit
einer am 21. November 2025 gefassten Entschließung vor.
Glücksspielähnliche Mechanismen „Lootboxen“ sind virtuelle
Gegenstände, die in Smartphone- oder Computerspielen als
Überraschung gekauft werden können, um neue Items oder
Fähigkeiten freizuschalten.
Der Kauf erfolgt in der
Regel mit einer spielinternen Währung, die zuvor mit echtem
Geld erworben werden muss. Rechtliche Einordnung Ob Lootboxen
als Glücksspiel gelten können, ist umstritten, da kein echtes
Geld gewonnen werden kann, sondern lediglich virtuelle
Gegenstände. Daher fordert der Bundesrat die Bundesregierung
auf, zu prüfen, inwiefern Lootboxen glücksspielähnliche
Mechanismen aufweisen und diese gegebenenfalls im Bereich des
Kinder- und Jugendschutzes zu reglementieren.
Maßnahmen für effektiveren Jugendschutz
Der Bundesrat
bittet die Bundesregierung auch, das Jugendschutzgesetz in
Einklang mit dem Glücksspielrecht der Länder zu erweitern.
Eine Möglichkeit für die Umsetzung könne eine
Altersverifikation ab 18 Jahren bei Spielen mit Lootboxen
sein. Außerdem solle das Bundesinstitut für Öffentliche
Gesundheit Informationsmaterialien entwickeln, um sowohl
Eltern als auch Jugendliche über die Gefahren von Lootboxen
aufzuklären.
Zudem bitte der Bundesrat die
Bundesregierung, sich auf europäischer Ebene im Zuge des
Digital Fairness Acts für eine transparentere Kostenstruktur
und Angabe von Gewinnwahrscheinlichkeiten in Videospielen
einzusetzen.
Dies sei nötig, da Videospiele für den
europäischen oder weltweiten Markt entwickelt werden und
somit eine deutsche Regulierung nur geringfügiges Gewicht
haben werde.
Wie geht es weiter?
Die
Entschließung des Bundesrates wird der Bundesregierung
zugestellt. Gesetzliche Vorgaben, wann und wie diese sich
damit beschäftigt, gibt es nicht.
Aktivrente: Länder
fordern Kompensation der Steuerausfälle
Der Gesetzentwurf
der Bundesregierung zur Aktivrente stand am 21. November 2025
auf der Tagesordnung des Bundesrates. In seiner Stellungnahme
fordert er punktuelle Klarstellungen am Gesetzentwurf und
verweist auf die erheblichen Steuerausfälle, die sich aus dem
Vorhaben ergeben.
Zwischen 2026 bis 2030 beliefen
sich die Ausfälle der Länder auf rund 1,9 Milliarden Euro,
die der Gemeinden auf rund 0,7 Milliarden Euro. Die Länder
weisen darauf hin, dass ihre Haushalte und insbesondere die
der Gemeinden ohnehin hohen strukturellen Herausforderungen
gegenübersehen. Mit dem damit verbundenen Ausgabenwachstum
könne die Einnahmeentwicklung nicht mithalten.
Außerdem bitten die Länder die Bundesregierung, die durch das
Gesetzesvorhaben entstehenden Steuermindereinnahmen von
Ländern und Kommunen nachhaltig zu kompensieren. Dafür kämen
etwa die verstärkte Finanzierung des Deutschlandtickets durch
den Bund oder eine Anhebung der Finanzierungsbeteiligung des
Bundes an den flüchtlingsbedingten Ausgaben der Länder in
Betracht.
Was die Bundesregierung vorhat
Mit der
Aktivrente möchte die Bundesregierung den aktuellen
Herausforderungen des Arbeitsmarktes begegnen und die
deutsche Wirtschaft stärken. Durch die Überalterung der
Gesellschaft und das Eintreten der Baby-Boomer in die Rente
sieht sie eine Verschärfung des Fachkräftemangels in der
deutschen Wirtschaft. Um das Arbeitspotenzial durch die
gesteigerte Lebenserwartung der Gesellschaft zu nutzen, soll
die Aktivrente eine Weiterarbeit nach Renteneintrittsalter
attraktiver machen. Berechnungen zufolge würden circa 168.000
Rentner weiterhin dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Wie funktioniert die Aktivrente?
Durch die Reform
können Rentner nach Erreichen des Regelrenteneintrittsalters
2.000 Euro pro Monat steuerfrei bei einer
nichtselbstständigen Arbeit verdienen. Jeder Euro, den sie
darüber hinaus verdienen, wird versteuert. Dabei zahlt der
Arbeitgeber weiterhin die Sozialversicherungsbeiträge, sodass
die Sozialversicherungen dadurch finanziell stabilisiert
werden. Dies trage auch zur Stärkung der Generationen- und
Verteilungsgerechtigkeit bei, so die Bundesregierung.
Nicht betroffen von der Aktivrente sollen geringfügige
Beschäftigungen und der Lohn aus selbstständiger Arbeit sein,
da in diesen Beschäftigungsformen schon eine
Steuervergünstigung vorliege oder für eine Weiterarbeit keine
Anreize geschaffen werden müssten.
Wie es weitergeht
Die Stellungnahme wird der Bundesregierung zugeleitet. Dann
ist der Bundestag am Zug. Wenn er das Gesetz beschlossen hat,
kommt es erneut in den Bundesrat, der dann über seine
Zustimmung entscheidet.
Bundesrat fordert
bessere
Gewaltprävention für medizinisches
Personal
Ärzte, medizinisches und pflegerischen
Personal sollen besser vor Gewalt geschützt werden. Das
fordert der Bundesrat mit einer am 21. November 2025
gefassten Entschließung. Schutzmaßnahmen gefordert Der
Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, zeitnah einen
Gesetzentwurf für einen besseren Schutz der Mitarbeitenden in
der Gesundheitsversorgung vorzulegen.
Sie solle dabei
prüfen, wie Schulungen, bessere Personalschlüssel und
bauliche Anpassungen durch Barrieren das medizinische
Personal besser vor Übergriffen schützen können. Zu
untersuchen sei auch, wie diese Maßnahmen durch
Förderprogramme oder gesetzliche Zuschläge langfristig
finanziert werden können.
Die Länder schlagen vor, in
die Beratung dieser Maßnahmen einen Regierungsentwurf aus der
letzten Legislaturperiode einzubeziehen. Zunahme der Gewalt
Der Bundesrat begründet seinen Vorstoß unter anderem mit den
Ergebnissen einer Umfrage des Marburger Bunds, aus der ein
Anstieg von Gewalterfahrungen am Arbeitsplatz hervorgeht. So
erlebten 90 Prozent der Befragten verbale Gewalt und 50
Prozent körperliche Gewalt.
Bei 40 Prozent der
Befragten hätten die Gewalterfahrungen in den vergangenen
fünf Jahren zugenommen, und über 50 Prozent der Befragten
fühlten sich nicht ausreichend vor Gewalt geschützt. Auch die
medizinischen Fachangestellten hätten ähnliche Erfahrungen
gemacht.
Wie geht es weiter?
Die Entschließung
wird der Bundesregierung zugestellt. Gesetzliche Regelungen,
wie und wann diese darauf reagiert, gibt es nicht.
Anpassung der
Krankenhausreform - Länder
fordern Änderungen
Nach einer umfangreichen
Debatte hat sich der Bundesrat am 21. November 2025 in einer
ausführlichen Stellungnahme zur geplanten Anpassung der
Krankenhausreform positioniert. So fordert er von der
Bundesregierung beispielsweise, die vorgesehene
Vergütungssystematik grundlegend zu überarbeiten, da nicht
klar sei, wie diese konkret ausgestaltet und in der Praxis
umgesetzt werden solle. Es sei derzeit kaum einzuschätzen,
welche Auswirkungen das geplante Vergütungssystem auf die
Versorgungslandschaft habe.
Weiterentwicklung bei
sektorübergreifender Versorgung
Außerdem müssten die
Regelungen für sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen
zeitnah weiterentwickelt werden, da diese bisher hinter den
Erwartungen zurückblieben. Insbesondere werde die
Möglichkeit, bestimmte Behandlungen nun auch ambulant
anzubieten nicht ausgeschöpft. Um dies zu ermöglichen, sei es
auch notwendig, sektorenübergreifende und -verbindende
Strukturen zu fördern.
Die Länder begrüßen, dass der
Bund sie dabei unterstützen möchte, die
Krankenhausinfrastruktur durch zusätzliche Investitionen zu
modernisieren. Eine nachhaltige positive Entwicklung setze
aber auch voraus, dass die Entgelte ein auskömmliches
Wirtschaften ermöglichen. Aus diesem Grund lehnt der
Bundesrat unter anderem Regierungspläne zur Absenkung der
Budgets von psychiatrischen und psychosomatischen
Krankenhäusern ab.
Was die Bundesregierung vorhat
Die Ziele der Krankenhausreform aus dem Jahr 2024, die
Qualität und Effizienz der Versorgung zu sichern, sollen
durch die geplanten Anpassungen gewahrt bleiben, so die
Bundesregierung. Die Krankenhausversorgung soll insbesondere
auf dem Land gestärkt werden. Hierfür sind zusätzliche
Ausnahmen und Kooperationsmöglichkeiten für Krankenhäuser
vorgesehen. Ob und wann diese erforderlich sind, soll dabei
in enger Zusammenarbeit zwischen Landesbehörden und
Krankenhäusern entschieden werden.
Weniger
Leistungsgruppen
Zudem ist geplant, die
Krankenhausbehandlungen in 61 statt bisher 65
Leistungsgruppen einzuteilen, wobei für jede Gruppe
Qualitätskriterien für Struktur- und Prozessqualität
festgelegt werden. So soll eine bessere Ausrichtung an den
tatsächlichen Versorgungsbedürfnissen ermöglicht werden.
Finanzierung des Transformationsfonds
Ebenfalls
angepasst werden soll die Finanzierung. Der Bundesanteil am
Krankenhaustransformationsfonds soll nun durch aus dem
Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, und nicht
mehr über Krankenkassenbeiträge finanziert werden. Außerdem
ist geplant, dass der Bund für die ersten vier Jahre jährlich
eine zusätzliche Milliarde Euro übernimmt, um die Länder zu
entlasten. So würde der Anteil des Bundes an diesem Fonds von
25 auf 29 Milliarden Euro steigen.
Vorhaltevergütung
verschoben
Schließlich sieht der Regierungsentwurf vor,
die Einführung der Vorhaltevergütung um ein Jahr zu
verschieben. Gleiches gilt für die mit der Krankenhausreform
eingeführten Zuschläge und Förderbeiträge. Die geltenden
Zuschläge für Pädiatrie und Geburtshilfe sollen in der Folge
um ein Jahr verlängert werden.
Gang des
Gesetzgebungsverfahrens
Die Stellungnahme wird der
Bundesregierung zugestellt. Dann befasst sich der Bundestag
mit dem Gesetz. Hat er es verabschiedet, kommt das
Einspruchsgesetz erneut zum Bundesrat.
Gesetz zur
Rückgabe von
Elektroschrott und E-Zigaretten passiert
den Bundesrat
Die vor Kurzem vom Bundestag
verabschiedete Änderung des Elektro- und
Elektronikgerätegesetzes hat am 21. November 2025 den
Bundesrat passiert. Die Empfehlung des Umweltausschusses, den
Vermittlungsausschuss anzurufen, um so ein Verbot von
Einweg-E-Zigaretten durchzusetzen, fand im Plenum keine
Mehrheit.
Hersteller in der Pflicht
Mit der
Gesetzesänderung sollen vor allem die Entsorgung und
Rücknahme elektronischer Geräte besser geregelt und EU-Recht
umgesetzt werden. Dafür werden die Hersteller stärker in die
Verantwortung genommen, zum Beispiel bei der
Recyclingpflicht, der Nutzung von sekundären Rohstoffen und
der Langlebigkeit von Elektrogeräten. Zudem sollen Sammel-
und Rücknahmesysteme durch ein Logo vereinheitlicht und
leichter zugänglich gemacht werden.
Geschäfte, die
Einweg-E-Zigaretten vertreiben, müssen zukünftig eine
Sammelstation für gebrauchte Geräte einrichten und diese
verpflichtend zurücknehmen. An kommunalen Sammelstellen
sollen Mitarbeitende und nicht die Verbraucher selbst
Elektroschrott und Batterien sortieren, um Brandrisiken zu
verringern.
Notwendigkeit der gesetzlichen Anpassung
Deutschland unterschritt die europäische
Mindestsammelquote für das Jahr 2021 deutlich. Die Quote soll
nun gesteigert werden, indem mehr über Rückgabemöglichkeiten
und mehr Sammelstellen informiert wird. Gerade auch wegen der
steigenden Zahl falsch im Restmüll entsorgter
Einweg-E-Zigaretten seien bessere Informationen und
zugänglichere Rückgabemöglichkeiten notwendig, heißt es in
der Gesetzesbegründung.
Das Gesetz wird nun ausgefertigt
und verkündet. Es tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
Bundesrat für mehr Transparenz bei
Benzinpreisen an Tankstellen
Der Bundesrat kritisiert die häufigen Änderungen der
Kraftstoffpreise an Tankstellen. Mit einer am 21. November
2025 gefassten Entschließung fordert er die Bundesregierung
auf, zu prüfen, wie Benzinpreise für Verbraucherinnen und
Verbraucher transparenter gestaltet werden können.
Weniger
Preiserhöhungen am Tag
Insbesondere solle die
Bundesregierung prüfen, ob sich die mehrfachen
Preiserhöhungen am Tag beschränken lassen. Preissenkungen
sollen aber jederzeit erlaubt bleiben. Als Beispiel gilt
hierbei Österreich, wo Tankstellenpreise nur einmal täglich
erhöht werden dürfen. Zu prüfen sei auch, ob die Transparenz
der Kraftstoffpreise steigt, wenn zwischen den
Preisanpassungen zeitliche Mindestabstände - beispielsweise
drei Stunden - eingeführt werden. Dies könnte zu weniger
Preiserhöhungen führen, aber zugleich die Flexibilität der
Kraftstoffanbieter bei der Preisgestaltung weniger stark
einschränken, als im österreichischen Modell, so der
Bundesrat.
Rund 18 Preisänderungen pro Tag
Ausgangspunkt ist der Abschlussbericht des Bundeskartellamts
vom Februar 2025, der eine sinkende Preistransparenz an
Tankstellen feststellt. Aufgrund von mittlerweile
durchschnittlich 18 Preisänderungen pro Tag und Tankstelle
sei es für Verbraucherinnen und Verbraucher immer
schwieriger, günstige Tankzeitpunkte zu erkennen. Schon 2012
hatte der Bundesrat eine ähnliche Entschließung gefasst,
damals bei deutlich weniger Preisänderungen am Tag.
Verbesserung der Transparenzstelle
Darüber hinaus
regen die Länder an, die Arbeit der Markttransparenzstelle
für Kraftstoffe (MTS-K) zu optimieren. Eine Begrenzung der
täglichen Preisänderungen könnte nicht nur die Transparenz
verbessern, sondern auch den Bürokratieaufwand verringern, da
weniger Preisdaten übermittelt, weitergeleitet und
veröffentlicht werden müssten. Dadurch würden sowohl
Tankstellen als auch Informationsdienste und die
Markttransparenzstelle entlastet.
Wie es weitergeht
Die Entschließung wird der Bundesregierung zugestellt.
Gesetzliche Vorgaben, wann und wie diese darauf reagieren
muss, gibt es nicht.
Länder rufen
Vermittlungsausschuss zum
Pflegekompetenzgesetz an
In seiner
Plenarsitzung am 21. November 2025 hat der Bundesrat das
Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung der
Pflege in den Vermittlungsausschuss überwiesen.
Meistbegünstigungsklausel in der Kritik
Die Länder
begründen ihre Entscheidung mit dem geplanten Aussetzen der
Meistbegünstigungsklausel bei der Vergütung der Krankenhäuser
für das Jahr 2026. Durch die vom Bundestag eingefügte
Regelung sollen die gesetzlichen Krankenversicherungen
finanziell entlastet und stabilisiert werden.
Die
Länder befürchten, dass den Krankenhäusern damit Einnahmen
von ca. 1,8 Milliarden Euro im Jahr verloren gehen. Die
Aussetzung wirke sich auch in den darauffolgenden Jahren
negativ auf die finanzielle Situation der Krankenhäuser aus.
Die Regelung stehe außerdem im Widerspruch zur im
Haushaltsbegleitgesetz des Bundes festgeschriebenen
einmaligen Unterstützung für die Krankenhäuser in Höhe von
vier Milliarden Euro, mit der die Inflationskosten aus den
Jahren 2022 und 2023 kompensiert werden sollen.
Was
das Gesetz vorsieht
Den Schwerpunkt des Gesetzes bildet
die Pflege. Es sieht zahlreiche Maßnahmen vor, um diese auf
mehr Schultern zu verteilen, die Versorgung in der Fläche zu
sichern, den Pflegeberuf attraktiver zu machen und Bürokratie
abzubauen.
Mehr Befugnisse für Pflegekräfte
So
erhalten Pflegekräfte mehr medizinische Befugnisse, die
bisher Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sind oder von diesen
angeordnet werden müssen. In den nächsten Jahren sollen
Kataloge für die Leistungen erstellt werden, die
Pflegefachkräfte künftig eigenverantwortlich erbringen
dürfen.
Das Gesetz bringt zudem eine Reihe weiterer
Änderungen mit sich, darunter einen verbesserten Zugang zu
Präventionsdiensten für Menschen, die zu Hause gepflegt
werden. Außerdem soll die pflegerische Versorgung in
innovativen gemeinschaftlichen Wohnformen gefördert werden.
Sie bieten sowohl bestehenden als auch neuen
Versorgungsmodellen erweiterte Optionen im ambulanten System.
Weniger Bürokratie
Das Gesetz sieht auch vor, Anträge
und Formulare für Pflegeleistungen zu vereinfachen. Außerdem
werden den Kommunen mehr Mitspracherechte bei der Zulassung
von Pflegeeinrichtungen eingeräumt.
Einsparungen bei den
Krankenkassen
Der Bundestag hatte das Gesetz um ein
Sparpaket für die gesetzlichen Krankenkassen erweitert. Neben
der erwähnten Aussetzung der Meistbegünstigungsklausel werden
die Krankenkassen im Jahr 2026 auch von ihrer Verpflichtung
zur Finanzierung des Innovationsfonds befreit. Außerdem sind
die sächlichen Verwaltungskosten der gesetzlichen
Krankenkassen für 2026 gedeckelt, wodurch sie einen Betrag
von rund 100 Millionen Euro einsparen.
Weiter bis zu
15 Kinderkrankentage
Das Gesetz enthält auch eine wichtige
Regelung zu den Kinderkrankentagen. Eltern haben derzeit die
Möglichkeit, für jedes gesetzlich krankenversicherte Kind
unter zwölf Jahren Kinderkrankengeld für bis zu 15
Arbeitstage im Jahr zu beantragen, Alleinerziehende können
sogar 30 Tage in Anspruch nehmen. Diese Regelung soll im
kommenden Jahr weiterhin gelten.
Wie es weitergeht
Wann der Vermittlungsausschuss zusammenkommt, um das Gesetz
zu beraten, steht derzeit noch nicht fest.
|
|
- Bundeskabinett hat den Rentenversicherungsbericht
2025 beschlossen
- Elektronische Fußfesseln und
Anti-Gewalt-Trainings zum Schutz vor häuslicher Gewalt
|
|
Bundeskabinett hat den Rentenversicherungsbericht
2025 beschlossen, 19 November
2025 - Die Bundesregierung informiert mit dem
Rentenversicherungsbericht jedes Jahr im November über die
Entwicklung der Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung.
Dazu werden Modellrechnungen zur voraussichtlichen
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen
Rentenversicherung, der Nachhaltigkeitsrücklage, des
Beitragssatzes und des Sicherungsniveaus vor Steuern in den
künftigen 15 Kalenderjahren erstellt. Wie in jedem Jahr wird
dabei vom geltenden Recht unter Einbezug von
Kabinettsbeschlüssen ausgegangen. Hier ist also das
Rentenpakt 2025 berücksichtigt.
Zudem liefert der
Rentenversicherungsbericht ausführliches Datenmaterial zur
aktuellen Entwicklung der Rentenbeziehenden und der
Rentenleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung sowie
der Beschäftigung Älterer.
Die wichtigsten
Ergebnisse der Vorausberechnungen sind:
Für Ende
2025 wird eine Nachhaltigkeitsrücklage von rund 41,5
Milliarden Euro (1,39 Monatsausgaben) geschätzt. Dies ist
deutlich höher als in den letzten Schätzungen angenommen.
Hintergrund ist in erster Linie die sehr gute Entwicklung der
Beitragseinnahmen im laufenden Jahr.
In der Folge
bleibt der Beitragssatz bis zum Jahr 2027 stabil bei 18,6
Prozent. Bislang wurde bereits für 2027 ein
Beitragssatzanstieg vorhergesagt, auch im letzten
Rentenversicherungsbericht 2024.
Bis zum Jahr 2039
steigen die Renten um insgesamt gut 45 Prozent. Dies
entspricht einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 2,8
Prozent pro Jahr.
Das Sicherungsniveau vor Steuern liegt
aktuell bei 48 Prozent und bleibt aufgrund der Verlängerung
der Haltelinie bis zum Jahr 2031 auf diesem Wert. Nach dem
Auslaufen der Haltelinie sinkt es bis zum Jahr 2039 auf 46,3
Prozent ab.
Elektronische Fußfesseln und
Anti-Gewalt-Trainings zum Schutz vor häuslicher Gewalt:
Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf
Mit
mehreren Gesetzesänderungen will die Bundesregierung den
Schutz vor häuslicher Gewalt verbessern. Einen entsprechenden
Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Dr. Stefanie Hubig
hat das Kabinett heute beschlossen. Der Gesetzentwurf sieht
insbesondere vor, dass Familiengerichte Gewalttäter zum
Tragen von elektronischen Fußfesseln verpflichten können.
Außerdem sollen sie Gewalttäter zur Teilnahme an sozialen
Trainingskursen, etwa Anti-Gewalt-Trainings, oder
Gewaltpräventionsberatungen verpflichten können.
Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr.
Stefanie Hubig erklärt dazu:
„Häusliche Gewalt ist kein
Schicksal. Wir können etwas tun. Und wir müssen es. Alle paar
Minuten wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder
Ex-Partner angegriffen. Beinahe jeden zweiten Tag tötet ein
Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin. Unser Rechtsstaat
muss mehr tun, um diese Gewalt zurückzudrängen. Unser
Rechtsstaat muss insbesondere Frauen besser gegen häusliche
Gewalt schützen.
Mit unserem Gesetzentwurf setzen wir
auf neue Instrumente. Familiengerichte sollen Gewalttäter
künftig zum Tragen einer elektronischen Fußfessel
verpflichten. Außerdem sollen sie Anti-Gewalttrainings
anordnen können. Ich bin überzeugt: Diese Maßnahmen machen im
Kampf gegen häusliche Gewalt einen echten Unterschied. Das
Beispiel Spanien zeigt: Die elektronische Fußfessel kann
Leben retten. Auch Anti-Gewalttrainings können Übergriffe
verhindern. Der heutige Gesetzentwurf setzt konsequent auf
eine bessere Prävention von häuslicher Gewalt – und dieses
Ziel werden wir als Bundesregierung auch weiterhin mit
Entschiedenheit verfolgen.“
Der heute beschlossene
Gesetzentwurf sieht vornehmlich Änderungen des
Gewaltschutzgesetzes vor. Das Gewaltschutzgesetz wird von den
Familiengerichten angewendet. Familiengerichte können danach
auf Antrag von Betroffenen Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt
und Nachstellung erlassen. Insbesondere können sie eine
Gewaltschutzanordnung erlassen, die einem Gewalttäter zum
Beispiel verbietet, die Wohnung der von ihm bedrohten Person
zu betreten oder sich der bedrohten Person zu nähern. Das
Gewaltschutzgesetz ergänzt den Gewaltschutz durch das
Polizeirecht und das Strafrecht.
Konkret sieht der
Gesetzentwurf folgende Neuerungen vor:
Elektronische
Fußfessel zur Durchsetzung von Annäherungsverboten
Familiengerichte sollen Gewalttäter künftig in
Hochrisikofällen zum Tragen einer elektronischen Fußfessel
verpflichten können. Mit der elektronischen Fußfessel soll
sichergestellt werden, dass Gewalttäter
Gewaltschutzanordnungen (also insbesondere
Annäherungsverbote) befolgen bzw. dass sie dagegen nicht
unbemerkt verstoßen können.
Gewaltbetroffenen
Personen soll auf Wunsch ein Zweitgerät zur Verfügung
gestellt werden, das anzeigt, wenn der Täter sich dem Opfer
unerlaubt nähert. Vorgesehen ist, dass die Stelle, die die
elektronische Fußfessel technisch überwacht, automatisch
alarmiert wird, wenn der gerichtlich festgelegte
Mindestabstand zwischen Gewalttäter und Opfer unterschritten
wird. Die Überwachungsstelle kann das Opfer dann umgehend
warnen und die örtlich zuständige Polizeibehörde informieren,
sofern dies erforderlich erscheint. Die Änderung soll auch im
Eltern-Kind-Verhältnis gelten.
Soziale Trainingskurse
und Gewaltpräventionsberatungen
Familiengerichte sollen
die Möglichkeit bekommen, Gewalttäter zur Teilnahme an
sozialen Trainingskursen, etwa Anti-Gewalt-Trainings, zu
verpflichten. Den Tätern sollen Lösungswege aufgezeigt
werden, Konflikte künftig gewaltfrei zu lösen. Die Änderung
soll auch im Eltern-Kind-Verhältnis gelten.
Ist eine
Teilnahme eines Täters an einem sozialen Trainingskurs nicht
geeignet, etwa weil der Täter keine Bereitschaft zur
Mitarbeit zeigt, soll es zusätzlich möglich sein, ihn zu
einer Gewaltpräventionsberatung zu verpflichten. Dies kann
sinnvoll sein, um den Täter zur Teilnahme an einem sozialen
Trainingskurs zu motivieren.
Höhere Strafen für
Verstöße gegen Gewaltschutzanordnungen
Verstöße gegen
Gewaltschutzanordnungen (also insbesondere
Annäherungsverbote) sollen schärfer geahndet werden können.
Das Höchstmaß der möglichen Freiheitsstrafe soll von zwei auf
drei Jahre angehoben werden.
Einholung von Auskünften
aus dem Waffenregister
Familiengerichte sollen künftig
Auskünfte aus dem Waffenregister einholen dürfen. Das dient
der verbesserten Gefährdungsanalyse in Gewaltschutz- und
Kindschaftssachen.
|
|
Bundesregierung beschließt Rechtskreiswechsel
ukrainischer Geflüchteter. |
|
Leistungsrechtsanpassungsgesetz im
Kabinett beschlossen
Berlin, 19. November 2025
- Das Bundeskabinett hat am 19. November
2025 beschlossen, den Entwurf des
Leistungsrechtsanpassungsgesetzes in den Deutschen Bundestag
einzubringen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Geflüchtete
aus der Ukraine mit Aufenthaltsrecht nach der
„Massenzustromrichtlinie“, die nach dem
1. April 2025
eingereist sind, bei Bedürftigkeit Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.
Sie werden
damit den Menschen gleichgestellt, die aus anderen Ländern
und anderen Gründen als Geflüchtete zu uns kommen. Derzeit
erhalten Menschen aus der Ukraine bei Bedürftigkeit
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder, wenn
sie nicht erwerbsfähig sind, Leistungen der Sozialhilfe.
Viele aus der Ukraine geflüchtete Menschen zahlen bereits
heute in die Sozialkassen ein, lindern den Fachkräftemangel
und bringen sich in unsere Gesellschaft ein. Auch mit dem
Rechtskreiswechsel bleibt es das Ziel der Bundesregierung die
schnelle und nachhaltige Integration in Arbeit und
Gesellschaft zu ermöglichen. Arbeitsfähige, nicht
erwerbstätige Geflüchtete werden mit dem Gesetz verpflichtet,
sich umgehend um eine Erwerbstätigkeit zu bemühen.
Die Arbeitsagenturen werden sie hierbei unterstützen. Zeigen
die Geflüchteten keine Eigenbemühungen, soll ihnen eine
Arbeitsgelegenheit zugewiesen werden. Falls eine Vermittlung
in Arbeit wegen fehlender Sprachkenntnisse nicht möglich ist,
sollen die Geflüchteten zur Teilnahme an einem
Integrationskurs verpflichtet werden.
Der
Rechtskreiswechsel wird für die Leistungsberechtigten wie
auch für die Verwaltungen möglichst aufwandsarm und
praktikabel erfolgen. Hierzu enthält der Gesetzentwurf
Übergangsregelungen, um aufwändige Erstattungsverfahren zu
vermeiden.
|
|
- Bund unterstützt
Städtebauförderung mit 1 Milliarde Euro
-
Bundesbauministerin: Gute Nachrichten für
den Wohnungsbau!
|
|
Bund unterstützt
Städtebauförderung mit 1 Milliarde Euro – Neue
Verwaltungsvereinbarung für 2026/2027 unterzeichnet
Berlin/Duisburg, 18. November 2025 - Die
Städtebauförderung in Deutschland bekommt einen kräftigen
Schub. Ab 2026 stellt der Bund erstmals 1 Milliarde Euro für
die städtebauliche Entwicklung zur Verfügung. Damit weitet
die Bundesregierung im Vergleich zum Jahr 2025 die
bundeseitige Unterstützung um 210 Millionen Euro aus. Bis zum
Ende der Legislaturperiode ist beabsichtigt, die Förderung
auf insgesamt 1,58 Milliarden Euro zu erhöhen.
Damit
setzt die Bundesregierung ein klares Signal für eine
nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung unserer Städte und
Gemeinden. Heute hat Bundesbauministerin Verena Hubertz dazu
die Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung für die
Jahre 2026 und 2027 (VV 2026/2027) unterzeichnet und den
Gegenzeichnungsprozess durch die Länder eingeleitet.
Mit der Verwaltungsvereinbarung legen Bund und Länder den
rechtlichen Grundstein für eine verlässliche Förderung in
2026 und 2027 und garantieren den Kommunen damit die
notwendige Planungssicherheit.
Dazu Verena Hubertz,
Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen:
„Städte sind das Herzstück unserer Gesellschaft. Sie bieten
nicht nur Raum für Wirtschaft und Kultur, sondern sind auch
Orte des sozialen Miteinanders und der Innovation.

Foto Markus C. Hurek
Mit der Städtebauförderung
schaffen wir die Voraussetzungen, dass unsere Städte
lebendig, nachhaltig und zukunftsfähig bleiben, für uns und
für kommende Generationen. Die Bereitstellung von 1 Milliarde
Euro für 2026 und der geplante Anstieg auf fast 1,6
Milliarden Euro unterstreichen die hohe Bedeutung der
Städtebauförderung.
Ob barrierefreie Plätze, einladende
Quartiere oder nachhaltige Stadtentwicklung, mit dieser
Förderung unterstützen wir Städte und Kommunen dabei, sich
den Herausforderungen der Zukunft zu stellen und gleichzeitig
soziale Vielfalt und Lebensqualität zu sichern. Umso mehr
freue ich mich, mit der Unterzeichnung der
Verwaltungsvereinbarung 2026/2027 durch den Bund dafür den
Grundstein für eine erfolgreiche Städtebauförderung 2026 und
2027 zu legen.“
Neben der Erhöhung der Mittel
bringt die neue Verwaltungsvereinbarung auch Verbesserungen
in der Umsetzung der Förderprogramme. So sollen bürokratische
Hürden abgebaut sowie Planungs- und Nachweisvorgaben
vereinfacht und flexibel gestaltet werden. Diese Änderungen
sollen den Städten und Gemeinden ermöglichen, schneller und
zielgerichteter auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren.
Bund und Länder bekräftigen mit der
Verwaltungsvereinbarung 2026/2027 zudem, verstärkt innovative
und experimentelle Vorhaben zu fördern. Mit der
Verwaltungsvereinbarung 2026/2027 setzen Bund und Länder
gemeinsam auf eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung, die
die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt und
gleichzeitig die Grundlagen für eine klimagerechte und
nachhaltige Stadtentwicklung schafft. Mehr Informationen zur
Städtebauförderung finden Sie unter:
https://www.staedtebaufoerderung.info/DE/Startseite/startseite_node.html
Bundesbauministerin: Gute Nachrichten für
den Wohnungsbau!
Verena Hubertz: "Im September
2025 wurden fast 60% mehr Wohnungen genehmigt als ein Jahr
zuvor. Das zeigt deutlich, dass es nun endlich aufwärts geht.
Damit aus Planungen auch gebaute Häuser werden, fördern wir
ab Mitte Dezember das Abschmelzen des Bauüberhangs mit 800
Millionen Euro. Bauherren, die ein genehmigtes Bauprojekt in
der Schublade haben, können mit Förderzusage direkt
loslegen.“
Baugenehmigungen für
Wohnungen im September 2025: +59,8 % zum Vorjahresmonat
+14,2 % bei Wohngebäuden insgesamt
+17,4 %
bei Einfamilienhäusern
-2,8 % bei Zweifamilienhäusern
+13,0 % bei Mehrfamilienhäusern
Im September 2025
wurde in Deutschland der Bau von 24 400 Wohnungen genehmigt.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das
59,8 % oder 9 100 Baugenehmigungen mehr als im September
2024. Der große Anstieg ist unter anderem dadurch zu
erklären, dass im September 2024 mit 15 300 genehmigten
Wohnungen der niedrigste Monatswert seit Januar 2012
verzeichnet worden war.
Die Zahl der genehmigten
Wohnungen im Neubau stieg im September 2025 gegenüber
September 2024 um 80,1 % oder 9 300 auf 20 900. Die Zahl
genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender
Gebäude entstehen, sank im September 2025 gegenüber dem
Vorjahresmonat um 4,9 % oder 180 auf 3 500.
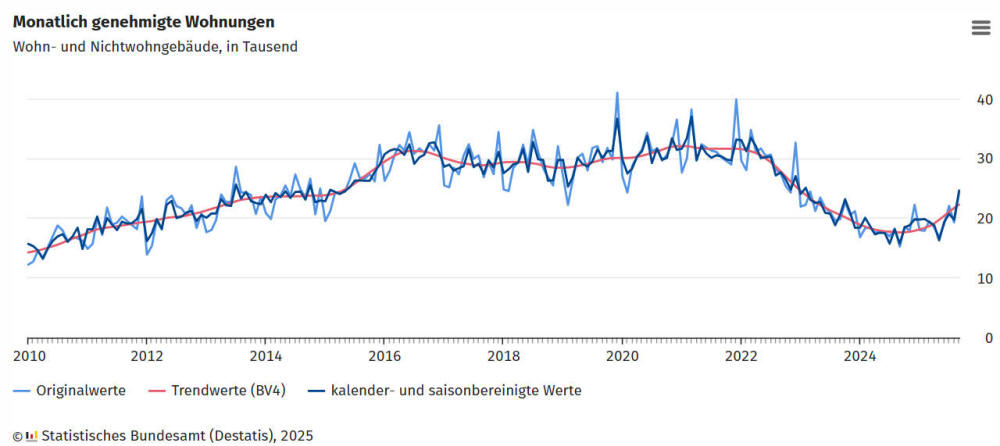
Januar bis September 2025: Aufwärtstrend bei
Einfamilienhäusern hält an
Im Zeitraum von Januar bis
September 2025 wurde in Deutschland der Bau von 175 600
Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden
genehmigt. Das waren 11,7 % oder 18 400 Wohnungen mehr als
von Januar bis September 2024.
In neu zu errichtenden
Wohngebäuden wurden von Januar bis September 2025 insgesamt
142 600 Wohnungen genehmigt, das waren 14,2 % oder 17 800
Neubauwohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg
die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 17,4 %
(+4 900) auf 33 300.
Bei den Zweifamilienhäusern sank
die Zahl genehmigter Wohnungen um 2,8 % (-270) auf 9 500. In
Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart,
genehmigten die Bauaufsichtsbehörden 93 100 Neubauwohnungen.
Das war ein Anstieg um 13,0 % (+10 700) gegenüber dem
Vorjahreszeitraum.
Die Zahl der genehmigten Wohnungen
in Wohnheimen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um
55,9 % (+2 400) auf 6 700 Wohnungen. In neuen
Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis September 2025
insgesamt 3 100 Wohnungen genehmigt (-14,5 %; -520).
Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen in
Schulgebäuden oder Wohnungen in Innenstadtlagen über
Gewerbeflächen.
Als Umbaumaßnahme in bestehenden
Wohn- und Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis September
2025 insgesamt 29 900 Wohnungen genehmigt, das waren 3,9 %
oder 1 100 Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres
2024.
|
|
Stahldialog im Bundeskanzleramt:
Wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige
Stahlindustrie
|
|
Berlin, Donnerstag, 6. November 2025 -
Bundeskanzler Friedrich Merz hat heute hochrangige
Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Stahlunternehmen
und der Arbeitnehmerseite, Ministerpräsidentinnen und
Ministerpräsidenten der Länder sowie die zuständigen
Bundesministerinnen und Bundesminister zu einem Stahldialog
im Bundeskanzleramt empfangen.
Im Mittelpunkt stand
dabei die Frage, wie die Stahlindustrie zukunftsfest gemacht
wird. Neben der notwendigen Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit geht es gleichzeitig darum, die
Industrie besser vor globalen Überkapazitäten und unfairen
Handelspraktiken internationaler Wettbewerber zu schützen.
Die Diskussionen drehten sich dabei um zentrale Anliegen der
Stahlindustrie, wie die Verschärfung des europäischen
Handelsschutzes, die Senkung der hohen Energiekosten sowie
die Umstellung auf klimafreundlichere Produktionsverfahren.
Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Bewältigung
dieser Herausforderungen eine wichtige Voraussetzung dafür
ist, Wertschöpfung und Beschäftigung in der Stahlindustrie zu
sichern und ihren Weg zur Klimaneutralität erfolgreich
weiterzuverfolgen.
Bundeskanzler Merz erklärte: „Die
Stahlindustrie ist von großer Bedeutung für unseren
Wirtschaftsstandort. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zum
Erhalt industrieller Wertschöpfungsketten und
wirtschaftlicher Resilienz in Deutschland und Europa. Wir
brauchen deshalb eine echte Stahl-Strategie, die in dem
heutigen Dialog ihren Ausgangspunkt gefunden hat.
Ziel ist es, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die
Branche zu schaffen.
Dabei geht es uns nicht alleine
darum, die Stahlindustrie einfach nur zu erhalten, sondern
wir wollen diese auch dabei begleiten, sich für die Zukunft
erfolgreich aufzustellen. Denn nur mit wettbewerbsfähigen
Unternehmen werden wir Produktivität und Arbeitsplätze in der
Stahlindustrie langfristig sichern.“
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil erklärte: „Wir kämpfen
dafür, dass die Stahlindustrie in Deutschland eine Zukunft
hat. Die Sicherung von Industriestandorten und Arbeitsplätzen
in Deutschland hat für uns oberste Priorität. Wir müssen die
Energiekosten weiter senken und die Wettbewerbsbedingungen
verbessern. Außerdem müssen wir unsere Industrie schützen und
eine deutliche europäische Antwort auf weltweite
Überkapazitäten und Dumpingpreise geben.
Wir wollen einen klaren Fokus auf
klimafreundlichen Qualitätsstahl aus Deutschland und Europa.
Für unsere Infrastruktur und Verteidigung, in der
Autoindustrie und in anderen wichtigen Bereichen wollen wir,
dass vorrangig heimischer und europäischer Stahl eingesetzt
wird.“
Große Anpassungsfähigkeit der Stahlindustrie
und ihrer Beschäftigten
Der Bundeskanzler hob die große
Anpassungsfähigkeit der Branche und ihrer Beschäftigten
hervor: „Die Stahlindustrie hat bereits in der Vergangenheit
bewiesen, dass sie sich mit großem Mut und Veränderungswillen
an sich wandelnde Rahmenbedingungen anpassen kann. Einen
wichtigen Anteil daran haben ihre engagierten Beschäftigten,
die sich diesen Veränderungen offen stellen und innovative
Produkte und Technologien entwickeln. Darauf gilt es
aufzusetzen, wenn es um die Zukunft der Stahlindustrie geht.“
Bundesfinanzminister Klingbeil betonte, dass auch die
Unternehmen in der Pflicht seien, ihren Beitrag zum Erfolg
der Branche zu leisten: „Wir setzen uns massiv ein für den
Stahl als Schlüsselindustrie in Deutschland. Wir haben aber
auch eine klare Erwartung an die Unternehmen, ihre Standorte
zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten. Wir brauchen
Beschäftigungs- und Standortsicherungsvereinbarungen.“
Verbesserter Handelsschutz für die Stahlindustrie
Die
Teilnehmer waren sich einig, dass es konsequenter Maßnahmen
bedarf, um die negativen Auswirkungen globaler
Überkapazitäten und drohender Handelsumleitungen auf den
EU-Markt zu adressieren. Die Bundesregierung setzt sich für
einen effektiven und langfristig wirksamen Schutz gegen die
negativen Auswirkungen globaler Überkapazitäten und
marktverzerrende Praktiken internationaler Wettbewerber ein.
Hierzu muss die EU ihre handelspolitischen Möglichkeiten
ausschöpfen.
Es braucht eine robuste, ausbalancierte
und WTO-rechtskonforme Nachfolgeregelung für die am 30. Juni
2026 auslaufenden Safeguards. Wo rechtlich möglich und im
gesamtwirtschaftlichen Interesse der Europäischen Union,
müssen Handelsschutzinstrumente gegen Dumping oder
Subventionen gezielt und wirksam angewendet werden, um die
derzeitigen Importmengen signifikant zu reduzieren. Vor
diesem Hintergrund begrüßt die Bundesregierung das von der
Europäischen Kommission am 7. Oktober 2025 vorgeschlagene
neue Instrument, das die bestehenden Schutzmaßnahmen für den
Stahlsektor ersetzen soll.
Darüber hinaus unterstützt
die Bundesregierung die Bemühungen der Kommission für rasche
Erleichterungen bei den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium,
einschließlich Derivaten, sodass europäische Waren über ein
angemessenes Zollkontingent möglichst zollfrei in die USA
exportiert werden können.
Ausnahmen bei den
Sanktionen ermöglichen es Russland aktuell, in signifikantem
Umfang bestimmte Stahlprodukte (Halbzeug) in die EU zu
exportieren. Die Bundesregierung wird sich deshalb weiter und
intensiv dafür einsetzen, bestehende Sanktionsausnahmen
schnellstmöglich zu beenden. Alle Sanktions-Umgehungen werden
noch konsequenter verfolgt und bestraft.
Die
Bundesregierung ist sich mit der Stahlindustrie einig, dass
der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) als wirksamer
Schutz gegen Carbon Leakage von der EU-Kommission
weiterentwickelt werden soll. Die Bundesregierung sieht eine
hohe Dringlichkeit für die Vorlage entsprechender Vorschläge.
Ziel ist es, das System insgesamt zu vereinfachen und
Umgehungsmöglichkeiten im Stahlsektor zu verhindern. Im
Rahmen der Weiterentwicklung des CBAM setzt sich die
Bundesregierung für eine Erweiterung auf nachgelagerte
Stahlprodukte („Downstream“) ein und fordert die Kommission
auf, zeitnah ein Modell für einen WTO-konformen
Exportausgleich vorzulegen.
Sollte ein effektiver
Carbon Leakage-Schutz über den CBAM bzw.
Kompensationszahlungen nicht gelingen, soll die
Wettbewerbsfähigkeit weiterhin über die kostenfreie Zuteilung
von Zertifikaten geregelt werden. Der Europäische
Emissionshandel gibt einen sicheren und verlässlichen Rahmen
für die Transformation und einen klaren Pfad in Richtung
Klimaneutralität. Nach Beschluss des 2040-Klimaziels setzt
sich die Bundesregierung dafür ein, den ETS am neuen Ziel
auszurichten und den linearen Reduktionsfaktor im ETS so
anzupassen, dass auch nach 2039 Zertifikate in den Markt
kommen.
Senkung der Energiekosten
Ein verlässliches
und bezahlbares Angebot an Energie ist essentiell für die
dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Industrien
wie der Stahlindustrie. Deshalb wird die Bundesregierung die
Energiewende vorantreiben, effizienter machen und dabei vor
allem Systemkosten senken. Das Energieangebot wird konsequent
ausgeweitet.
Ein zentrales Anliegen der
Bundesregierung ist die Senkung der Energiekosten für die
Industrie. Dazu hat die Bundesregierung bereits verschiedene
Maßnahmen auf den Weg gebracht, von denen Unternehmen der
Stahlindustrie profitieren. Hierzu zählen etwa die
Abschaffung der Gasspeicherumlage, die Reduzierung der
Stromsteuer auf das europäische Minimum und die Senkung der
Übertragungsnetzentgelte, allein im Jahr 2026 um 6,5
Milliarden Euro. Darüber hinaus setzt sich die
Bundesregierung bei der Europäischen Kommission für weitere
Entlastungsmöglichkeiten ein, um die Wettbewerbsfähigkeit der
Stahlindustrie zu erhalten und ihren Weg hin zu
Klimaneutralität fortzusetzen.
Konkret soll die
sogenannte Strompreiskompensation ausgeweitet sowie ein
Industriestrompreis umgesetzt werden. Anders als der
Industriestrompreis würde die Strompreiskompensation für die
Stahlindustrie durch die von der Bundesregierung ausdrücklich
geforderte Erhöhung der Beihilfeintensität zusätzlich
entlastende Wirkung entfalten.
Beim
Industriestrompreis geht es um ein neues ergänzendes
Instrument für die anderweitig nicht weiter zu entlastenden
energieintensiven Unternehmen. Hier setzt sich die
Bundesregierung für eine bürokratiearme Umsetzung des
Beihilferahmens ein.
Unterstützung für eine
innovative Stahlproduktion
Die Bundesregierung steht zu
Ihrer Unterstützung der Stahlindustrie bei der Umstellung auf
innovative Produktionsverfahren. Die Förderung erfolgt u.a.
über die Bundesförderung Industrie und Klimaschutz (BIK) und
die CO2-Differenzverträge (Klimaschutzverträge) bzw. das
IPCEI Wasserstoff. Zugleich sehen die Verträge vor, dass vom
Zuwendungsempfänger ein tragfähiges Konzept zum
Standorterhalt und zur Beschäftigungsentwicklung in Bezug auf
das transformative Produktionsverfahren verfolgt wird.
Auch die anderen Förderprogramme zur
Dekarbonisierung der Industrie werden an Vereinbarungen zu
Standortsicherung und Beschäftigungsentwicklung geknüpft, um
sicherzustellen, dass auch langfristig auf die Wertschöpfung
und den Arbeitsmarkt in Deutschland eingezahlt wird.
Im Hinblick auf den Einsatz von Wasserstoff für die
Stahlproduktion wird die Bundesregierung den Hochlauf der
Wasserstoffwirtschaft pragmatisch voranbringen. Für die
Dekarbonisierung der Stahlindustrie zu einer
klimafreundlichen Produktion muss bezahlbarer Wasserstoff in
ausreichenden Mengen verfügbar sein. Angesichts des
verzögerten Hochlaufs grünen Wasserstoffs drängt die
Bundesregierung auf mehr Pragmatismus bei den europäischen
Förderkriterien in der Phase des Markthochlaufs.
Hierzu gehört auch die Forderung nach mehr Flexibilität bei
der Nutzung von Gas statt Wasserstoff in der Stahlproduktion
für die im Rahmen der EU-Förderinitiative Important Projects
of Common European Interest (IPCEI) geförderten Projekte. Die
Bundesregierung wird den rascheren Ausbau des
Wasserstoffkernnetzes vorantreiben, damit Anlagen zur
Stahlherstellung möglichst schnell und in den vereinbarten
Zeitplänen angeschlossen werden.
Darüber hinaus waren
sich die Teilnehmer über das hohe Potenzial der
Kreislaufwirtschaft für die Stahlbranche einig. Hierfür
bedarf es effektiver und innovativer Recyclingstrukturen.
Im Rahmen der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie
wird die Bundesregierung den Fokus neben dem Umwelt- und
Klimaschutz auch auf die Resilienzstärkung durch heimische
Produktion legen. Sofern die Versorgung mit Stahlschrott als
Rohstoff für die Stahlproduktion gefährdet ist, wird sich die
Bundesregierung auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass
erforderliche Maßnahmen ergriffen werden, damit ausreichend
Stahlschrott verfügbar ist.
EU Leitmärkte, EU
Präferenz-Regelungen
Die Bundesregierung unterstützt die
Schaffung und Förderung europäischer Leitmärkte für
klimafreundlichen Stahl. Sie wird die Verordnungsermächtigung
im Rahmen des Vergabebeschleunigungsgesetzes nutzen und
Anforderungen an die Klimafreundlichkeit bei der Beschaffung,
u. a. von Stahl, zeitnah nach Inkrafttreten des Gesetzes in
einer Rechtsverordnung vorzugeben. Die Bundesregierung
unterstützt auch die Pläne der EU-Kommission zur Etablierung
von Leitmärkten im Rahmen des Industrial Accelerator Act,
beginnend mit einem Leitmarkt für klimafreundliche
Stahlprodukte.
Der Fokus könnte dabei auf der
staatlichen Infrastruktur, wie zum Beispiel bei öffentlichen
Bau- und Infrastrukturvorhaben, u.a. der Bahn und auch der
Automobilindustrie liegen. Dabei sollen Resilienz- und
Nachhaltigkeitskriterien wie CO2-Emissionsintensität gelten.
In der deutsch-französischen Wirtschaftsagenda ist für
zentrale und kritische strategische Bereiche der
industriellen Produktion, einschließlich der öffentlichen
Beschaffung, eine rechtlich tragfähige und zielgerichtete
EU-Präferenz-Regelung dargelegt.
Die Bundesregierung
setzt sich für die Nutzung des Labels für klimafreundlichen
Stahl „Low Emission Steel Standard (LESS)“ ein, um neben
öffentlichen auch privatwirtschaftliche Leitmarktinitiativen
in einer transparenten und bürokratiearmen Weise zu
ermöglichen. Auf internationaler Ebene führt die
Bundesregierung ihre Führungsrolle im Klimaclub fort, um die
internationale Kooperation in der Dekarbonisierung der
energieintensiven Industrie zu verbessern, einheitliche
Regeln und Standards für die Grünstahlproduktion zu
entwickeln und gemeinsame Leitmärkte zu erschließen. Auch die
Erschließung neuer Märkte wie die Sicherheits- und
Verteidigungsindustrie kam zur Sprache.
In Zeiten
geopolitischer Spannungen sowie Lieferkettenunterbrechungen
dürfen sich Deutschland und Europa in kritischen
Wirtschaftsbereichen wie dem Sicherheits- und
Verteidigungssektor nicht allein auf Importe verlassen.
Grundstoffindustrien wie die Stahlproduktion werden so zu
einem Pfeiler wirtschaftlicher Resilienz. Die Bundesregierung
wird dafür Möglichkeiten zur Anpassung der Vergabekriterien
für den Sicherheits- und Verteidigungssektor prüfen.
Mit der Schaffung und Erschließung neuer Märkte geht zugleich
die Anforderung an Unternehmen einher, sich flexibel auf neue
Herausforderungen einzustellen und zugleich langfristig an
der eigenen Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten. Zu einer
zukunftsfesten Perspektive gehören insbesondere Investitionen
in Standorte, neue Produktionsverfahren und Produkte sowie
die Qualifizierung der Beschäftigten.
|
|