






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 41. Kalenderwoche:
8. Oktober
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 9. Oktober 2025
Beratungsstellen im Stadthaus am 9. Oktober geschlossen
Die Ausgabestelle für Parkausweise und die Bauberatung
im Stadthaus am Friedrich-Albert-Lange-Platz sind am Donnerstag, 9.
Oktober, ganztägig aufgrund einer internen Dienstveranstaltung
geschlossen. Am Freitag, 10. Oktober, stehen die Dienststellen
wieder wie gewohnt zu den normalen Öffnungszeiten zur Verfügung. Die
Stadt Duisburg bittet um Verständnis.
Feuerwehr Duisburg sucht Verstärkung – Ausbildung
zum Notfallsanitäter
Die Feuerwehr Duisburg sucht
wieder engagierte Nachwuchskräfte, die sich für eine fundierte
Ausbildung zur Notfallsanitäterin und zum Notfallsanitäter
interessieren. Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sind
unverzichtbare Fachkräfte im Rettungsdienst.
Sie
leisten medizinische Erstversorgung direkt am Einsatzort, begleiten
Patientinnen und Patienten im Rettungswagen und unterstützen die
Notärztinnen und -ärzte bei lebensrettenden Maßnahmen. Die
abwechslungsreiche Ausbildung ist vielseitig und praxisnah
gestaltet. So werden wechselseitig theoretische sowie praktische
Schwerpunkte absolviert.
An der Akademie für Notfallmedizin
und Rettungswesen findet die theoretische und fachpraktische
Ausbildung statt. Der praktische Teil der Ausbildung wird im
Schichtdienst an den Lehrrettungswachen durchgeführt. Hierzu gehört
unter anderem der Einsatz im Rettungsdienst und Krankentransport. In
der klinischen Ausbildung werden praktische Fähigkeiten und
Fertigkeiten im psychiatrischen und pädiatrischen Bereich sowie auf
Pflegestationen, der Notaufnahme, Intensivstation und im
Operationssaal erlernt und gefestigt.
Um auch die
Einsatzfahrzeuge führen zu können, ist im Zuge der Ausbildung der
Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C vorgesehen. Nach erfolgreichem
Abschluss bestehen für die Absolventinnen und Absolventen beste
Übernahmechancen in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis bei
der Feuerwehr Duisburg, mit vielfältigen Weiterentwicklungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten.
Bei persönlicher Eignung kann zudem
eine weiterführende Ausbildung zum Brandmeister angeschlossen
werden. Wer Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein und Interesse an
Medizin mitbringt, kann sich noch bis zum 19. Oktober bewerben. Das
Auswahlverfahren besteht aus einem Sporttest, einem schriftlichen
Test, einem persönlichen Vorstellungsgespräch sowie einer
medizinischen Untersuchung.
Der Sporttest findet am Samstag,
8. November, um 10 Uhr an der Feuerwehrschule, auf dem Gelände der
Feuer- und Rettungswache an der Rheindeichstraße 22 in
Duisburg-Homberg, statt. Die Bewerbungsunterlagen können ganz
einfach per E-Mail an recruiting@feuerwehr.duisburg.de gesendet
werden. Bei Rückfragen hilft Sylvia Belaic von der Feuerwehr
Duisburg telefonisch (0203/308-2129) weiter. Aber auch für alle
Unentschlossenen bietet sich noch die Möglichkeit, ohne vorherige
Bewerbung am Auswahlverfahren teilzunehmen.
Hierzu lediglich
am 8. November mit Sportkleidung und Unterlagen an die
Rheindeichstraße kommen und den sportlichen Eignungstest
absolvieren. Alle Informationen zum Berufsbild, den Voraussetzungen
und erforderlichen Unterlagen gibt es auch online unter
https://duisburg.de/microsites/karriere/neu/dir-1/notfallsanitaeter-in.php
Aktionswoche zur Zahngesundheit: Kinder lernen die
Superkraft der Spucke kennen
Spucke hat Superkräfte.
Das erfahren diese Woche Grundschülerinnen und Grundschüler der GGS
Wanheim am Tollberg und die Maxikinder der benachbarten
Kindergärten. Der Arbeitskreis „Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg
e.V.“ ist dort noch bis Freitag, 10. Oktober, zu Gast, um den
Kindern das Thema „Mundgesundheit“ näherzubringen und zu erklären,
wie hilfreich Speichel doch sein kann.
Anlass der
Themenwoche ist der bundesweite „Tag der Zahngesundheit“ vom 25.
September. Er stand dieses Jahr unter dem Motto „Gesund beginnt im
Mund – Superkraft Spucke“. Zahlreiche Aktionen haben die Expertinnen
und Experten vorbereitet: An einem Zuckertisch gibt es Informationen
zur gesunden Ernährung mit einem Schwerpunkt auf den versteckten
hohen Zuckergehalt in Lebensmitteln.
Täglich wird ein
„zahnfreundliches“ Frühstück mit Milch, Mineralwasser, viel Obst und
Gemüse sowie belegten frischen Broten mit Käse und Wurst (kein
Schweinefleisch) aufgetischt. Im sogenannten „Karieszelt“ können die
Mädchen und Jungen ihre Zähne mit einem Tropfen fluoreszierender
Flüssigkeit anfärben.

„Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg e.V.“ den Schülern der GGS Am
Tollberg in Wanheim das Thema Mundgesundheit. Im Schwarzlicht werden
die Zähne kontrolliert, ob die vorher mit fluoriszierender Farbe
sichtbar gemachten Zahnbeläge weggeputzt wurden. Fotos Tanja
Pickartz / Stadt Duisburg
Im Schwarzlicht leuchten die Zahnbeläge hell auf. Im Anschluss
dürfen die Kinder ihre Zähne, besonders die kritischen Stellen,
unter Anleitung der gruppenprophylaktischen Mitarbeiterinnen
sauberputzen und den Putzerfolg erneut im Karieszelt kontrollieren.
In der Zahnwerkstatt bearbeiten die Kinder unter Fachanleitung
bereitgestellte Gipsmodelle, als seien sie echte Patientengebisse.

Unter Anleitung werden gemeinsam die Zähne geputz
Die
„Karies“ wird erkannt und mit Hilfe eines Bohrers entfernt. Danach
wird der betroffene Zahn mit einer Knete-Füllung repariert.
Zwischendurch können die Kinder Zahnpasta und zuckerfreies Müsli
selbst herstellen, Buttons basteln, malen und vielfältiges
Infomaterial zum Thema „Zahngesundheit“ anschauen. Zum Schluss wird
das Zahnwissensquiz, das schon im Vorfeld der Veranstaltung von den
Schülern bearbeitet und gelöst wurde, ausgewertet.
Alle
teilnehmenden Klassen werden mit einem Geldgeschenk für die
Klassenkasse belohnt. Durchgeführt wird die Aktionswoche vom
Arbeitskreis „Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg e. V.“ in
Zusammenarbeit mit dem Zahnärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes
der Stadt Duisburg und mit Unterstützung des Duisburger Frische
Kontors.
IHK ehrt die besten Azubis vom Niederrhein
- Abend im Zeichen starker Ausbildungserfolge
Mit
Spitzenpunktzahlen gehören 90 Auszubildende zu den Besten am
Niederrhein. Dazu gratulierte die Niederrheinische IHK am 7. Oktober
in Duisburg. Ein weiterer Grund zum Feiern: Der Niederrhein hat 344
neue Industriemeister und Fachwirte. Gemeinsam mit Familie und
Freunden feierten sie im Theater am Marientor.

Sorgten für mächtig gute Stimmung: Die Brassband Knallblech.
„Unsere besten Azubis sind echte Vorbilder. Sie zeigen, was mit
Neugier und Durchhaltevermögen möglich ist“, freut sich
IHK-Vizepräsidentin Susanne Covent-Schramm. „Wir würdigen heute
herausragende Leistungen. Und schätzen die Arbeit, die die jungen
Menschen in ihre Ausbildung gesteckt haben. Eine gute Ausbildung ist
der Schlüssel zum Erfolg.“
Das weiß auch Jolina Ridder. Sie hat ihre Ausbildung zur
Eisenbahnerin im Betriebsdienst mit Bestnoten abgeschlossen. „In der
Zugverkehrssteuerung hat jede Entscheidung direkte Auswirkungen.
Einen kühlen Kopf zu bewahren, habe ich in der Ausbildung gelernt.
Es ist ein ganz besonderer Moment für mich, dass die IHK mich nun
als Beste auszeichnet“, sagt Ridder.
Auch die Absolventen der
Fortbildung beweisen: Berufliche Weiterbildung ist eine Alternative
zum Studium. Als Meister, Fach- oder Betriebswirt eröffnen sich
ihnen beste Karriere- und Verdienstchancen. Covent-Schramm lobte
zudem das Engagement der Ausbilder, Betriebe, Berufsschulen und
Familien: „Sie sind die stillen Helden hinter dem Erfolg junger
Menschen. Ob im Betrieb, im Klassenzimmer oder am Küchentisch – ihr
Einsatz prägt Karrieren und Persönlichkeiten.“
IHK-Schulpreis geht an kreative Spieleentwickler
Am Abend wurde
auch der IHK-Schulpreis verliehen. Zwölf Schülerteams präsentierten
einer Jury ihre Geschäftsideen. Den mit 1.500 Euro dotierten Preis
gewann die Gesamtschule am Lauerhaas aus Wesel. Das Dreierteam „Devs
Playground“ überzeugte mit selbst entwickelten 2D-Pixelspielen im
Retro-Stil.

Gratulierten den „Besten“ zu ihre herausragenden Leistungen:
IHK-Vizepräsidentin Susanne Convent-Schramm und IHK-Vizepräsident
Frank Wittig.

Die Gewinner des diesjährigen Schulpreises: „Devs Playground“ der
Gesamtschule Lauerhaas aus Wesel.
Fotos: Niederrheinische IHK
/ Jacqueline Wardeski und Eugen Shkolnikov

Fortbildung schafft Perspektiven Oliver Bobrowski unter den besten
Absolventen am Niederrhein
Nach 20 Jahren Berufserfahrung
wagte Oliver Bobrowski den Schritt zurück auf die Schulbank. Und das
mit Erfolg: Er absolvierte die Fortbildung zum Industriemeister und
gehört zu den besten Absolventen in der Region. Im Gespräch mit der
Niederrheinischen IHK berichtet er von seinem Berufsweg. Warum haben
Sie sich für eine Fortbildung entschieden?
Als Schlosser habe
ich für mich keine echten Aufstiegschancen gesehen. Ich bin
praktisch veranlagt, kein Theoretiker. Genau deshalb war der
Industriemeister für mich die ideale Möglichkeit, mich
weiterzuentwickeln. Ich wollte mehr Verantwortung übernehmen und mir
neue Perspektiven schaffen.
Welchen Herausforderungen sind
Sie begegnet? Und wie sind Sie damit umgegangen? Nach 20 Jahren im
Berufsleben war es nicht leicht, wieder ins Lernen zu kommen. Ich
habe mich Schritt für Schritt herangetastet. Angefangen habe ich mit
Grundlagen, die ich schon kannte. Besonders geholfen hat mir meine
Frau. Sie hat mir den Rücken freigehalten und mich in schwierigen
Phasen aufgebaut. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen.
Was würden Sie anderen mit auf dem Weg geben? Was war Ihr
Erfolgsrezept, um Bester zu werden?
Ich hatte immer vor Augen:
Wenn ich etwas wirklich will, dann schaffe ich das auch. Erfolg ist
kein Glück – es ist harte Arbeit. Manche haben gezweifelt und mich
gefragt: ‚Wirklich, mit über 40 nochmal?‘.
Für mich war aber
klar: Das ist mein Ziel und ich werde es erreichen. Meine Motivation
und dass mein Umfeld mich so toll unterstützt hat, waren
entscheidend. Und wie fühlt es sich an, zu den Besten zu gehören?
Wie haben Sie davon erfahren? Ich konnte es zunächst kaum glauben.
Ich bin sehr stolz. Es zeigt mir: Es ist nie zu spät, etwas Neues zu
lernen und sich weiterzuentwickeln. Der Einsatz hat sich gelohnt. Im
November starte ich in meinen neuen Job. BU: Oliver Bobrowski
erzählt im Interview von seiner Fortbildung. Foto: Niederrheinische
IHK / Jacqueline Wardeski
Jolina Ridder über ihren
Erfolg auf ganzer Linie - IHK ehrt Ausbildungsbeste als
Zugverkehrssteuerin
Jolina Ridder aus Xanten gehört zu
den besten Auszubildenen am Niederrhein. Als Zugverkehrssteuerin bei
der DB Netz Aktiengesellschaft weiß sie genau, was es braucht, um
ans Ziel zu kommen. Bei ihr läuft alles zusammen – Weichen, Routen,
Zuglinien. Im Interview mit der Niederrheinischen IHK erzählt sie
von ihrem Weg zum Erfolg.

Jolina Ridder berichtet über ihre Ausbildung zur Eisenbahnerin.
Wie
kamen Sie zu der Ausbildung?
Über Umwege. Nach dem Abi wollte
ich als Au-pair ins Ausland. Dann kam Corona. Ich habe erstmal
verschiedene Nebenjobs ausprobiert. Aber der Wunsch nach etwas
„Richtigem“ wurde immer größer. Ein Freund erzählte mir von seiner
Ausbildung als Zugverkehrssteuerer. Spontan war meine Bewerbung
raus. Und die Zusage schnell da.
Wie war der Einstieg für
Sie?
Ein Sprung ins kalte Wasser. Schon in der dritten Woche
waren wir im Stellwerk. Dort sind viele Theorien und Fachbegriffe
auf uns eingeprasselt. Da kann es auch schonmal sein, dass man
unsicher wird: Schaffe ich das alles? Aber die praktische Arbeit hat
mir von Anfang an Spaß gemacht. Das hat mich angespornt.
Was
hat Ihnen in herausfordernden Zeiten besonders geholfen? Und was
nehmen Sie persönlich aus der Ausbildung mit?
Meine Kollegen
haben mich am meisten motiviert. Wir waren von Anfang an ein Team.
Sie hatten immer das Ziel, alle durch die Prüfung zu bringen. Der
Austausch untereinander hat mich enorm entlastet. Das hat mir
gezeigt, wie wichtig Gemeinschaft ist. Gleichzeitig habe ich
gelernt, widerstandsfähig zu bleiben. Auch wenn mal eine Prüfung
nicht gut lief galt: Ruhe bewahren, nicht den Kopf verlieren. Wer
sich früh mit der Theorie vertraut macht und sich im Team gut
aufgehoben fühlt, setzt sich weniger unter Druck. Und kommt so
leichter durch die Ausbildung.
Wie war es, als Sie erfahren
haben, dass Sie die Beste sind? Und was bedeutet das für Ihre
Zukunft?
Es war ein surrealer Moment. Bei der Notenvergabe in
der IHK hieß es plötzlich: „Sie sind die Ausbildungsbeste“. Trotz
offizieller Bestätigung ein halbes Jahr später: so ganz ist es immer
noch nicht angekommen. Aber ich freue mich sehr. Die guten Noten
haben mir den Weg zu meiner Traumstelle in Emmerich geöffnet. Einem
Stellwerk mit besonders anspruchsvollen Aufgaben. Hier treffen
internationale Verbindungen aus dem Ruhrgebiet und den Niederlanden
aufeinander. Das erfordert hohe Konzentration und präzise
Koordination. Und ich möchte weitergeben, was ich gelernt habe: In
Zukunft will ich selbst ausbilden und andere auf ihrem Weg
begleiten.
IHK-Gastgebercamp setzt Impulse - Tourismus und
Gastwirtschaft tauschen sich aus
Am 9. Oktober lädt
die Niederrheinische IHK gemeinsam mit der IHK Mittlerer Niederrhein
zum Gastgebercamp ins Home Duisburg ein. Von 10 bis 17 Uhr treffen
sich Akteure aus Tourismus und Gastwirtschaft. Das Erfolgsformat
findet bereits zum zehnten Mal statt. Ziel: Offene Gespräche führen,
Impulse setzen und gemeinsam Projekte starten.
Die
Konferenz findet als Barcamp statt: Statt klassischer Vorträge steht
der aktive Austausch im Fokus. Alle Teilnehmer können eigene Themen
und Fragen einbringen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde geht es
direkt in die Planung der sogenannten Sessions. Nachhaltigkeit,
Generationswechsel, Einsatz von Künstlicher Intelligenz oder
Mitarbeiterbindung – die meistgewählten Themen erhalten eine eigene
Diskussionsrunde.
Die Gestaltung ist frei: Egal ob lockeres
Gespräch, Präsentation oder Workshop. So entstehen die Inhalte
zusammen vor Ort und die Teilnehmer knüpfen untereinander wertvolle
Kontakte. Lediglich der Zeitplan ist vorgegeben. Interessierte
können sich unter
www.gastgebercamp-niederrhein.de kostenlos anmelden.
9. Oktober: Forschung trifft Praxis - Workshop zur
Wärmewende
Wie lassen sich Städte künftig
klimafreundlich heizen? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines
Workshops an der Universität Duisburg-Essen. Fachleute aus
Wissenschaft und Praxis sind eingeladen, am 9. Oktober über
Strategien für die Wärmewende in Ballungsräumen zu diskutieren – von
der kommunalen Planung bis zu neuen Technologien im Gebäudebestand.
Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung erforderlich.
Ohne die Umstellung der Heizsysteme wird Deutschland seine
Klimaziele nicht erreichen. Besonders in dicht besiedelten Städten
stellt dies eine große Herausforderung dar: Viele Gebäude sind alt,
Heizungen laufen noch mit Gas oder Öl, und Platz für neue Anlagen
ist knapp. Wie Lösungen aussehen können, erörtern Fachleute am
Donnerstag, 9. Oktober 2025, an der Universität Duisburg-Essen.
Der Workshop „Wie gelingt die Wärmewende in Ballungsräumen?“
findet von 9 bis 16 Uhr im Glaspavillon auf dem Essener Campus
statt. Eingeladen sind Fachleute, die beruflich mit Wärme zu tun
haben – von Energieversorgern über Wohnungsunternehmen bis zu
Planungsbüros.
Zum Auftakt spricht Prof. Dr. Christoph Weber
vom Lehrstuhl für Energiewirtschaft der UDE, gefolgt von einem
Einblick in die kommunale Wärmeplanung in Duisburg. Danach werden
Strategien zur Sanierung im Gebäudebestand und ein Online-Tool zur
Bewertung klimafreundlicher Heizungssysteme vorgestellt. Rechtliche
Rahmenbedingungen sowie Erfahrungen mit neuen Wärmeerzeugern stehen
ebenfalls auf dem Programm.
Der Workshop ist Teil des
Forschungsprojekts KliWinBa, das an der UDE koordiniert wird. Ziel
ist es, Optionen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung im
Gebäudebestand zu prüfen. Dabei geht es nicht nur um technische
Fragen, sondern auch um Kosten, Umbauzeiten und rechtliche
Rahmenbedingungen. Partner aus Energieversorgung und
Wohnungswirtschaft bringen ihre Erfahrung ein, damit Lösungen nicht
auf dem Papier bleiben, sondern in Quartieren und Stadtteilen
umgesetzt werden können.
Leistungen für Pflegeeltern
steigen im Jahr 2026
Viele Kinder benötigen dringend
Schutz und Förderung in einer Pflegefamilie. Die Pauschalbeträge für
Pflegeeltern steigen entsprechend der jährlich vom Deutschen Verein
für öffentliche und private Fürsorge e.V. veröffentlichten
Empfehlungen.
Pflegekinder erhalten nach dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Unterhalt vom zuständigen Jugendamt.
Der Unterhalt steht Pflegefamilien in Form von monatlichen
Pauschalen zu und umfasst unter anderem Kosten für den
Lebensunterhalt, einen Anerkennungsbetrag für die Erziehung und
Pflege der anvertrauten jungen Menschen sowie einen Beitrag zur
Alterssicherung der Pflegeperson.
Bei der Festsetzung der
Pauschalen orientieren sich die meisten Bundesländer an den
jährlichen Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Fortschreibung der
Pauschalbeträge in der Vollzeitpflege (§§ 33, 39 SGB VIII) und
setzen diese verbindlich um. „Was Pflegefamilien Tag für Tag für
ihre Pflegekinder leisten, ist in Geld gar nicht aufzuwiegen“,
betont Dr. Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge e.V.
„Für viele Kinder und
Jugendliche, die aufgrund von belastenden Lebenssituationen nicht
bei ihren leiblichen Eltern leben können, ist eine Pflegefamilie die
am besten geeignete Unterstützung. Bundesweit werden Pflegepersonen
dringender denn je gesucht. Umso wichtiger ist es, dass der
Unterhalt für Pflegekinder die Ausgaben von Pflegeeltern und deren
großes Engagement angemessen würdigt.“
Der Deutsche Verein
hat daher für das Jahr 2026 die Pauschalen für den Lebensunterhalt
und die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in einer
Pflegefamilie entsprechend der Steigerung der Verbraucherpreise
erhöht.
Für das Jahr 2026 empfiehlt der Deutsche Verein eine
Anhebung der monatlichen Pauschalbeträge entsprechend der
gestiegenen Lebenshaltungskosten. Daher stehen Pflegefamilien
folgende monatlichen Pauschalen zu:
für ein 0-6-jähriges
Pflegekind 1203 €
für ein 6-12-jähriges Pflegekind 1362 €
für
ein 12-18-jähriges Pflegekind 1511 €
Besondere Bedarfe der
Pflegekinder werden ggf. durch eine Erhöhung der Pauschalbeträge
ausgeglichen. Aufwendungen für die Alterssicherung der Pflegeperson
werden in der Regel zur Hälfte erstattet. Hinzu kommt die Erstattung
einmaliger Bedarfe wie Erstausstattung, Einschulung, Fahrrad usw.
sowie die Unfallversicherung der Pflegeeltern.
Die
Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge e.V. zur Fortschreibung der monatlichen Pauschalbeträge in
der Vollzeitpflege (§§ 33, 39 SGB VIII) für das Jahr 2026 sind unter
https://www.deutscher-verein.de/fileadmin/user_upload/dv/pdfs/Empfehlungen_Stellungnahmen/2025/DV-7-25_Pauschalbetraege_in_der_Vollzeitpflege.pdf
abrufbar.
Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
ist das gemeinsame Forum von Kommunen und Wohlfahrtsorganisationen
sowie ihrer Einrichtungen, der Bundesländer, der privatgewerblichen
Anbieter sozialer Dienste und von den Vertretern der Wissenschaft
für alle Bereiche der Sozialen Arbeit, der Sozialpolitik und des
Sozialrechts.
Er begleitet und gestaltet durch seine Expertise
und Erfahrung die Entwicklungen u.a. der Kinder-, Jugend- und
Familienpolitik, der Sozial- und Altenhilfe, der
Grundsicherungssysteme, der Pflege und Rehabilitation sowie der
Migration und Integration.
Kultur-
und Stadthistorisches Museum: Individuelle Figuren aus Ton gestalten
Das Kultur- und Stadthistorische Museum bietet am
Sonntag, 12. Oktober, von 12 bis 17 Uhr, am Johannes-Corputius-Platz
1 am Duisburger Innenhafen einen Workshop an, bei dem sich
individuelle Tonfiguren gestalten lassen. Künstlerin Katharina Nitz
zeigt den Teilnehmenden, wie aus Ton Schritt für Schritt kleine
Kunstwerke entstehen können.
Ob menschliche Figuren,
Fantasiewesen oder abstrakte Skulpturen – der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Zu einer kleinen Auszeit lädt auch das
Mercator-Café im Museum ein, wo heiße und kalte Getränke sowie
leckere Kuchen genossen werden können. Die Teilnahme am Workshop
sowie der Besuch der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung sind
kostenlos.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere
Informationen und das Programm des Kultur- und Stadthistorischen
Museums gibt es online unter
www.stadtmuseum-duisburg.de.
PLACE TO BE:
Fotografien Sven Kierst am 18.10.25 im Kolumbarium Rheinkirche in
Duisburg

Ausstellungseröffnung mit Künstler-Gespräch und
Begleitprogramm
Die Fotoarbeiten von Sven Kierst
beschäftigen sich mit der zu entdeckenden Eigenästhetik des
scheinbar Unauffälligen und Belanglosen. So ergeben sich Motive, die
zwischen figurativer und abstrakter Bildkomposition wechseln. Sie
entfernen sich dadurch vom ursprünglichen Zustand und sind davon
befreit. 
Kierst
liefert Suggestion als Anregung - nicht als Behauptung. Um 15.30 Uhr
beginnt unser Künstlergespräch mit Sven Kierst. Danach wird der
kanadische Fingerpicking-Gitarrist Don Alder ein Kurzkonzert geben,
um uns danach dezent im Hintergrund zu begleiten, während wir und
Sven Kierst miteinander reden und jeder die Fotos für sich entdecken
kann.

Fingerpicking-Gitarrist Don Alder
ANMELDUNG
Wollen Sie am Künstlergespräch teilnehmen, so bitten wir um eine
Anmeldung, damit wir besser planen können. Bitte nennen Sie uns auch
die Anzahl der Personen (MAX 4) Telefon: 02066 - 4690 179 (Di-So
11-16 Uhr - montags geschlossen) E-Mail:
veranstaltung@kolumbarium-rheinkirche.de Nach einer Anmeldung
per Mail erhalten Sie eine Bestätigung.
OHNE ANMELDUNG sind Sie
selbstverständlich auch als Spontanbesucher der Ausstellung
willkommen.
Achtsames Pilgern auf dem
niederrheinischen Jakobsweg: Einladung zum gemeinsamen
Entschleunigen
Entschleunigung, den Gedanken Raum
geben, die frische Luft genießen und neue Wege entdecken. Das ist
es, was eine Gruppe um Ines Auffermann aus der Evangelischen
Gemeinde Duisburg Hochfeld-Neudorf beim Pilgern regelmäßig entdeckt.
Nun laden sie Interessierte ein, am Samstag, 18. Oktober 2025, einen
weiteren Abschnitt des niederrheinischen Jakobsweges mitzugehen und
ähnliche Erfahrungen zu machen.
Der Weg beginnt diesmal in
Krefeld Linn und führt durch eine Landschaft, die durch den Rhein
geprägt ist. „Wir werden Altstromrinnen, Rheinschlingen, Nieder- und
Mittelterrassen sehen können und erleben wie sehr der Rhein unseren
Lebensraum in natürlicher Weise geformt hat“ verspricht Ines
Auffermann.
Für die 25 km bis nach Neuss ist eine Gehzeit
von knapp sechs Stunden eingeplant. Details zu Anfahrt und
Startpunkt gibt es bei Ines Auffermann, über die auch Anmeldungen
möglich sind (ines.auffermann@ekir.de). Infos zur Gemeinde gibt es
im Netz unter www.hochfeld-neudorf.de.

Erneut Rekordeinnahmen: 430 Millionen Euro aus
Hundesteuer im Jahr 2024
Städte und Gemeinden erzielen
2,2 % mehr Hundesteuer-Einnahmen als im Vorjahr, im
Zehnjahresvergleich beträgt der Zuwachs sogar 39,3 %
Hunde- und
Katzenfutter im Jahr 2024 um 2,3 % teurer als im Vorjahr und um
35,3 % teurer als im Jahr 2020
Hundehaltung bringt dem Staat
stetig wachsende Einnahmen. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) anlässlich des Welthundetags am 10. Oktober 2025
mitteilt, nahmen die öffentlichen Kassen im Jahr 2024 rund
430 Millionen Euro aus der Hundesteuer ein – ein neuer Rekordwert.
Für die Städte und Gemeinden bedeutete dies ein Plus von 2,2 % im
Vergleich zum Vorjahr (2023: 421 Millionen Euro). Die Einnahmen aus
der Hundesteuer sind in den letzten Jahren durchgehend gestiegen, im
Zehnjahresvergleich betrug der Zuwachs 39,3 %: 2014 hatte die
Hundesteuer den Städten und Gemeinden noch rund 309 Millionen Euro
eingebracht.
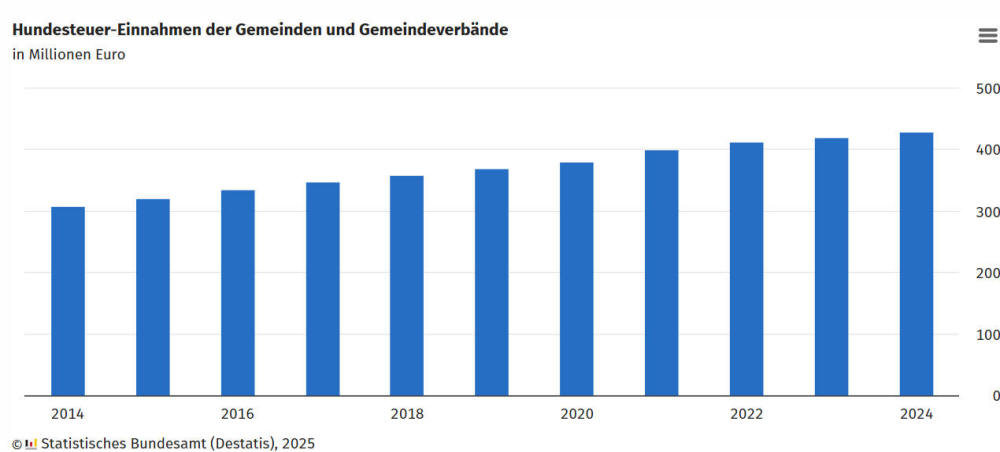
Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine Gemeindesteuer. Höhe und
Ausgestaltung der Steuersatzung bestimmt die jeweilige Kommune.
Vielerorts hängt der Betrag, den die Hundebesitzerinnen und
-besitzer entrichten müssen, auch von der Zahl der Hunde im Haushalt
oder von der Hunderasse ab. Insofern bedeuten höhere Steuereinnahmen
nicht zwangsläufig, dass auch die Zahl dieser vierbeinigen Haustiere
gestiegen ist.
Preise für Hunde- und Katzenfutter steigen im
mittelfristigen Vergleich deutlich
Die Haltung eines Vierbeiners
ist auch jenseits der Steuerzahlungen ein Kostenfaktor. Die Preise
für Hunde- und Katzenfutter stiegen im Jahresdurchschnitt 2024 um
2,3 % gegenüber dem Vorjahr.
Die Gesamtteuerung lag im
selben Zeitraum bei 2,2 %. Im mittelfristigen Vergleich lagen die
Verbraucherpreise von Hunde- und Katzenfutter im Jahresdurchschnitt
2024 um 35,3 % höher als 2020. Damit stiegen die Preise für Hunde-
und Katzenfutter überdurchschnittlich. Die Verbraucherpreise
insgesamt stiegen in diesem Zeitraum um 19,3 % an.
NRW: Baupreise für Wohngebäude im August 2025 um 2,7 %
höher als ein Jahr zuvor
* Preise für Rohbauarbeiten um
2,0 % gestiegen.
* Ausbaubauarbeiten verteuerten sich um 3,3 %.
Die Baupreise für Wohngebäude (Bauleistungen am Bauwerk) in
Nordrhein-Westfalen waren im August 2025 um 2,7 % höher als ein Jahr
zuvor. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt mitteilt, ist der Baupreisindex für
Wohngebäude im Vergleich zu Mai 2025 um 0,3 % gestiegen.
Gerüstarbeiten mit stärkstem Preisanstieg von 4,9 % bei den
Rohbauarbeiten
Die Rohbauarbeiten für den Bau von Wohngebäuden
verteuerten sich zwischen August 2024 und August 2025 um 2,0 %. Den
stärksten Preisanstieg gab es in diesem Bereich bei Gerüstarbeiten
mit 4,9 %, gefolgt von Zimmer- und Holzbauarbeiten mit 4,5 % und den
Dachdeckungsarbeiten, die um 4,3 % stiegen.
Abdichtungsarbeiten wurden im August 2025 um 0,2 % günstiger
angeboten als ein Jahr zuvor. Tapezierarbeiten verzeichneten mit 8 %
höchsten Preisanstieg bei den Ausbauarbeiten Die Preise für
Ausbauarbeiten bei Wohngebäuden stiegen im August 2025 gegenüber dem
entsprechenden Vorjahresmonat um 3,3 %.

Tapezierarbeiten verzeichneten in diesem Bereich mit 8,0 % den
höchsten Preisanstieg. Eine überdurchschnittliche Preiserhöhung
wurde bei den Wärmedämm-Verbundsystemen mit 7,4 % festgestellt.
Beschlagarbeiten verteuerten sich um 6,4 %. Dagegen erhöhten sich
die Preise für Blitzschutz-, Überspannungsschutz- und Erdungsanlagen
mit 0,4 % im gleichen Zeitraum unterdurchschnittlich.
Einen
Preisrückgang gab es bei den Aufzugsanlagen und Fahrtreppen, die
3,3 % günstiger waren als ein Jahr zuvor. Preise für weitere
Bauwerksarten: Höchster Anstieg beim Straßenbau Der Straßenbau wies
von allen Bauwerksarten mit 4,7 % den höchsten Preisanstieg zwischen
August 2024 bis August 2025 auf. Auch die Preise für Außenanlagen
für Wohngebäude und für Ortskanäle legten im gleichen Zeitraum um je
4,0 % zu. Die Preise für Schönheitsreparaturen in einer Wohnung
stiegen um 3,7 %.
747 000 Tonnen Elektroaltgeräte im
Jahr 2023 recycelt
747 000 Tonnen Elektro- und
Elektronikaltgeräte wurden im Jahr 2023 recycelt. Das waren gut vier
Fünftel (82,4 %) der insgesamt 906 100 Tonnen solcher Geräte, die
von sogenannten Erstbehandlungsanlagen angenommen wurden, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Internationalen
Tags des Elektroschrotts (E-Waste Day) am 14. Oktober 2025 mitteilt.
Im Vergleich zum Vorjahr wurden insgesamt 5 100 Tonnen
beziehungsweise 0,6 % mehr Elektroaltgeräte angenommen. Verglichen
mit dem Höchststand im Pandemiejahr 2020, als noch gut 1,0 Millionen
Tonnen erfasst wurden, bedeutet dies jedoch einen Rückgang um 131
000 Tonnen beziehungsweise 12,6 %. Erstbehandlungsanlagen sind
zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe, in denen Altgeräte oder ihre
Teile für die Wiederverwendung vorbereitet, recycelt oder beseitigt
werden.
124 700 Tonnen des im Jahr 2023
abgegebenen Elektroschrotts (13,8 %) wurden einer sonstigen
Verwertung zugeführt, zum Beispiel für die Nutzung als Heizungswärme
verbrannt. 18 800 Tonnen (2,1 %) wurden zur Wiederverwendung
vorbereitet. Die restlichen 15 600 Tonnen (1,7 %) wurden beseitigt,
zum Beispiel auf Deponien. Elektroaltgeräte in
Erstbehandlungsanlagen nach Art der Behandlung 2023 .in % Pie chart
with 4 slices. insgesamt906 000Tonnen Rundungsbedingte Abweichung
möglich.
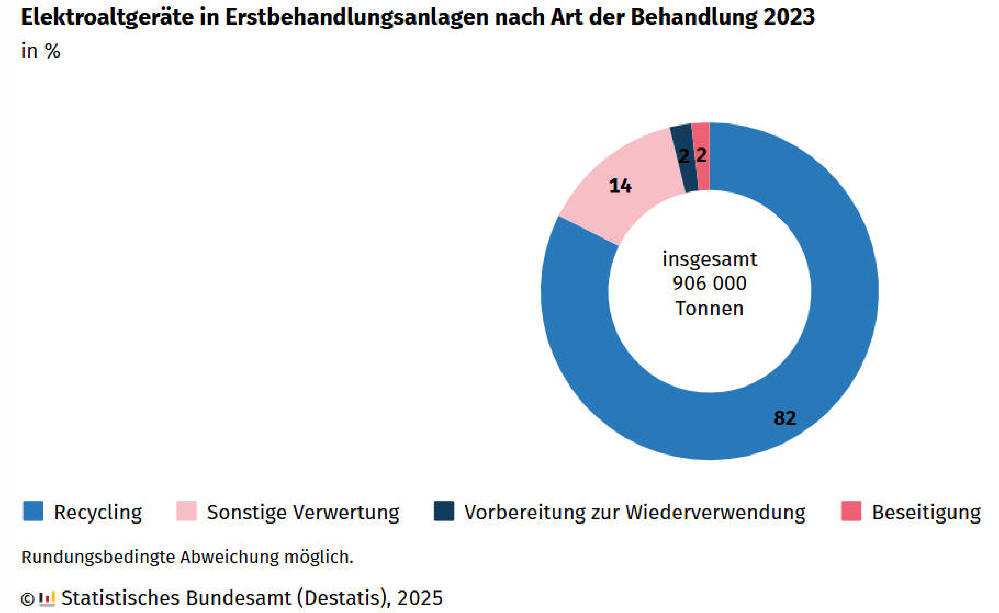
Höchste Recyclingquote bei Photovoltaikmodulen
Anteilig am
häufigsten wurden große Photovoltaikmodule recycelt. Von den
insgesamt 14 200 Tonnen in dieser Kategorie wurden 90,7 % dem
Recycling zugeführt. Die niedrigste Recyclingquote hatten
Kleingeräte mit 79,3 %. In diese Kategorie fallen zum Beispiel
Wasserkocher, elektrische Zahnbürsten, elektrische Zigaretten,
Fernbedienungen sowie Bekleidung mit elektrischen Funktionen, aber
auch kleine Photovoltaikmodule.
Kleingeräte die häufigste
Kategorie in den Elektroaltgeräten
Kleingeräte wurden am
häufigsten in Erstbehandlungsanlagen angenommen. Mit einem Anteil
von 31,7 % an allen angenommenen Geräten und 287 400 Tonnen lagen
sie vor den Großgeräten mit einem Anteil von 27,7 %
(250 700 Tonnen). In diese Kategorie fallen unter anderem
Waschmaschinen, Elektroherde oder Pedelecs.
Die
Wärmeüberträger wie Kühlschränke, Klimageräte und Wärmepumpen
machten mit 165 500 Tonnen 18,3 % der Altgeräte aus, die kleinen IT-
und Telekommunikationsgeräte – darunter Mobiltelefone und Router –
mit 91 000 Tonnen 10,0 %.
An Bildschirmgeräten mit einer Fläche
über 100 Quadratzentimetern, zu denen Fernseher, Computermonitore,
Laptops und Tablets zählen, wurden 88 800 Tonnen (9,8 %) erfasst,
gefolgt von großen Photovoltaikmodulen mit 14 200 Tonnen (1,6 %)
sowie Lampen (Leuchtstoff-, Energiespar- und LED-Lampen, jedoch
keine Glühlampen), die weniger als 1 % der Gesamtmenge ausmachten
(8 500 Tonnen).
Aktuelle Regelungen zu Entsorgung und
Recycling
Die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten ist
entscheidend, um wertvolle Rohstoffe wie seltene Erden, Kupfer oder
Gold zurückzugewinnen und für die Herstellung neuer Produkte zu
nutzen. Verbraucherinnen und Verbraucher haben dafür mehrere
kostenlose Entsorgungsmöglichkeiten.
Einzelhändler und
Onlineshops, die Elektrogeräte verkaufen und über eine Verkaufs-
oder Lagerfläche von mindestens 400 Quadratmeter im Elektrohandel
beziehungsweise 800 Quadratmeter im Lebensmittelhandel mit
regelmäßigem Elektroangebot verfügen, sind zur Rücknahme
verpflichtet.
Beim Kauf eines neuen Großgeräts kann das
alte, gleichartige Gerät zurückgegeben werden. Kleingeräte mit einer
Kantenlänge unter 25 Zentimetern dürfen auch ohne Neukauf abgegeben
werden. Darüber hinaus nehmen kommunale Wertstoffhöfe und
Recyclinghöfe Elektroaltgeräte kostenlos entgegen – teilweise auch
über mobile Sammelstellen oder Schadstoffmobile.