






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 41. Kalenderwoche:
11. Oktober
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Montag, 13. Oktober 2025 - Internationaler Tag der Katastrophenvorsorge
BBK: Heute ist der Tag der Internationalen
Katastrophenvorsorge
An diesem Tag wird darauf
aufmerksam gemacht, wie Menschen und Gemeinschaften auf der ganzen
Welt ihre Resilienz gegenüber Katastrophen stärken. Erfahren Sie
hier, welche Aktivitäten das BBK zur Internationalen
Katatstrophenvorsorge bündelt.
Im Jahr 1989 haben die
Vereinten Nationen den 13. Oktober zum Internationalen Tag der
Katastrophenvorsorge erklärt. An diesem Tag wird darauf aufmerksam
gemacht, wie Menschen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt ihre
Resilienz gegenüber Katastrophen stärken. Auf diesem Weg soll das
Bewusstsein dafür geschärft werden, wie wichtig es ist, auf allen
Ebenen auf die Reduzierung von Katastrophenrisiken hinzuwirken.
Internationale Zusammenarbeit spielt wichtige Rolle
Auch für
das Bundesamt für Bevölkerungsschutz zund Katastrophenhilfe (BBK)
spielt die internationale Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. Vor
allem Aktivitäten auf Ebene der Vereinten Nationen (UN) sowie die
Zusammenarbeit mit den Partnern in der Europäischen Union (EU)
stehen hierbei im Fokus. Zudem ist das BBK in die Arbeiten
internationaler Organisation wie der North Atlantic Treaty
Organization (NATO) oder der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eingebunden.
Umsetzung
Internationaler Agenden: Das Sendai Rahmenwerk für
Katastrophenvorsorge
Auf der dritten Weltkonferenz zur
Reduzierung von Katastrophenrisiken der Vereinten Nationen wurde das
Sendai Rahmenwerk für Katastrophenvorsorge (2015-2030) von insgesamt
187 Staaten angenommen. Dessen Umsetzung ist national wie
international eine ressort-, akteurs-, sektor- und
ebenenübergreifende Aufgabe, mit dem Ziel die Resilienz gegenüber
Katastrophen zu stärken. In Deutschland wurden zur Koordinierung des
Prozesses die Interministerielle Arbeitsgruppe zur Umsetzung des
Sendai Rahmenwerks (IMAG Sendai) und zur fachlichen Beratung die
beim BBK ansässige Nationale Kontaktstelle für das Sendai Rahmenwerk
(NKS) ins Leben gerufen.
Strategie wird
erarbeitet
Zur Übersetzung der Ziele, Leitlinien und
Handlungsprioritäten des Sendai Rahmenwerks in den nationalen
Kontext wird derzeit eine Strategie zur Stärkung der Resilienz
gegenüber Katastrophen (kurz: Resilienzstrategie) auf Bundesebene
erarbeitetet.
Diese Strategie soll Akteuren in Bund, Ländern und
Kommunen sowie den Betreibern Kritischer Infrastrukturen eine
Orientierung geben, wie die Katastrophenvorsorge in Deutschland auf
allen Ebenen gestärkt werden kann. Die in diesem Prozess bisher
gesammelten und noch zu machenden Erfahrungen sowie Beispiele
bewährter Praktiken werden durch die NKS, die IMAG Sendai und das
BBK mit Akteuren innerhalb und außerhalb Deutschlands geteilt.
Gemeinsam die Resilienz in Europa stärken
Deutschland
unterstützt die Erarbeitung der sogenannten europäischen Unionsziele
für Katastrophenresilienz als neues Instrument im 2021
überarbeiteten EU-Katastrophenschutzverfahren.
Für
Deutschland arbeitet unter anderem das Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat (BMI) und das BBK an der Ausgestaltung dieser
Unionsziele mit. Ziel dieser Resilienzziele ist die
Weiterentwicklung von Präventions- und Vorsorgemaßnahmen bei
komplexen Katastrophen mit grenzüberschreitenden Auswirkungen auf
mehrere Staaten. Damit findet die zunehmende Relevanz des
Resilienz-Konzepts im internationalen Kontext nun auch Eingang ins
Katastrophenschutzverfahren der EU.
Stärkung der Resilienz
Kritischer Infrastrukturen
Die Erfahrung aus der
COVID-19-Pandemie, der Klimawandel und andere sicherheitsrelevante
Bedrohungen unterstreichen die Wichtigkeit, die Resilienz Kritischer
Infrastrukturen zu stärken. Eine neue Richtlinie zur Resilienz
kritischer Einrichtungen soll europaweit die Bereitstellung von
Gütern und Dienstleistungen mit besonderer gesellschaftlicher
Bedeutung noch krisenfester machen. Die Richtlinie wird ein
gemeinsames Verständnis über Risiken für die Bereitstellung
kritischer Dienstleistungen und über die geteilte Verantwortung von
Behörden und Betreibern innerhalb der EU fördern.
Sie wird
zur Weiterentwicklung der nationalen und europäischen Rahmensetzung
für das Risiko- und Krisenmanagement beitragen und eine enge
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Behörden, Fachverbänden und
weiteren Akteuren einfordern. Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für
den Schutz Kritischer Infrastrukturen bringt sich das BBK aktiv in
den laufenden Diskussionsprozess ein.
ADAC Studie
zeigt großes Potenzial für mehr Blutspenden in Deutschland
Circa
15.000 Blutspenden werden in Deutschland täglich benötigt.
Circa 15.000 Blutspenden werden in Deutschland täglich benötigt. Bei
Unfällen, Operationen, aber auch zur Behandlung von Krankheiten und
für die Herstellung von Medikamenten sind Blutspenden oft
unverzichtbar. Immer wieder drohen Engpässe besonders im Sommer und
zu Ferienzeiten.
Trotzdem geht nach Angaben des Deutschen Roten
Kreuzes nur ein Bruchteil von rund drei Prozent der Bevölkerung
regelmäßig zur Spende. Wie groß das Potenzial ist, wenn
Unsicherheiten zerstreut und stärker sensibilisiert wird, zeigt eine
repräsentative ADAC Studie zur Blutspendebereitschaft in
Deutschland.
65 Prozent der Befragten grundsätzlich
spendenbereit
Danach bewerten rund 80 Prozent der Befragten
Blutspenden als gesellschaftlich wichtig, 65 Prozent zeigen sich
grundsätzlich spendenbereit. Besonders auffällig: Jüngere Erwachsene
zwischen 18 und 29 Jahren fühlen sich beim Gedanken an eine
Blutspende überdurchschnittlich häufig unwohl oder haben Ängste.
Gleichzeitig äußert die große Mehrheit dieser Altersgruppe (70
Prozent), dass sie sich eine Spende grundsätzlich vorstellen kann.
Hier kann Aufklärungsarbeit also besonders wirksam sein.
Kampagnen wirken
Auch die Kommunikation spielt eine entscheidende
Rolle: Die Ergebnisse bestätigen, dass Kampagnen wirken: 13 Prozent
gaben an, dass sie nach einem konkreten Aufruf zum Blutspenden
gegangen sind. Bei den Erstspendern lag die Quote mit 48 Prozent
besonders hoch. Immerhin jeder Fünfte hat sich danach zumindest
informiert. Als Hauptgründe für eine Blutspende nennen die
Befragten, dass sie helfen wollen, dass ihnen das eigene Risiko im
Ernstfall bewusst ist und dass ihnen das Spenden ein Gefühl des
gesellschaftlichen Zusammenhalts vermittelt.
Im Alltag wünschen
sich viele Spender praktische Erleichterungen: eine digitale
Terminvergabe, die Möglichkeit, Spendenorte einfach online zu
finden, und eine Benachrichtigung, wenn die eigene Spende zum
Einsatz kam.
ADAC ruft zu Blutspende-Aktion auf
Als
Reaktion auf die Studienergebnisse ruft der ADAC gemeinsam mit
nahezu allen ADAC Regionalclubs zu einer überregionalen Aktion auf,
die von Blutspendediensten unterstützt wird. Unter dem Motto
„Helfen, schützen, informieren“ organisiert der ADAC zusätzliche
Termine und Aktionsorte, um gerade Erstspenderinnen und -spender zu
erreichen.
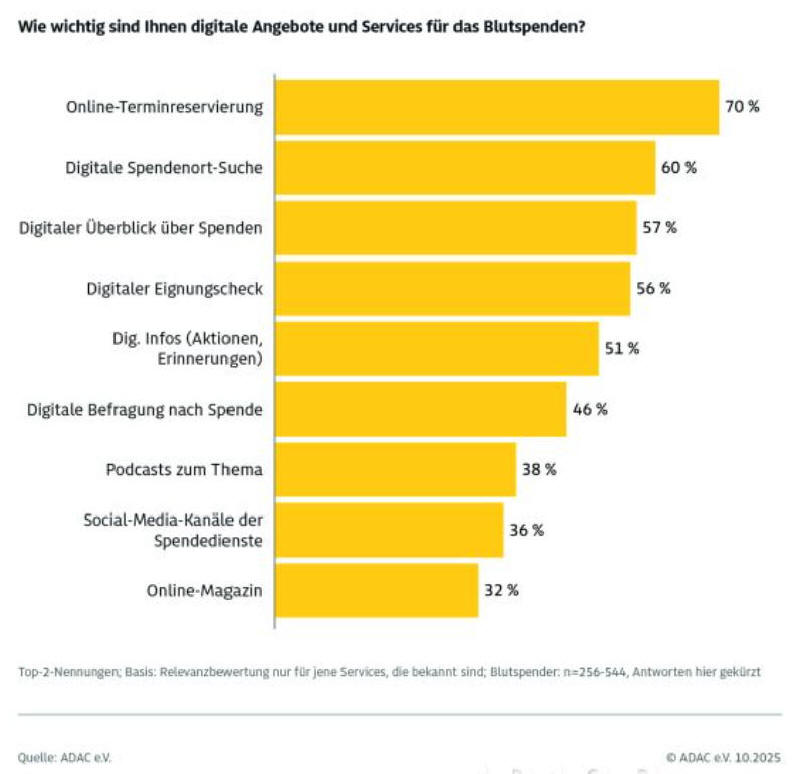
Weitere Informationen sowie Termine und Standorte für die ADAC
Blutspendeaktion finden Sie unter
www.adac.de/blutspende.
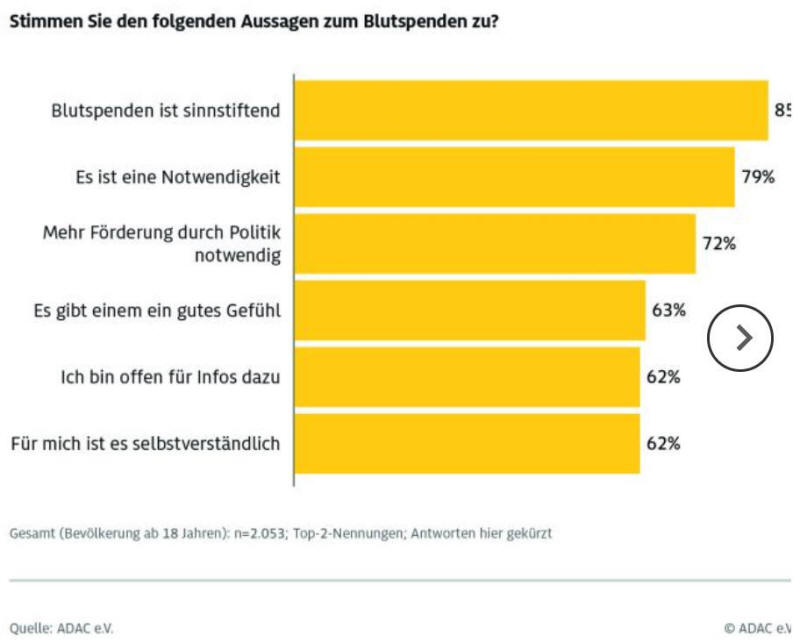
Gesundheitsminister Laumann: Grippeimpfung für Beschäftige
in Gesundheitswesen und Pflege besonders wichtig
Eine
Influenza ist keine harmlose Erkrankung, sondern kann zu schweren
Komplikationen führen und tödlich enden. Besonders gefährdet sind
ältere Menschen, Schwangere, Personen mit Vorerkrankungen und
Menschen mit geschwächtem Immunsystem und damit genau jene, die
häufig in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen betreut werden.
Zu ihrem Schutz und um die Funktionsfähigkeit medizinischer
Einrichtungen während der Grippesaison zu sichern, rufen das
Gesundheitsministerium und Partner Beschäftigte im Gesundheitswesen
zur jährlichen Influenza-Impfung auf.
„Beschäftigte im
Gesundheitswesen und der Pflege haben ein höheres Risiko, sich mit
der Grippe anzustecken. Für ihre Patientinnen und Patienten ist die
Influenza außerdem eine besondere Gefahr. Die Schutzimpfung ist nach
wie vor die beste Möglichkeit, sich und andere zu schützen. Sie ist
in der Regel gut verträglich, senkt das Risiko, schwer zu erkranken
deutlich und verbessert gleichzeitig den Schutz der Menschen im
Umfeld.
Indem sie das Ansteckungsrisiko verringert,
krankheitsbedingten Ausfällen vorbeugt und das Risiko von
Influenzaausbrüchen innerhalb von Einrichtungen erheblich senkt,
hilft sie auch dabei, medizinische Einrichtungen in der Grippesaison
funktionsfähig zu halten“, so Gesundheitsminister Karl-Josef
Laumann.
Das Gesundheitsministerium und seine Partner, die
Ärztekammern, die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Pflegekammer
Nordrhein-Westfalen, die Krankenhausgesellschaft und der Verband
deutscher Betriebs- und Werkärzte werben bei Beschäftigten im
Gesundheitswesen online und offline gezielt für die Impfung und
nutzen zu diesem Zweck eine gemeinsame Kommunikation unter den
Slogans: „Grippeschutz ist Teamarbeit – Gesund bleiben, um zu
helfen“, „ – Stark durch den Winter“ und „ – Schütze Dich – und
mich!“
Stimmen der Partner
Ingo Morell, Präsident der
Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW): „Wir appellieren
an die Beschäftigten in den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern,
das Angebot der Impfung möglichst wahrzunehmen. Die
Influenza-Impfung ist ein bewährtes Mittel, um eine Ansteckung mit
dem Grippevirus zu verhindern.
Deshalb empfehlen wir den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einen persönlichen Impftermin
wahrzunehmen und nicht hinauszuzögern. Denn die Impfung ist nicht
nur Selbstschutz. Sie schränkt auch die Ausbreitung der Krankheit
ein und kann die Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern
vor einer Ansteckung mit dem Grippevirus bewahren.“
Dr. Dirk
Spelmeyer und Anke Richter-Scheer, Dr. Frank Bergmann und Dr.
Carsten König, Vorstände der Kassenärztlichen Vereinigungen
Westfalen-Lippe und Nordrhein: „Die niedergelassenen Kolleginnen und
Kollegen bilden mit ihrem Impfangebot eine verlässliche Säule im
deutschen Gesundheitswesen. Mit welchem Einsatz und Entschlossenheit
sie das tun, hat nicht nur die Corona-Pandemie sichtbar gemacht,
sondern wird auch in jeder Grippesaison eindrucksvoll deutlich.
Die qualifizierten Praxisteams schützen uns als Gesellschaft mit
einem umfangreichen Versorgungsangebot vor schweren und
möglicherweise tödlich endenden Infektionsverläufen. Die Praxisteams
erleben tagtäglich, wie wertvoll die Grippeschutzimpfung ist und
gehen daher seit Jahrzehnten verantwortungsvoll voran.“
Dr.
med. Johannes Gehle, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Dr.
Sven Dreyer, Präsident der Ärztekammer Nordrhein und Sandra Postel,
Präsidentin der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen: „Influenza-Wellen
haben in der Vergangenheit gezeigt, dass Grippeerkrankungen
keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden dürfen. Wir
warnen vor einer gefährlichen Impfmüdigkeit. Eine Grippe darf man
nicht unterschätzen.
Doch leider gibt es nach wie vor
deutliche Impflücken – bei älteren Menschen, bei chronisch Kranken
oder auch beim medizinischen Personal. Wir erinnern deshalb an die
hohe Verantwortung der Beschäftigten im Gesundheitswesen. Sie sind
die ersten Kontaktpersonen für Patientinnen und Patienten bei allen
Erkrankungen und müssen für diese Aufgabe selber fit sein – denn
nicht nur bei der nächsten Grippewelle sind die Menschen auf Hilfe
angewiesen.“
Dr. med. Tanja Menting, Leiterin des
Betriebsärztlichen Dienstes am Universitätsklinikum Bonn und
Landesvorsitzende Nordrhein des Verbands deutscher Betriebs- und
Werksärzte e.V.: „Aus präventivmedizinischer Sicht gibt es keine
bessere Möglichkeit, als sich durch eine Impfung vor
Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel der sogenannten ‚Echten
Grippe‘ (Influenza), zu schützen. Im Gesundheitswesen tätige
Beschäftigte schützen durch die Influenzaimpfung nicht nur sich
selbst, sondern auch ihre Mitarbeitenden sowie Patientinnen und
Patienten.“
Hintergrund
Die Ständige Impfkommission
(STIKO) empfiehlt die Grippeschutzimpfung aktuell insbesondere für
folgende Risikogruppen:
Menschen ab 60 Jahre
Schwangere
Personen mit Vorerkrankungen wie zum Beispiel chronische
Erkrankungen der Atmungsorgane, Herz- oder Kreislaufkrankheiten,
Diabetes
Menschen mit geschwächtem Immunsystem
Bewohnerinnen
und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie
alle, die im
Gesundheitswesen arbeiten oder viel Kontakt zu anderen Menschen
haben.
Grundsätzlich gilt: Jede Impfung hilft, die
Ausbreitung des Grippevirus zu bremsen. Daher ist die Impfung auch
für Personen möglich, die nicht zu den Risikogruppen gehören. Viele
Krankenkassen übernehmen die Impfung als freiwillige Zusatzleistung
auch hier vollständig. Die Kostenübernahme sollte mit der jeweiligen
Krankenkasse geklärt werden. Viele Arbeitgeber bieten die Impfung
außerdem für ihre Beschäftigten an.
Da sich die Grippeviren
jedes Jahr verändern, ist eine jährliche Impfung mit einem
angepassten Impfstoff nötig. Die Impfempfehlung der STIKO und
weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.mags.nrw/grippeschutzimpfung
Erfolgreiche Teamarbeit gegen Umweltkriminalität ist Vorbild für
Europa
Bei der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde vor
zwei Jahren die Zentralstelle für die Verfolgung der
Umweltkriminalität in Nordrhein-Westfalen (ZeUK NRW) gegründet, die
sich binnen kürzester Zeit zu der führenden Institution im Kampf
gegen Umweltstraftaten in Deutschland und Europa entwickelt hat.
Spezialisierte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte verfolgen
bedeutende Fälle von organisierter Kriminalität, etwa auf den
Gebieten der illegalen Abfallentsorgung, Gewässerverunreinigung oder
Tierquälerei, und arbeiten eng vernetzt mit allen staatlichen
Akteuren zusammen. Besondere Wirkung für die effektive
Strafverfolgung hat die reibungslose Kooperation mit den
Umweltbehörden, denn das Umweltstrafrecht ist auf
verwaltungsrechtliche Bewertungen und Einstufungen angewiesen.
Minister der Justiz Dr. Benjamin Limbach: „Die Bekämpfung von
Umweltkriminalität in Nordrhein-Westfalen ist ein Vorbild für andere
Länder und findet auch in Berlin und Brüssel Anerkennung. Jetzt muss
der Bund seine Hausaufgaben machen und die EU-Richtlinie zum
strafrechtlichen Schutz der Umwelt effektiv in nationales Recht
umsetzen. Das bedeutet höhere Strafandrohungen für organisierte
Umweltkriminalität, stärkere Verantwortung von Unternehmen für
Straftaten im Betrieb und effektivere Geldbußen.“
Umweltminister Oliver Krischer: „Umweltstraftaten sind keine
Kavaliersdelikte, sondern verursachen oft Millionenschäden. Die
Verbrecher verschaffen sich etwa durch illegale Entsorgung
exorbitante Gewinne, für die Beseitigung der Schäden aber müssen wir
alle aufkommen. Durch die hervorragende Zusammenarbeit der Behörden
in Nordrhein-Westfalen ist keiner der Verbrecher mehr sicher vor
Strafverfolgung.“
Die ZeUK NRW hat im November 2023 ihre
Arbeit aufgenommen und seitdem rund 200 Fälle herausgehobener
Umweltkriminalität übernommen. Sie arbeitet insbesondere eng mit dem
Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK)
zusammen, das mit seinen Sondereinsatzfahrzeugen schnell die
erforderlichen Untersuchungen in Boden, Luft und Wasser vornehmen
kann.
Beweise können so zeitnah gesichert und Schäden für
Natur und Umwelt ermittelt werden. Die Praxis in Nordrhein-Westfalen
gilt als Maßstab für eine effektive Umsetzung der Ziele der
Richtlinie der Europäischen Union zum strafrechtlichen Schutz der
Umwelt. Diese ist durch den Bund im Wesentlichen bis zum 21. Mai
2026 in nationales Recht umzusetzen und verlangt, Verstöße gegen
Straftatbestände noch wirksamer zu verfolgen und zu sanktionieren,
und das sowohl gegen natürliche Personen als auch gegen Unternehmen.
Das macht im nationalen Recht die konsequente und effektive
Anwendung des geltenden Umweltstrafrechts erforderlich. Entsprechend
der EU-Richtlinie muss zudem der Strafrahmen für organisierte
Umweltkriminalität erhöht werden, um abschreckende Sanktionen zu
ermöglichen. Deutschland muss dementsprechend in der Lage sein,
Unternehmen effektiv zur Verantwortung zu ziehen und Geldbußen für
Unternehmen bis zu 40 Millionen Euro beziehungsweise fünf Prozent
des weltweiten Gesamtjahresumsatzes zu verhängen.
Trauercafé am 19. Oktober im Malteser Hospizzentrum St.
Raphael Duisburg.
Der Verlust eines geliebten Menschen
schmerzt und reißt eine große Lücke in das Leben von Verwandten und
Freunden. Die geschulten und erfahrenen Mitarbeitenden des Malteser
Hospizzentrum St. Raphael bieten unterschiedliche Beratungsangebote
für Hinterbliebene. Die Trauerberatung ist eine Hilfestellung, den
schwierigen Übergang in ein anderes „Weiter-Leben“ während der
Trauerphase zu begleiten und neue Wege zu finden.
Das
Trauercafé findet einmal im Monat im Malteser Hospizzentrum St.
Raphael, Remberger Straße 36, 47259 Duisburg, statt. Der nächste
Termin ist am 19. Oktober von 15.00 bis 16.30 Uhr. Menschen, die
nahe stehende Angehörige oder Freunde verloren haben, können sich
hier für die bevorstehenden Wochen stärken und ihre Erfahrungen mit
anderen Betroffenen austauschen. Begleitet wird das Trauercafé von
den geschulten und erfahrenen Mitarbeitenden des Malteser
Hospizzentrum St. Raphael. Eine Anmeldung für das Trauercafé ist
nicht notwendig.
Sechs Duisburger Sprachcamps 2025
Für
Grundschulkinder mit Zuwanderungsgeschichte finden sechs Sprachcamps
in Duisburg in den Herbstferien vom 13. bis 24 Oktober an sechs
verschiedenen Standorten statt. Insgesamt werden über 120 Kinder
teilnehmen. Die Sprachcamps bieten eine Tagesbetreuung für Kinder
mit Zuwanderungsgeschichte im Alter von circa acht bis zu zehn
Jahren an.
Betreut werden die Kinder von Pädagoginnen und
Pädagogen und spezialisierten Trainerinnen und Trainern. Die
Angebote werden von verschiedenen Kooperationspartnern in
Zusammenhang mit dem Jugendamt der Stadt Duisburg durchgeführt:
Verein für Kinderhilfe und Jugendarbeit e. V. Kulturbunker – Kleine
Stadtteilreporter, Hendrik Spließ, 0163/3908171 Blaues Haus –
Kunterbunte Welt der Wörter, Nikita Grojsman, 01520/5182482
Regionalzentrum Nord – Gut drauf mit Sprache, Hatice Teymur,
0203/3465134 Jungs e. V. (Parkhaus Meiderich) – Herbstferien
Kunterbunt David Driever, 01575/2016318 Mabilda e. V. (Mabilda) –
„Volle Power“ Lea Cerny, 0177/2355173 Caritas (Jugendzentrum
Angertalerstr) - „Rund um Gesund“ Jasemin Korkmaz, Tel. 0163/6087834
Intensivkurs: Italienisch für Anfänger an
der Volkshochschule
Die Volkshochschule bietet vom 13. bis 17.
Oktober einen einwöchigen Intensivsprachkurs
in Italienisch an. Der Kurs richtet sich an
Teilnehmende ohne Vorkenntnisse, die schnell
Grundlagenkenntnisse erwerben möchten.
Im Mittelpunkt steht das aktive
Sprechtraining für Alltag und Beruf. Eine
erfahrene muttersprachliche Kursleiterin
gestaltet die täglich sechs
Unterrichtsstunden von 9 bis 14:30 Uhr im
Stadtfenster. Das Entgelt beträgt 148 Euro.
Ermäßigungen sind gegen Vorlage
entsprechender Bescheinigungen möglich.
Beratung ist möglich unter 0203/283-984610
Kirchenkneipe in Neudorf
Gemeinde lädt zum Auspannen ein
Am Freitag, 17. Oktober
2025 gibt es in der Evangelischen Kirchengemeinde Hochfeld-Neudorf
eine gute Gelegenheit zum Auspannen und zum gemütlichen
Wochenausklang: Um 18 Uhr geht es in Gemeinschaft mit anderen beim
Klönen um Gott und die Welt, denn im Gemeindezentrum an der
Gustav-Adolf-Str. 65 öffnet wieder die Kirchenkneipe.
Engagierte, die die Aktion vorbereiten, laden herzlich zur Begegnung
ein. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.hochfeld-neudorf.de.
Fesselnder Literaturabend im Begegnungscafé Gemeinde lädt
zur Duisburg-Krimi-Lesung
Engagierte der Evangelischen
Kirchengemeinde Duisburg Meiderich servieren im Begegnungscafé „Die
Ecke“, Horststr. 44a, regelmäßig auch kulturelle Leckerbissen. Den
nächsten literarischen Happen gibt es am Dienstag, 21. Oktober 2025
um 19 Uhr, wenn Helga Dittrich und Elke Klüpfel Autor Dieter Kaspers
begrüßen. Er liest aus seinem historischen Duisburg-Krimi „Kommissar
Greulichs Witterung“.
Der Roman erzählt von einer Mordserie
und schwierigen Ermittlungen in den frühen 1950er-Jahren, in denen
Kripo-Beamte mit einen Festgenommenen auch schon mal zu Fuß oder in
der Straßenbahn unterwegs sind. Das Team des Begegnungscafés lädt zu
einer spannende Zeitreise - nicht für Krimibegeisterte und Fans der
Stadtgeschichte. Der Eintritt ist frei.
Mehr Infos hat
Yvonne de Temple-Hannappel, die Leiterin des Begegnungscafés (Tel.
0203 45 57 92 70, E-Mail: detemple-hannappel@gmx.de). Infos zur
Gemeinde gibt es im Netz unter
www.kirche-meiderich.de.

Helga Dittrich, die im Literaturcafé Meiderich vorliest (Foto:
www.kirche-meiderich.de).
Schwofen, Kaffee, Kuchen im Gemeinde-Café
Dreivierteltakt in Wanheimerort
Die Evangelische
Rheingemeinde Duisburg öffnet zum Monatsausklang das „Café
Dreivierteltakt“, bei dem Seniorinnen und Senioren zu Kaffee, Tee
und Kuchen zusammenkommen, die Begleit-Musik genießen und dazu
tanzen. Für den guten Ton sorgt Frank Rohde -
Foto: Maria
Hönes - , der zu seinem Spiel an der elektronischen Orgel
auch singt. 
Es
gibt dabei nicht nur Klänge im Dreivierteltakt, doch alle Lieder
haben Rhythmus und sind vielen bekannt. Das nächste
gesellig-musikalische Treffen im Beratungs- und Begegnungszentrum
(BBZ) Wanheimerort, Paul-Gerhardt-Straße 1, ist am Samstag, 18.
Oktober 2025 um 15 Uhr. Bei sieben Euro Eintritt sind Kaffee und
Kuchen inbegriffen; Anmeldungen sind bei Maria Hönes telefonisch
möglich (Tel.: 0203 770134).

NRW: Anzahl der Flugpassagiere in die USA um 24 %
gesunken
* Anzahl der Einsteigerinnen und Einsteiger
seit zwei Jahren rückläufig
* Die meisten Passagiere starten von
Düsseldorf in die USA
* Fracht- und Postverkehr in USA hat um
8,6 % zugenommen
Im ersten Halbjahr 2025 sind von den sechs
Hauptverkehrsflughäfen in Nordrhein-Westfalen rund 60.300
Flugpassagiere in die USA geflogen. Wie das Statistische Landesamt
mitteilt, ist die Anzahl der Flugpassagiere in die USA in den
letzten beiden Jahren rückläufig. So flogen im ersten Halbjahr
dieses Jahres rund 24 % weniger Passagiere als im gleichen Zeitraum
2024 bzw. 25 % weniger als im ersten Halbjahr 2023 in die USA.
Zwischen Januar und Juni des Vor-Corona-Jahres 2019 waren mehr als
drei Mal so viele Passagiere von NRW in die USA geflogen als im
ersten Halbjahr 2025.
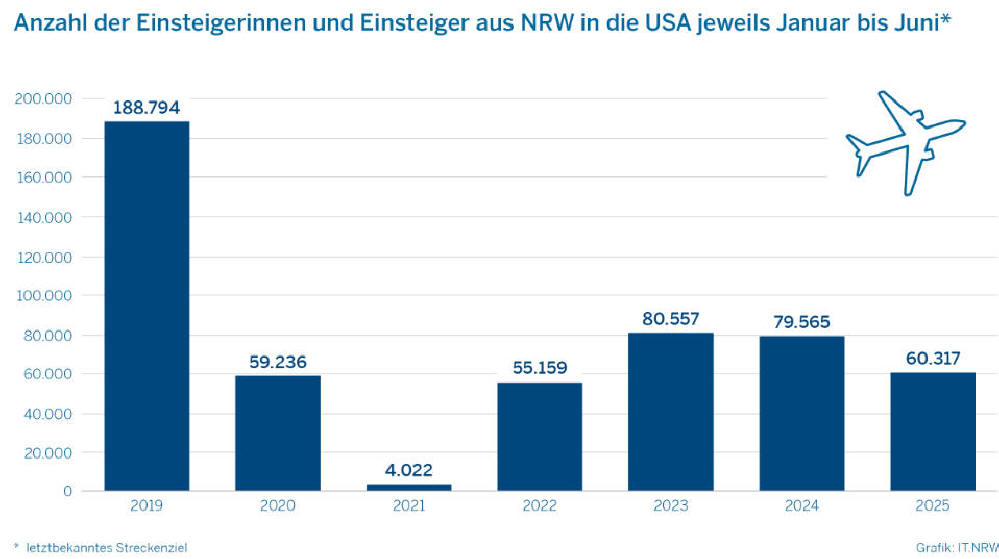
Flughafen Düsseldorf Spitzenreiter unter den NRW-Flughäfen
Bei Betrachtung der sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW sticht der
Düsseldorfer Flughafen besonders heraus: Jeweils im ersten Halbjahr
der letzten sieben Jahre sind etwa 88 bis 97 % aller Passagiere, die
von NRW in die USA geflogen sind, von Düsseldorf gestartet.
Von den Flughäfen Köln/Bonn und Münster/ Osnabrück starteten im
selben Zeitraum gerade einmal 1 bis 6 %, der Flughafen
Paderborn/Lippstadt lag bei maximal 1,6 %. Die Flughäfen Dortmund
und Niederrhein spielten beim Flugziel USA hingegen keine Rolle.
Fracht- und Postverkehr in USA hat um 8,6 % zugenommen
Im
Fracht- und Postverkehr per Flugzeug von NRW in die USA sind im
ersten Halbjahr 2025 etwa 66.500 Tonnen Güter befördert worden. Dies
entspricht einer Steigerung von 8,6 % im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum und einer Abnahme von 1,3 % gegenüber dem 1.
Halbjahr 2023.
Der einzige Flughafen in NRW, von dem aus in
den Jahren 2024 und 2025 Fracht- und Postgüter in die USA geflogen
wurden, war der Flughafen Köln/Bonn. In den Jahren 2019, 2020 sowie
2023 hatte vom Flughafen Düsseldorf ebenfalls Fracht- und
Postverkehr in die USA stattgefunden.
NRW: 47.040 Menschen erhielten 2024 Hilfen für Blinde
und Gehörlose
* Häufigste Hilfeleistung war das
Blindengeld
* Zahl der Menschen mit Bezug von Blindengeld und
Hilfe für hochgradig Sehbehinderte weiter rückläufig
* Zahl der
Personen mit Bezug von Hilfe für Gehörlose leicht gestiegen
Im Jahr 2024 erhielten in Nordrhein-Westfalen 47.040 Menschen
Leistungennach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose
(GHBG). Wie das Statistische Landesamt anlässlich des Tags des
weißen Stocks am 15. Oktober 2025 mitteilt, war mit 26.514
Leistungsbeziehenden das Blindengeld die am häufigsten erbrachte
Leistung.
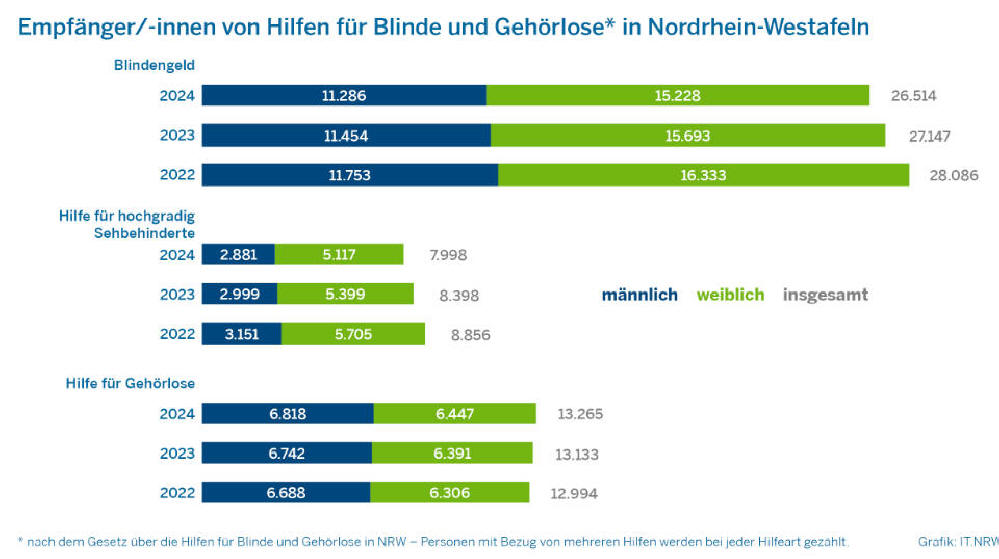
Blinde Menschen haben in Nordrhein-Westfalen Anspruch auf
Blindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten
Mehraufwendungen. Zudem können Menschen, deren Seh- oder Hörvermögen
massiv herabgesetzt ist, einen finanziellen Ausgleich beantragen.
Zahl der Menschen mit Bezug von Blindengeld und Hilfe für hochgradig
Sehbehinderte rückläufig 2024 haben 2,3 % weniger Menschen
Blindengeld erhalten als im Vorjahr.
Hilfe für hochgradig
Sehbehinderte bezogen 7.998 Personen. Auch hier gab es einen
Rückgang: 2024 lag die Zahl der Personen mit Bezug dieser Leistung
um 4,7 % niedriger als 2023. Eine Ursache für den Rückgang der Zahl
der Empfängerinnen und Empfänger von Blindengeld und der Hilfe für
hochgradig Sehbehinderte dürfte in einer verbesserten
augenärztlichen Versorgung liegen.
Zahl der Personen mit
Bezug von Hilfe für Gehörlose leicht gestiegen
Während die Zahl
der Empfängerinnen und Empfänger von Blindengeld und Hilfe für
hochgradig Sehbehinderte zurückging, zeigte sich bei der Hilfe für
Gehörlose ein entgegengesetzter Trend: 2024 erhielten 13.265
Personen diese Leistung, ein Plus von 1,0 % im Vergleich zum
Vorjahr.
Beim Blindengeld stellten die Empfängerinnen mit
57,4 % die Mehrheit. Bei der Hilfe für hochgradig Sehbehinderte
waren knapp zwei Drittel (64,0 %) der Leistungsbeziehenden weiblich.
Bei der Hilfe für Gehörlose waren dagegen die Empfänger mit 51,4 %
knapp in der Überzahl.
Ausgaben für Hilfen für Blinde und
Gehörlose leicht gesunken
Die Nettoausgaben für Hilfen für
Blinde und Gehörlose beliefen sich 2024 insgesamt auf 154,2
Millionen Euro und lagen damit um 0,3 % unter dem Vorjahreswert. Der
größte Teil der Nettoausgaben entfiel mit 135,5 Millionen auf das
Blindengeld. 6,6 Millionen Euro wurden für die Hilfe für hochgradig
Sehbehinderte aufgebracht und 12,1 Millionen Euro für die Hilfe für
Gehörlose.