






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 42. Kalenderwoche:
15. Oktober
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 16. Oktober 2025
Stahl sichern, Jobs schützen, Zukunft bauen – Mahmut Özdemir
unterstützt das neue Stahlpapier der SPD-Bundestagsfraktion
Die SPD-Bundestagsfraktion hat am 14 Oktober 2025 ihr
Positionspapier zur Zukunft der deutschen Stahlindustrie
beschlossen. Damit sendet die Fraktion ein klares Signal: Die
Zukunft des Stahls in Deutschland und Europa entscheidet sich jetzt,
und die SPD setzt sich für den Erhalt der Arbeitsplätze sowie für
den ökologischen Umbau der Branche ein.
„Die Fakten liegen
auf dem Tisch und nun muss die Bundesregierung handeln“, erklärt
Mahmut Özdemir, MdB, SPDBundestagsabgeordneter aus Duisburg. „Stahl
ist die Grundlage unserer industriellen Wertschöpfung. Wer über die
Zukunft des Industriestandorts Deutschland spricht, muss über Stahl
sprechen, und zwar über Stahl, der klimafreundlich produziert wird.“

Die
SPD-Bundestagsfraktion fordert, die Wettbewerbsbedingungen der
Stahlindustrie durch wirksamen Außenhandelsschutz, einen fairen
Industriestrompreis und die spürbare Senkung der Stromkosten zu
verbessern. Ebenso sei der beschleunigte Aufbau einer
leistungsfähigen Wasserstoffinfrastruktur entscheidend, um den Weg
hin zu grünem Stahl zu ebnen.
Parallel müsse die Schaffung
grüner Leitmärkte erfolgen, damit klimafreundlicher Stahl am Markt
eine echte Perspektive hat und dauerhaft bestehen kann. „Gerade für
Duisburg, wo das Herz der deutschen Stahlindustrie schlägt, ist
dieser Wandel von existenzieller Bedeutung“, betont Mahmut Özdemir,
MdB. „
Zehntausende Menschen arbeiten hier direkt oder
indirekt in der Stahlproduktion, und eine ganze Region hängt an der
Branche – von den Beschäftigten über ihre Familien bis hin zu
Handwerksbetrieben und Zulieferern. Duisburg ist nicht nur ein
Standort, Duisburg ist Stahlstadt.
Deshalb ist es wichtig,
dafür zu sorgen, dass auch künftig in Duisburg Stahl
klimafreundlich, wettbewerbsfähig und zukunftsfest produziert wird.
Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt die Beschäftigten und
Betriebsräte bei diesem Weg und setzt sich für die
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Stahlwerke sowie für den
Erhalt der Arbeitsplätze ein. Die Beschäftigten in Duisburg werden
dabei nicht im Stich gelassen.“
Mit dem Beschluss des
Stahlpapiers bekräftigt die Fraktion ihre Verantwortung für die
Menschen in Duisburg und für Industriearbeitsplätze in ganz
Deutschland. Es geht nicht nur um den Schutz einer Schlüsselbranche,
sondern auch um die strategische Unabhängigkeit Deutschlands in
Zeiten globaler Umbrüche. Damit weiterhin überwiegend deutscher und
europäischer Stahl in Autos, Brücken und Gebäuden verbaut wird, sind
jetzt entschlossene politische Maßnahmen notwendig.
Regionales Trainingszentrum der Polizei in Duisburg eingeweiht
Polizisten und Polizistinnen bestmöglich auf Einsätze vorzubereiten,
wurde jetzt das neue Regionale Trainingszentrum der Polizei in
Duisburg-Beeckerwerth eingeweiht. Auf einem Areal von knapp 17.000
Quadratmetern gibt es Räumlichkeiten u.a. für theoretische
Schulungen und eine Trainingshalle für Extrem- und Krisenszenarien.
In der Raumschießanlage können die Beamten dank
Videoprojektion unter realitätsnahen Bedingungen üben. Das Zentrum
wird auch von den Behörden aus Wesel, Kleve und Krefeld genutzt. idr
Deutsche arbeiten weniger / Vor allem Männer haben Arbeitszeiten
verkürzt
Die individuellen Arbeitszeiten der Deutschen
sinken: 2023 lag die durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei 34,6
Stunden, 2012 waren es noch 34,9 Stunden. Gleichzeitig waren mehr
Menschen erwerbstätig; in der Folge wurde von den Beschäftigten mehr
Arbeitszeit erbracht als jemals zuvor seit der Wiedervereinigung.
Zu diesen Ergebnissen kommt der aktuelle Arbeitszeitmonitor
des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität
Duisburg-Essen. Insbesondere Männer haben in den letzten Jahren ihre
Arbeitszeiten verkürzt. Sie arbeiteten 2023 durchschnittlich 1,1
Stunden weniger als 2012. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an
der Gesamtbevölkerung erhöhte sich kontinuierlich von 27,2 auf 30,9
Prozent.
Teilzeitarbeit wächst aktuell vor allem in
Beschäftigtengruppen, in denen Teilzeitarbeit lange Zeit nicht
verbreitet war, etwa bei Vätern, Hochqualifizierten sowie
Beschäftigten ohne Kinderbetreuungsverpflichtungen im mittleren
Alter. idr
Erstes Forum für Immobilieneigentümerinnen
und -eigentümer aus Marxloh und Alt-Hamborn
Die Stadt
Duisburg und Duisburg Business & Innovation (DBI) laden alle
interessierten Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer aus Marxloh
und Alt-Hamborn zu einem Forum in den Campus Marxloh (An der
Paulskirche 6, 47169 Duisburg) ein.
Die Veranstaltung findet
am Mittwoch, 5. November, von 18 bis 20.30 Uhr im Rahmen des
Programms „Stark im Norden“ statt. Thematisch widmet sich das erste
Treffen dieser Art den Herausforderungen und Chancen des
Immobilienbesitzes in den beiden Stadtteilen.
Es finden
sowohl Informationsvorträge als auch ein offener Beratungsmarkt zu
Themen wie energetischer Sanierung, Leerstandsmanagement,
Nachhaltigkeit sowie verschiedenen Förderprogrammen statt. Darüber
hinaus bietet das Forum Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung
untereinander und soll somit einen wichtigen Beitrag zur gemeinsamen
Weiterentwicklung der beiden Stadtteile im Duisburger Norden
leisten.
Bei Interesse an einer Teilnehme wird um Anmeldung
per E-Mail an althamborn@du-starkimnorden.de oder
marxloh@du-starkimnorden.de gebeten.
Ab 2028:
Energieeffizientere Ladegeräte für Laptops, Smartphones und andere
elektronische Geräte
Viele der gängigsten elektronischen
Geräte werden künftig energieeffizienter, weniger umweltschädlich
und verbraucherfreundlicher. Eine entsprechende Änderung der
Ökodesign-Anforderungen für externe Netzteile (external power
supplies, EPS) hat die Europäische Kommission angenommen.
Die
Entscheidung ist Teil der Bemühungen hin zu einem gemeinsamen
Ladegerät für elektronische Geräte. Sie sieht neben höheren
Energieeffizienzstandards auch eine größere Interoperabilität vor,
beispielsweise durch obligatorische USB-C-Anschlüsse für alle
USB-Ladegeräte für Geräte wie Laptops, Smartphones, Router und
Computermonitore.
Dan Jørgensen, EU-Kommissar für Energie
und Wohnungswesen, erklärte: „Gemeinsame Ladegeräte für unsere
Smartphones, Laptops und andere Geräte, die wir täglich verwenden,
sind ein kluger Schachzug: die Verbraucherinnen und Verbraucher
stehen an erster Stelle, gleichzeitig werden Energieverschwendung
und Emissionen reduziert werden.“
Die Regeln werden Ende 2028
in Kraft treten; die Hersteller haben also drei Jahre Zeit, um sich
auf die Änderungen vorzubereiten.
Einsparpotential von 100
Millionen Euro pro Jahr
Es wird erwartet, dass die Änderungen bis
2035 jährliche Einsparungen von rund 3 Prozent des Energieverbrauchs
während eines EPS-Lebenszyklus bewirken, die Treibhausgasemissionen
um 9 Prozent und die Schadstoffemissionen um 13 Prozent sinken
werden. Für die Verbraucher bedeutet dies Einsparpotenziale von rund
100 Millionen Euro pro Jahr.
Neues Logo
Darüber hinaus
wird ein neues gemeinsames EU-Ladegerät-Logo den Verbrauchern
helfen, kompatible Geräte zu identifizieren und fundierte
Entscheidungen zu treffen. Diese Initiative baut auf früheren
Bemühungen zur Standardisierung von Ladeanschlüssen und
-technologien für elektronische Geräte auf.
Elektromobilität: EnBW treibt HyperNetz-Ausbau mit zwei
neuen Schnellladeparks in Nordrhein-Westfalen voran
EnBW
startet Bau von Schnellladeparks für Elektroautos in
Duisburg-Neumühl und Büren-Geseke - insgesamt 24 neue
Schnellladepunkte direkt an der Autobahn
Ein Ausflug von
Dortmund über Duisburg in die Niederlande oder nach Osten in
Richtung Kassel: Für E-Auto-Fahrer*innen wird das Ladeangebot auf
diesen prominenten Routen durch Nordrhein-Westfalen noch einmal
attraktiver. Die EnBW Baden-Württemberg AG, Betreiberin des größten
Schnellladenetzes für Elektroautos in Deutschland, hat kürzlich mit
dem Bau von zwei neuen Schnellladeparks begonnen.

Die beiden Ladestandorte in direkter Autobahnlage an der A 42 bei
Duisburg-Neumühl sowie an der A 44 bei Büren-Geseke werden jeweils
mit zwölf gleichzeitig nutzbaren Schnellladepunkten bestückt, und
unterstützen somit gezielt den elektrifizierten Individualverkehr
auf der Langstrecke quer durch Nordrhein-Westfalen.
Schnellladeparks der höchsten Leistungsklasse
Sowohl in
Duisburg-Neumühl als auch in Büren-Geseke entstehen
Schnellladepunkte der aktuell höchsten Leistungsklasse mit einer
Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt (kW). Nutzer*innen können ihr
E-Auto, je nach Kapazität des Fahrzeugs, während eines 15-minütigen
Ladestopps somit mit bis zu 400 Kilometern Reichweite beladen. Die
EnBW-Schnellladeparks werden mit 100 Prozent Ökostrom betrieben. Als
vollständig überdachte Ladeparks bieten beide Standorte zudem
höchsten Ladekomfort auch bei schlechter Witterung.
„Mit
Ladeparks wie diesen setzt die EnBW konsequent ihre Ausbaustrategie
einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur in Deutschland fort. Das
EnBW HyperNetz bauen wir strategisch an Verkehrsknotenpunkten aus:
beispielsweise wie hier direkt an der Autobahn, und somit perfekt
für Fernreisen oder Pendler*innen“, erklärt Volker Rimpler, der als
Technischer Leiter für Elektromobilität bei der EnBW mobility+ den
Bau neuer Ladeinfrastruktur verantwortet. „Wie gewohnt werden auch
die beiden neuen Ladeparks nach nur kurzer Bauzeit bereits im
Verlauf des Herbsts in Betrieb gehen.“
EnBW HyperNetz: bis zu
20.000 Schnellladepunkte bis 2030
Die EnBW, eines der größten
integrierten Energieunternehmen in Deutschland und Europa, errichtet
deutschlandweit das EnBW HyperNetz und ist ein führender Treiber der
Mobilitätswende. Mit über 7.000 Schnellladepunkten an rund 1.500
Standorten betreibt sie schon heute das größte Schnellladenetz für
Elektroautos in Deutschland. Bis zum Jahr 2030 ist ein Ausbau auf
20.000 gleichzeitig nutzbare Schnellladepunkte für Elektroautofahrer
aller Marken geplant.
Der aktuell mit 52 Ladepunkten größte
EnBW-Schnellladepark Deutschlands steht ebenfalls in
Nordrhein-Westfalen, in Kamen. Aktuell betreibt die EnBW im
bevölkerungsreichsten Bundesland der Republik drei große eigene
Ladeparks sowie über 700 Schnellladestationen mit jeweils zwei
Ladepunkten an rund 350 Partner-Ladestandorten, beispielsweise im
Einzelhandel. Erst im September eröffnete in Essen-Kray/NRW im Zuge
der EnBW-Strategie „Laden an Läden“ der insgesamt 400. Ladestandort
Deutschlands in Kooperation mit der REWE Group.
Fakten zum
Schnellladepark in Duisburg-Neumühl:
12 HPC-Ladepunkte mit bis zu
400 kW Leistung
Anbindung an A 42 (Anschlussstelle 7
Duisburg-Neumühl)
Solardach mit 18,55 kWp -
Link zu Google Maps
Fakten zum
Schnellladepark in Büren-Geseke:
12 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400
kW Leistung
Anbindung an A 44 (Anschlussstelle 59 Geseke)
Solardach mit 18,55 kWp -
Link zu Google Maps
Elektromobilität bei der EnBW
Die EnBW Energie
Baden-Württemberg AG ist mit über 30.000 Mitarbeiter*innen eines der
größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa und versorgt
rund 5,5 Millionen Kund*innen mit Strom, Gas und Wasser sowie mit
Energielösungen und energiewirtschaftlichen Dienstleistungen.
Im
Bereich E-Mobilität hat sich die EnBW in den vergangenen Jahren zu
einer Marktführerin entwickelt und deckt als Full-Service-Anbieterin
mit ihren Tochterunternehmen die komplette Bandbreite ab: von der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen über den Auf- und
Ausbau sowie den Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zu digitalen
Lösungen für Verbraucher*innen.
Die Netze BW als
unabhängiges EnBW-Tochterunternehmen sorgt darüber hinaus für den
sicheren Betrieb von Verteilnetzen. Als einer der deutschen
Marktführer für Heimspeicher und Photovoltaik-Anlagen verknüpft das
Unternehmen zudem Solar-, Speicher- und Stromcloud-Lösungen mit
Elektromobilitätsangeboten zu einem kompletten Energie-Ökosystem für
seine Kund*innen.
„Unsere Energie Bewegt Was“ – so lautet das
Motto der neuen Markenkampagne der EnBW. Erfahren Sie mehr:
www.enbw.com/markenkampagne
Das EnBW HyperNetz® bietet Autofahrer*innen Zugang zu mehr als
800.000 Ladepunkten in Europa. Die EnBW mobility+ App findet überall
dort stets die nächste Lademöglichkeit. Autofahrer*innen können über
die App auch bequem und kontaktlos bezahlen. Nach einer einmaligen
Registrierung können Kund*innen zudem an den meisten EnBW-eigenen
Schnellladepunkten einfach ihr Fahrzeug anschließen und direkt
losladen. An allen Ladepunkten im EnBW HyperNetz gelten transparente
Preise je Kilowattstunde.
Umfrage -
Eigenheimbesitzer treiben die Energiewende voran
Über
alle Parteigrenzen hinweg sind Deutschlands Eigenheimbesitzerinnen
und -besitzer bereit, privat in Photovoltaik, Wärmepumpen und
E-Autos zu investieren. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter
mehr als 2.000 selbstnutzenden Hauseigentümerinnen und -eigentümern,
die das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Initiative
Klimaneutrales Deutschland (IKND) im August 2025 durchgeführt hat.
Aus Sicht der IKND muss nun die Politik für verlässliche
Rahmenbedingungen sorgen und deutlich machen: Investitionen in die
Energiewende lohnen sich.
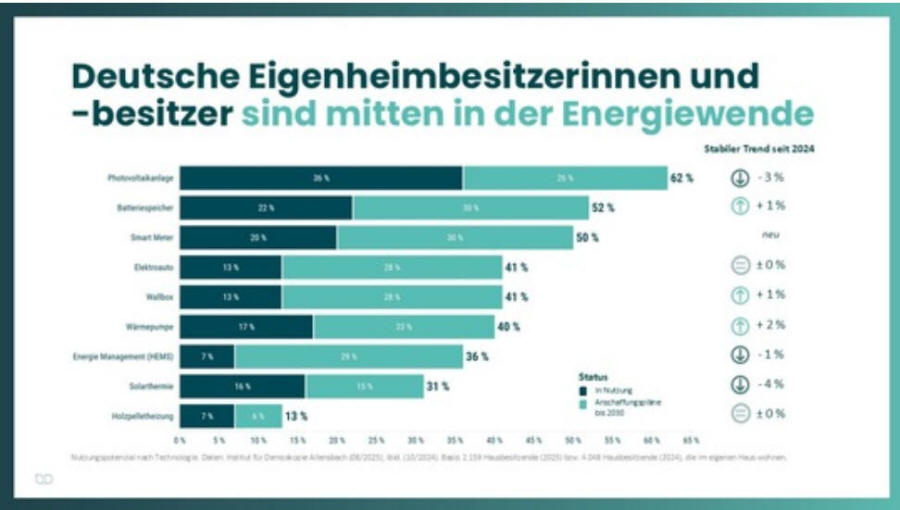
© Initiative Klimaneutrales Deutschland
- Die
Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer, die bereits klimafreundliche
Technologien nutzen, haben derzeit im Schnitt 2,6 der neun
abgefragten Technologien in Anwendung (Photovoltaik, Wärmepumpe,
E-Auto, Batteriespeicher, Smart Meter, Wallbox, Energie Management
(HEMS), Solarthermie, Holzpelletheizung).
- Mehr als 80
Prozent der Befragten könnten bis 2030 mindestens eine
emissionssparende Technologie nutzen.
- Nutzungs- sowie
Anschaffungspläne sind stabil: Bis 2030 könnten rund zwei Drittel
der Eigenheimer eine PV-Anlage nutzen, vier von zehn jeweils eine
Wärmepumpe oder ein E-Auto.
- Aber: Die Investitionsfähigkeit ist
unzureichend, vor allem bei kleinen und mittleren Einkommen.
-
Photovoltaik ist die Schlüsseltechnologie für die private
Energiewende.
Im Vergleich zur ersten Allensbach-Umfrage im
Auftrag der IKND vor einem Jahr zeigt die aktuelle Studie: Die
Nutzungs- und Anschaffungspläne der Eigenheimbesitzerinnen und
-besitzer sind stabil. Trotz des Endes der Ampelkoalition und ihrer
Klimaschutzpolitik sowie der zahlreichen Änderungen in der Energie-
und Verkehrspolitik, die Schwarz-Rot ankündigt hat, sind die
Menschen weiter bereit, privat in klimafreundliche Technologien zu
investieren.
Das Nutzerpotenzial – also, die Nutzerinnen und
Nutzer sowie diejenigen, die eine Investition planen – liegt bis
2030 bei 82 Prozent der Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer. Dann
könnten rund zwei Drittel der Eigenheimer eine PV-Anlage nutzen,
während jeweils vier von zehn eine Wärmepumpe oder ein E-Auto haben
könnten. Wer klimafreundliche Technologien einsetzt, nutzt im
Durchschnitt 2,6 der neun abgefragten Möglichkeiten.
„Die
Nutzung klimafreundlicher Technologien in privaten Eigenheimen ist
mittlerweile weit verbreitet und weitere erhebliche Potenziale sind
zu erkennen“, sagt Dr. Steffen de Sombre, Projektleiter, Institut
für Demoskopie Allensbach. „Bemerkenswert ist, dass Nutzung und
Anschaffungspläne erstaunlicherweise kaum mit den politischen
Überzeugungen zusammenhängen: Auch die Mehrheit der AfD-Wählerinnen
und -Wähler unter den Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer nutzt
oder plant PV-Anlagen. Fast jede dritte befragte Person unter den
AfD-Wählerinnen und -Wählern besitzt ein Elektroauto oder plant
dessen Anschaffung.“
Die Umfrage zeigt auch: Die
Investitionsbereitschaft ist hoch, hängt aber stark vom Einkommen
ab. Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer kommen aus der Mitte der
Gesellschaft, mehr als zwei Drittel verfügen über ein kleines bis
mittleres Einkommen. Entsprechend deutlich sind die Unterschiede bei
der Höhe der möglichen Eigeninvestitionen und dem gewünschten Bedarf
an staatlicher Unterstützung.
Für den Kauf einer Wärmepumpe
sind die Befragten mit einem Haushaltsnettoeinkommen unter 2.500
Euro monatlich durchschnittlich bereit, 11.000 Euro zu zahlen.
Befragte mit 5.000 Euro und höher können fast 21.000 Euro
investieren. Bei den niedrigen Einkommen geben 81 Prozent an,
staatliche Unterstützung für den Kauf einer Wärmepumpe zu benötigen,
bei den Befragten mit einem Einkommen von 2.500 Euro bis 5.000 Euro
sind es 60 Prozent.
Bei E-Autos ist die
Investitionsbereitschaft höher. Während Haushalte mit einem
Monatseinkommen von unter 2.500 Euro bereit sind, rund 18.000 Euro
zu investieren, sind es knapp 29.000 Euro bei einem höheren
Einkommen. Insgesamt sind 43 Prozent der Eigenheimbesitzerinnen und
-besitzer dabei auf Förderung angewiesen, bei niedrigem Einkommen
mehr als 60 Prozent, bei mittleren Einkommen knapp die Hälfte, und
bei höheren Einkommen über 5.000 Euro noch fast jeder Dritte.
Ein weiteres Fazit aus der Umfrage: Photovoltaik bleibt die
Schlüsseltechnologie für die private Energiewende. Wer bereits eine
Photovoltaik-Anlage besitzt, investiert wahrscheinlicher auch weiter
in klimafreundliche Technologien.
„Die Umfrage belegt:
Photovoltaik ist entscheidend für weitere Anschaffungen wie E-Auto,
Speicher oder Wärmepumpe. Ohne private Photovoltaik-Anlagen wird
Deutschland also seine Klimaziele nicht erreichen können“, sagt
Carolin Friedemann, Gründerin und Geschäftsführerin der Initiative
Klimaneutrales Deutschland.
„Die Eigenheimbesitzerinnen und
-besitzer brauchen Klarheit von der Bundesregierung. Sie müssen
wissen, welche Investitionsentscheidungen sich für sie lohnen. Sie
erwarten Planungssicherheit und verlässliche staatliche
Unterstützung.“
Mit der DVG sicher durch den Herbst
Wenn die
Blätter fallen, kann es für den Schienenverkehr rutschig werden: In
den Herbstmonaten stellt Laub auf den Gleisen und zwischen den
Weichen eine besondere Herausforderung dar. Die Duisburger
Verkehrsgesellschaft AG (DVG) ergreift deshalb umfangreiche
Maßnahmen, um den Betrieb auch in den Herbstmonaten zuverlässig
aufrechtzuerhalten.

Fotos Duisburger Verkehrsgesellschaft AG
In der Hauptlaubzeit – meist von Mitte Oktober bis Ende November
– sind täglich mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz,
um Schienen, Weichen und Haltestellen von Laub zu befreien. „Der
Herbst stellt den Schienenverkehr jedes Jahr aufs Neue vor
Herausforderungen“, sagt Dr. Susanne Haupt, Hauptabteilungsleiterin
Infrastrukturmanagement bei der DVG.
„Mit moderner Technik,
präventiver Wartung und einem erfahrenen Team sorgen wir dafür, dass
unsere Fahrgäste auch in dieser Jahreszeit sicher und pünktlich
ankommen.“ Besonders laubanfällige Streckenabschnitte werden
regelmäßig kontrolliert.
Laub als Gefahr für die Haftung
Feuchtes Laub wird unter den Rädern der Bahnen zu einem glatten,
schmierigen Film. Das verringert die Haftung zwischen Rad und
Schiene – die Folge können verlängerte Bremswege und Schwierigkeiten
beim Anfahren sein. Um die Sicherheit und Pünktlichkeit zu
gewährleisten, kommt in der Herbstsaison ein gezielter Einsatzplan
im Kampf gegen das Laub zum Tragen.
Sand für mehr Grip
Die Sandkästen in den Bahnen sind stets mit ausreichend Sand
befüllt. Dabei füllen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über eine
Klappe Sand für besseren Grip der Eisenräder auf den Schienen ein –
so wird eine optimale Bremswirkung sichergestellt. Das entsprechend
ausgebildete Fahrpersonal kann über die Sandanlagen bei glatter
Schiene Sand vor die Räder streuen. Die Sandanlagen, die sich in den
Fahrzeugen befinden, streuen zudem automatisch Sand vor die Räder
der Bahn.

Der Sand erhöht die Reibung zwischen Radreifen
und Gleis, sodass die Bahn nicht so leicht ins Rutschen kommen kann.
Auch bei Gefahrenbremsungen kommt der Sand automatisch zum Einsatz.
Auf dem Gelände am Betriebshof Grunewald steht ein Silo, das rund 15
Tonnen Sand fasst. Im Jahr benötigt die DVG etwa 210 Tonnen Sand.
Bei schlechten Witterungsverhältnissen passt das Fahrpersonal die
Fahrweise entsprechend an.
Schienenschleifwagen im
Dauereinsatz
Ergänzend setzt die DVG auch ihren
Schienenschleifwagen ein. Das Fahrzeug reinigt die
Schienenoberflächen mechanisch, entfernt Ablagerungen und sorgt für
einen optimalen Kontakt zwischen Rad und Schiene. Das orangefarbene
Fahrzeug ist 36 Tonnen schwer, etwa 13 Meter lang und 2,20 Meter
breit. In der Mitte des Fahrzeugs sitzt das Schleifgestell: Sechs
Schleifsteine pro Seite werden über Hydraulikzylinder auf die
Schienen gedrückt, mit Wasser gekühlt und reinigen so die Schiene.

Im Fahrsimulator sämtliche Witterungsbedingungen üben
Auch
die Fahrsimulatoren der DVG unterstützen das Fahrpersonal dabei,
sich auf schwierige Situationen und außergewöhnliche
Wetterbedingungen vorzubereiten, um im Ernstfall gut reagieren zu
können. Sämtliche Witterungsbedingungen wie Regen, Nebel, Schnee,
vereiste Oberleitungen oder andere Gefahrensituationen – Fahrerinnen
und Fahrer können ohne Risiko jede Fahrt am Fahrsimulator
simulieren. So übt das Fahrpersonal in den Simulatoren auch das
Fahren bei rutschiger und glatter Schiene.

Die Weichen stets im Blick
Auch die Weichen können durch
herabfallendes Laub beeinträchtigt sein. Das Laub kann sich in die
Weichen klemmen, worauf diese dann nicht mehr richtig anlegen, also
in die endgültige Position gehen. Deshalb kann es im Herbst sein,
dass die Weichen bei Bedarf von Hand gesäubert werden müssen. Dafür
ist jedes Fahrzeug mit einem Weichenbesen ausgestattet.
„Weidwerk & Leidenschaft“
Unter diesem
Motto lädt das Johanniter-Stift Duisburg Neudorf am Mittwoch, den
26. November 2025, ab 18:00 Uhr zu einem Abend rund um das Thema:
Wald, Wild und Weingenuss in das hauseigene Restaurant in der
Wildstraße 10, 47057 Duisburg ein.
Auch in diesem Jahr erwartet die Gäste ein ausgesuchtes
Drei-Gänge-Menü, begleitet von erlesenen Weinen und stimmungsvollen
Klängen erfahrener Jäger mit ihren Jagdhörnern. In geselliger
Atmosphäre erfahren Interessierte zudem Wissenswertes über das
traditionelle Handwerk der Jagd und das Leben der Weidmannsleute.
Der Preis für das Menü beträgt 28,50 € (exklusive Getränke).
Eintrittskarten sind ab dem 20. Oktober 2025 im Vorverkauf an
der Rezeption des Seniorenstifts erhältlich (werktags zwischen 8:00
und 12:00 Uhr oder nach Terminvereinbarung). Ganz im Sinne unseres
Mottos „regional und saisonal“ beginnt die Veranstaltung um 18:30
Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr).
Richter leben besser - Krimidinner
in Ungelsheim
Für Freitag, 17. Oktober um 19 Uhr laden
erfahrene Köchinnen und Köche aus dem Team des Projektes für Kinder
„Tischlein deck dich“ der Evangelischen Versöhnungsgemeinde
Duisburg-Süd wieder zu einem Krimidinner ins Ungelsheimer
Gemeindezentrum ein. Zwischen den Gängen raffiniert zubereiteter
Fastfoodvarianten liest Thorsten Schleif aus seinem Krimi „Richter
leben besser“.
Genießen können dieses Ereignis insgesamt 30
Personen. Wer noch mit dabei sein möchte, plant für das Vergnügen 32
Euro ein – die Getränke sind im Preis inbegriffen - und meldet sich
für den Kauf von max. vier Karten im Gemeindebüro bei Michaela Hahn
an (0203 76 11 20 oder evgds@ekir.de). Infos zur Gemeinde gibt es im
Netz unter www.evgds.de.
Das Projekt „Tischlein deck dich“ gibt es schon seit vielen
Jahren in der Gemeinde. Das Konzept kommt gut an: In der voll
ausgestatteten Küche des Ungelsheimer Gemeindezentrums - mit
Kochinsel, Kochplatten und Backöfen - bereiten Kinder im Alter ab
sechs Jahren im Team und unter Anleitung von erwachsenen Kochfans
aus frischen Lebensmitteln köstliche und gesunde Gerichte zu - und
verspeisen diese natürlich auch zusammen. Die Teilnahme ist
kostenlos.

Gemeindezentrum Ungelsheim (Foto: www.evgds.de).
Kirchenkneipe in Neudorf: Gemeinde lädt zum Auspannen ein
Am Freitag, 17. Oktober 2025 gibt es in der Evangelischen
Kirchengemeinde Hochfeld-Neudorf eine gute Gelegenheit zum Auspannen
und zum gemütlichen Wochenausklang: Um 18 Uhr geht es in
Gemeinschaft mit anderen beim Klönen um Gott und die Welt, denn im
Gemeindezentrum an der Gustav-Adolf-Str. 65 öffnet wieder die
Kirchenkneipe.
Engagierte, die die Aktion vorbereiten, laden
herzlich zur Begegnung ein. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.hochfeld-neudorf.de.

Todesursachen 2024: Immer mehr Menschen versterben an
Demenz
• 4,4 % mehr Sterbefälle aufgrund einer
Demenzerkrankung als im Vorjahr
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und Krebs machen als häufigste Todesursachen mehr als die Hälfte
(56,5 %) aller Sterbefälle aus
• Zahl der Sterbefälle insgesamt
um 2 % geringer als im Vorjahr
Die Zahl der an Demenz
verstorbenen Menschen in Deutschland ist weiter gestiegen. So wurden
im Jahr 2024 nach den Ergebnissen der Todesursachenstatistik 61 927
Sterbefälle durch eine Demenzerkrankung verursacht. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 4,4 % mehr als
im Vorjahr und 23,2 % mehr als im zehnjährigen Durchschnitt der
Jahre 2015 bis 2024.
Demenz in ihren verschiedenen
Ausprägungen ist seit Jahren eine der häufigsten Todesursachen bei
Frauen und nimmt auch bei Männern stetig zu. So war die Zahl der an
Demenz verstorbenen Männer im Jahr 2024 mit 21 247 Verstorbenen um
27,9 % höher als im Zehnjahresdurchschnitt. Demgegenüber starben 40
680 Frauen an Demenz, das waren lediglich 20,8 % mehr als im
Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2024.
Rund 89,1 % der im Jahr 2024 an Demenz Verstorbenen waren 80
Jahre und älter. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der durch
Demenz verursachen Sterbefälle in der Altersgruppe ab 80 Jahren um
4,6 %. Im Vergleich zum Zehnjahresdurchschnitt war dabei der Anstieg
bei Männern ab 80 Jahren mit +32,9 % besonders stark, während der
Anstieg bei Frauen derselben Altersgruppe nur bei 22,2 % lag.
2,6 % weniger Verstorbene aufgrund von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen als im Vorjahr Insgesamt starben im Jahr
2024 in Deutschland rund 1,01 Millionen Menschen. Das waren 2 %
weniger als im Jahr 2023 (1,03 Millionen Verstorbene). Damit sank
die Zahl der Sterbefälle im zweiten Jahr in Folge.
Die
häufigsten Todesursachen waren wie in den Vorjahren Krankheiten der
Kreislaufsysteme (339 212) und bösartige Neubildungen (230 392) – an
ihnen starben mit 56,5 % mehr als die Hälfte der Verstorbenen. Die
Sterbefälle aufgrund von bösartigen Neubildungen, hierzu zählen
sämtliche Krebsarten, blieben fast unverändert zum Vorjahr
(+0,04 %).
Bei den Krankheiten der Kreislaufsysteme, dazu zählen
unter anderem Herzinfarkt (Myokardinfarkt) und Schlaganfall, gab es
einen leichten Rückgang (-2,6 %).
Demenz bei Frauen
häufigste Todesursache, Lungenkrebs bei Männern auf Platz zwei
Krankheiten der Kreislaufsysteme und bösartige Neubildungen
dominieren die Todesursachen auch bei einer getrennten Betrachtung
nach Geschlecht: Zu den drei häufigsten Todesursachen von Männern
zählen die chronische ischämische Herzkrankheit (39 765), bösartige
Neubildungen der Bronchien und der Lunge (26 441) und der akute
Myokardinfarkt (24 875).
Die drei häufigsten Todesursachen von
Frauen waren nicht näher bezeichnete Demenz (37 109), chronische
ischämische Herzkrankheit (30 955) und Herzinsuffizienz (22 349).
Zahl der Bucheinzelhändler binnen fünf Jahren um 24
% gesunken
Die Zahl der Bucheinzelhändler in
Deutschland ist auf einen neuen Tiefstand gesunken. Gut 2 980
solcher Einzelhandelsunternehmen gab es im Jahr 2023. Das entspricht
einem Rückgang um knapp ein Viertel (24 %) innerhalb von fünf
Jahren, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der
Frankfurter Buchmesse vom 15. bis 19. Oktober mitteilt. Im Jahr 2018
hatte es noch rund 3 930 Unternehmen im Bucheinzelhandel gegeben.
Mögliche Gründe für die Entwicklung könnten neben steigenden Mieten
und Personalkosten auch ein geändertes Kaufverhalten sein.
NRW-Industrie: 2024 fast 40 % weniger Milch produziert als
2015
* Absatzwert trotz Mengenrückgangs um 4,7 %
gestiegen
* NRW-Anteil lag 2024 bei 11,9 % an der
gesamtdeutschen Produktion
* Durchschnittlicher Wert je Liter
Milch seit 2015 um über 70 % gestiegen
In
Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2024 in acht Betrieben des
Verarbeitenden Gewerbes etwa 609 Millionen Liter Milch hergestellt
worden. Das waren 4,7 % mehr als im Vorjahr aber 39,1 % weniger als
im Jahr 2015.
Wie das Statistische Landesamt mitteilt, war der
Absatzwert mit nominal 461,9 Millionen Euro gegenüber dem Jahr 2023
nahezu unverändert (–0,2 %). Gegenüber dem Jahr 2015 stieg der
Absatzwert trotz des Mengenrückgangs um 4,7 %.
Betrachtet
wurde flüssige, verarbeitete Milch tierischen Ursprungs mit einem
Fettgehalt von über 1 bis 6 %. NRW-Anteil an gesamtdeutscher
Milchproduktion liegt bei 11,9% Im Jahr 2024 wurde bundesweit 5,1
Milliarden Liter Milch im Wert von 3,5 Milliarden Euro produziert.
Der Anteil von NRW an der gesamtdeutschen Absatzmenge lag hier bei
11,9 % und der Anteil am Absatzwert bei 13,1 %.
Durchschnittlicher Wert je Liter Milch seit 2015 um über 70 %
gestiegen
Der durchschnittliche Absatzwert je Liter Milch war
2024 mit 76 Cent um 4,6 % niedriger als im Vorjahr, aber um 72,1 %
höher als im Jahr 2015 mit damals 44 Cent je Liter.
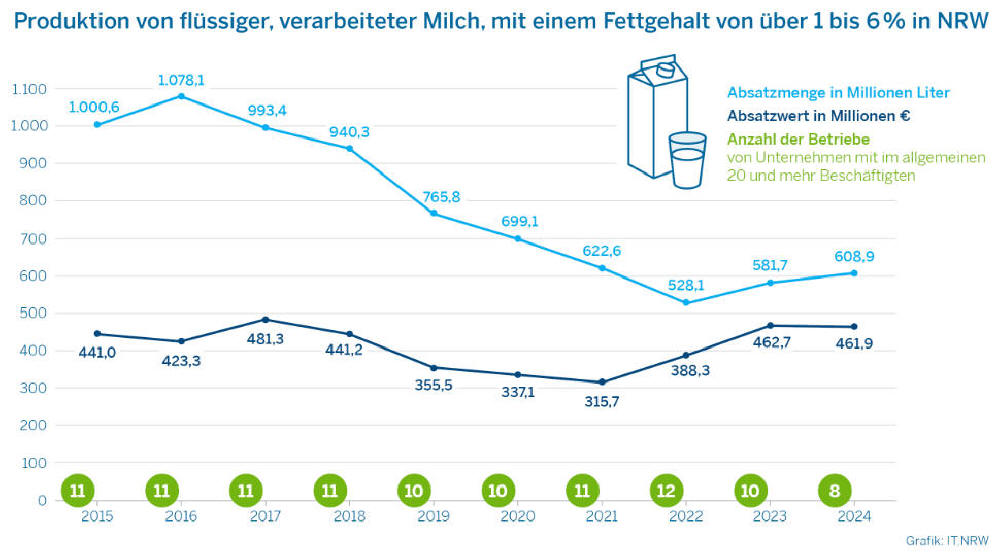
Produktion in der ersten Jahreshälfte 2025 gestiegen
Im
ersten Halbjahr 2025 produzierten nach vorläufigen Ergebnissen
sieben nordrhein-westfälische Betriebe 309,6 Millionen Liter Milch
im Wert von 250,4 Millionen Euro. Die Absatzmenge lag damit um 1,8 %
und der nominale Absatzwert um 10,2 % über dem Vorjahreszeitraum.