






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 44. Kalenderwoche:
31. Oktober
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Samstag, 1., Sonntag, 2. November 2025
Öffentliche Bekanntmachung des neuen Flächennutzungsplans
der Stadt
Mit der heutigen öffentlichen Bekanntmachung
wird der neue Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Duisburg
rechtswirksam. Die Bezirksregierung Düsseldorf hatte den neuen
Flächennutzungsplan der Stadt Duisburg mit Auflagen genehmigt. Nach
sorgfältiger Prüfung der Verfahrensunterlagen wurde die
Genehmigungsurkunde am 25. August 2025 durch Regierungspräsident
Thomas Schürmann an die Stadt Duisburg übergeben.

TechnologieCampus Wedau-Nord
Das Technologie-Quartier Wedau-Nord
ist ein geplantes großes Projekt in Duisburg, das auf dem ehemaligen
Gelände des Ausbesserungswerks der Deutschen Bahn entsteht. In dem
modernen Quartier sollen Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
gebündelt werden. Fotos Ilja Höpping / Stadt Duisburg

TechnologieCampus Wedau-Nord
Das Technologie-Quartier
Wedau-Nord ist ein geplantes großes Projekt in Duisburg, das auf dem
ehemaligen Gelände des Ausbesserungswerks der Deutschen Bahn
entsteht. In dem modernen Quartier sollen Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft gebündelt werden.

Waldentwicklung
Hochfeldstraße (n Rumeln-Kaldenhausen
Der am 24.02.2025 vom Rat
beschlossene FNP legt die städtebaulichen Leitlinien für die
nächsten 10 bis 15 Jahre fest.
Der FNP ist das zentrale
Planungsinstrument der Stadtentwicklung und bildet den Rahmen für
die zukünftige Nutzung von Flächen in Duisburg. Ziel ist es, eine
nachhaltige Stadtentwicklung zu sichern, den steigenden
Flächenbedarf für beispielsweise Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur
sowie Freizeitangebote mit den Belangen des Klima- und Naturschutzes
in Einklang zu bringen und zugleich die Lebensqualität in Duisburg
weiter zu stärken.

Duisburger Dünen
Oberbürgermeister Sören Link ist vom neuen
FNP überzeugt und erklärt hierzu: „Mit dem neuen Flächennutzungsplan
setzen wir einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft unserer
Stadt. Er ermöglicht uns, die Entwicklung Duisburgs aktiv zu
gestalten – in einer Balance zwischen Wohnraum, Wirtschaft,
Infrastruktur und Klimaschutz. Der Plan ist zugleich flexibel genug,
um auf neue Herausforderungen reagieren zu können.“

Potenzialfläche für eine mögliche Erweiterung des Schulzentrums
Biegerhof Ost in Huckingen
Der neue Flächennutzungsplan hat
einen Zeithorizont von rund 15 Jahren, bleibt aber dynamisch: Er
wird künftig an neue Erfordernisse angepasst und bei Bedarf
fortgeschrieben. Insgesamt flossen in das Verfahren rund 580
Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern sowie circa 250 Beiträge
von Behörden und Trägern öffentlicher Belange ein. Alle
Informationen zum Flächennutzungsplan sind online auf
www.duisburg.de/fnp einzusehen.
Duisburg erneut als
„Fairtrade-Stadt” ausgezeichnet
Duisburg erfüllt auch
weiterhin die Kriterien für einen fairen Handel und erhält daher für
die nächsten zwei Jahre erneut die Auszeichnung „Fairtrade-Stadt“.
Die Kampagne steht für das Engagement vieler Akteurinnen und
Akteure, die sich vor Ort für einen fairen Handel einsetzen. „Ich
freue mich sehr über die Titelerneuerung und das stetige Engagement
der Fairtrade-Stadt Duisburg Gruppe.
Viele Menschen, auch
aus dem Ehrenamt, ziehen hier an einem gemeinsamen Strang für dieses
wichtige Thema“, so Beigeordnete Linda Wagner, Dezernentin für
Umwelt- und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur
der Stadt Duisburg. Bereits seit 2013 erfüllt Duisburg alle
Kriterien der Kampagne für den Fairen Handel. Eine Steuerungsgruppe,
bestehend aus Stadtverwaltung, Politik, Vereinen, Kirchen,
Gastronomie, Schulen und weiteren Institutionen, koordiniert alle
Aktivitäten.
„Ein wichtiges Ziel ist es, das Bewusstsein für
den fairen Handel in Duisburg gemeinsam mit den vielen engagierten
Akteurinnen und Akteuren des fairen Handels weiter auszubauen“,
betont André Spans vom Umweltamt und Koordinator der
Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Duisburg.
Neben fair
gehandelten Produkten, die beispielsweise im Einzelhandel und in
gastronomischen Betrieben angeboten werden, fanden in den
vergangenen zwei Jahren auch zahlreiche Veranstaltungen zum Thema
"Fairer Handel" statt. Dazu zählen etwa das „Fair Fashion Forum Ruhr
- NRW", der jährlich stattfindende „Umweltmarkt & Eine-Welt-Bazar",
die „Faire Woche“, Vorträge oder auch Schulaktionen.
Zudem
vermitteln die Duisburger „Fairtrade-Schools“ und die „Faire Kitas“
den Jüngeren, weshalb das Engagement für den Fairen Handel wichtig
ist. Weitere Informationen zur „Fairtrade-Stadt“ sowie die Urkunde
von Fairtrade Deutschland e. V. finden sich auf der städtischen
Internetseite unter
https://duisburg.de/fairtradestadt.
Dort gibt es unter
anderem auch den „Kundenkompass“, in dem Gastronomiebetriebe, Cafés
und Einzelhändler gelistet sind, die faire Produkte in Duisburg
anbieten. Außerdem stehen dort Informationen für Schulen, Kitas und
Händler zur Verfügung, die sich ebenfalls an der Fairtrade- Kampagne
beteiligen möchten.
„Simply the Best“: Briefmarke
erinnert an Tina Turner
Deutsche Post erweitert
Sonderbriefmarken-Serie „Legenden der Pop-/ Rockmusik“ um die „Queen
of Rock’n’Roll“ - Marke ab 3. November in Postfilialen und online
erhältlich
Die Deutsche Post ehrt Tina Turner mit einer
eigenen Sonderbriefmarke. Die „Queen of Rock’n’Roll“ wird nach Jimi
Hendrix (2023) und Freddie Mercury (2024) die erste Musikerin, die
Teil der Briefmarken-Serie „Legenden der Pop-/Rockmusik“ wird. Damit
würdigt die Deutsche Post die großen Erfolge des Weltstars, der auch
in Deutschland sehr populär war.

Songs wie “Nutbush City Limits", "The Best", "What's Love Got to Do
with It" und "GoldenEye” schafften es in die Top 10 der deutschen
Charts, „We Don't Need Another Hero" landete 1985 - vor 40 Jahren -
sogar auf Platz 1. Zudem füllte Tina Turner hierzulande die größten
Konzerthallen, zuletzt auf ihrer Abschiedstournee mit dem Namen
„Tina!: 50th Anniversary Tour“, die sie 2009 nach Köln, Berlin,
Hamburg, Hannover, Mannheim und München führte.
Die
Sonderbriefmarke ist ab dem 3. November in Postfilialen mit
Vollsortiment, im Online-Shop oder telefonisch beim Bestellservice
der Deutschen Post erhältlich (Tel.: 0961 – 3818 – 3818). Gestaltet
wurde sie von Jan-Niklas Kröger, Briefmarken-Designer der Deutschen
Post. In den Philatelieshops, im Online-Shop oder beim
Bestellservice können zudem Produkte rund um die Briefmarke erworben
werden.
Über den Online-Shop und Bestellservice ist zudem
eine limitierte Gold-Edition der Briefmarke, bestehend aus der
Briefmarke mit der laufenden Nummer 1-1.000 und dem Abbild der
Briefmarke mit echtem Gold in einem hochwertigen Hardcover
erhältlich. Die Marke hat den Portowert 95 Cent, mit dem z.B. ein
Standardbrief (bis 20g) innerhalb Deutschlands frankiert werden
kann. Offizieller Herausgeber ist das Bundesministerium der
Finanzen.
Benjamin Rasch, Leiter Produktmanagement und
Marketing der Deutschen Post: „Es ist uns eine Freude, Tina Turner
mit einer Sonderbriefmarke zu ehren. Sie war zu Lebzeiten ein
internationaler Superstar und auch in Deutschland sehr beliebt. Noch
heute erinnern sich die Menschen an ihre Hits. Deshalb war für uns
klar, dass sie als erste Musikerin in unsere Sondermarken-Serie
‚Legenden der Pop-/Rockmusik‘ aufgenommen werden muss. Sicherlich
werden sich viele ihrer Fans freuen, ihre Post jetzt mit ihrem Idol
frankieren zu können.“
Über Tina Turner
Tina Turner wurde
am 26. November 1939 als Anna Mae Bullock in Brownsville, Tennessee
(USA), geboren. Sie wuchs im nahegelegenen Nutbush auf und sang im
Gospelchor der Baptistenkirche. Mit siebzehn zog sie nach St. Louis,
Missouri, wo sie Ike Turner traf, der sie als Sängerin für seine
Band Kings of Rhythm engagierte. Er gab ihr den Bühnennamen Tina
Turner, und sie heirateten später.
Die beiden hatten in den
1960er und 70er Jahren großen Erfolg mit Songs wie „Nutbush City
Limits“, „Proud Mary“ und dem von Phil Spector produzierten „River
Deep - Mountain High“. Tinas Stimme und Bühnenpräsenz setzten
bereits neue Maßstäbe in der Musikindustrie. Wenige wussten jedoch
zu der Zeit, dass Tina unter fortwährenden Misshandlungen durch Ike
litt, von dem sie sich 1976 trennte und zwei Jahre später scheiden
ließ.
Die Trennung markierte das Ende von Tina Turners erster
globaler Karriere. Es dauerte eine Weile, bis sie sich neu
etablierte. 1983 feierte sie mit ihrem fünften Soloalbum „Private
Dancer“ ein bemerkenswertes Comeback, insbesondere mit dem
weltweiten Hit „What’s Love Got To Do With It“. Danach war Tina
Turner nicht mehr aufzuhalten und verkaufte über 100 Millionen
Alben.
Zu ihren bekanntesten Songs gehören „I Don’t Wanna
Lose You“, „Steamy Windows“, „The Best“, das James-Bond-Thema
„GoldenEye“ und „We Don’t Need Another Hero“ aus „Mad Max Beyond
Thunderdome“, in dem sie die mittlerweile legendäre Figur Aunty
Entity spielte. Tina Turner veranstaltete auch rekordbrechende
Welttourneen: Die Break Every Rule World Tour war die umsatzstärkste
Tour der 80er-Jahre einer weiblichen Künstlerin, in Brasilien brach
sie den Rekord für das größte zahlende Publikum aller Zeiten.
Nach über fünf Jahrzehnten im Dienste von Rock’n’Roll, R&B,
Soul, Funk und allem dazwischen – und nach Abschluss ihrer „Tina!:
50th Anniversary Tour“ – zog sie sich 2009 zurück und lebte mit
ihrem zweiten Ehemann Erwin Bach in Küsnacht, Schweiz. Tina, die
„Queen of Rock’n’Roll“, verstarb am 24. Mai 2023
Wie lebten privilegierte und benachteiligte Familien
im industriellen Duisburg
Wie haben die Menschen vor
mehr als 100 Jahren ihren Alltag in Duisburg erlebt? Antworten auf
diese Frage bietet am Sonntag, 2. November um 15 Uhr, eine Führung
durch die Sonderausstellung „Stolz und Vorteil – Duisburger Familien
zwischen 1870 und 1930“ im Kultur- und Stadthistorischen Museum am
Johannes-Corputius-Platz 1.
Werner Pöhling, der fast vier
Jahrzehnte im Stadtmuseum gearbeitet hat, beleuchtet das Leben in
Zeiten des industriellen Wandels. Anhand ausgewählter Portraits,
Möbelstücke und weiterer Alltagsgegenstände schildert er die
Lebensumstände wohlhabender und benachteiligter Familien von der
Kaiserzeit bis zur Weimarer Republik – und schlägt dabei immer
wieder Brücken zur Gegenwart und zu heutigen sozialen Fragen.
Die Teilnahme ist im Museumseintritt enthalten und kostet für
Erwachsene 4,50 Euro, für Kinder und ermäßigt 2 Euro. Das gesamte
Programm des Museums ist unter www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.
Neue Ausstellung in der Bezirksbibliothek Buchholz
„Die schönsten Orte in NRW!“ ist der Titel einer
Fotoausstellung von Sebastian Schneider, die von Dienstag, 4.
November, bis Samstag, 20. Dezember, in der Bezirksbibliothek
Buchholz, Sittardsberger Allee 14, zu sehen ist. Der Duisburger
Fotograf zeigt auf spektakulären Fotografien besondere Orte aus ganz
Nordrhein-Westfalen, die er bei Reisen quer durch das Bundesland
eingefangen hat.
Am Samstag, 8. November, kann man sich ab
11 Uhr auch persönlich mit dem Künstler über seine Werke
austauschen. Die Ausstellung kann zu den regulären Öffnungszeiten
der Bibliothek kostenfrei besichtigt werden (dienstags bis freitags
von 10.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13
Uhr).
Spiele- und Puzzletausch in der
Bezirksbibliothek Homberg-Hochheide
Die
Bezirksbibliothek Homberg-Hochheide lädt am Samstag, 8. November,
von 10 bis 13 Uhr in die Zweigstelle auf der Ehrenstraße 20 alle
Spiele- und Puzzlebegeisterten herzlich zu einer Tauschbörse ein.
Besucherinnen und Besucher können ihren ausgedienten aber gut
erhaltenen Spieleschätzen ein neues Zuhause bieten und selbst
Neuentdeckungen für das heimische Spieleregal ergattern.
Egal ob Brettspiele oder Puzzles, alte Favoriten oder moderne
Klassiker – all das können Gesellschaftsspiel-Fans hier
untereinander tauschen. Die Veranstaltung bietet nicht nur die
Möglichkeit, neue Lieblingsspiele zu entdecken, sondern auch mit
Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. Die Spiele und Puzzle müssen
natürlich vollständig und in einem guten Zustand sein.
Die
Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei
Fragen steht das Team der Homberger Bibliothek gerne persönlich oder
telefonisch unter 02066 34650 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind
dienstags bis freitags von 10:30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr
sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.
Arbeiten im Ruhestand verbreitet – 55 Prozent
der mitbestimmten Betriebe beschäftigen Rentner*innen oder
Pensionär*innen
Die Beschäftigung von Rentner*innen und
Pensionär*innen ist in vielen Betrieben und öffentlichen
Dienststellen verbreitet. Das zeigt eine neue Auswertung der
Betriebs- und Personalrätebefragung des Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.*
Mehr als die Hälfte der befragten knapp 3.700 Betriebs- und
Personalräte berichtet, dass in ihren Einrichtungen Menschen über
das Renten- oder Pensionsalter hinaus tätig sind. Diese
Beschäftigung folgt oft einem stabilen Muster: 82,5 Prozent der
Betriebs- und Personalräte, in deren Betriebe Ruheständler*innen
arbeiten, berichten, dass die Betroffenen bereits vor Renten- oder
Pensionsbeginn in derselben Einrichtung tätig waren. Und wenn sie
weiterbeschäftigt werden, führen sie auch in der Regel ihre
bisherige Tätigkeit fort.
Rentner*innen und Pensionär*innen
gehen ihrer Arbeit jedoch meist mit reduzierter Stundenzahl und ganz
überwiegend in Minijobs nach. „Offensichtlich ist also unter den
bestehenden Rahmenbedingungen bereits viel möglich und die
Beschäftigung dieser Personengruppe folgt auch den Wünschen und
Fähigkeiten der Betreffenden und den Einsatzmöglichkeiten in
Branchen und Betrieben“, schreiben die Studienautoren Dr. Florian
Blank und Dr. Wolfram Brehmer. Die Befunde sind auch vor dem
Hintergrund aktueller politischer Diskussionen interessant.
Die Bundesregierung will über Steuererleichterungen („Aktivrente“)
sowie vereinfachte Befristungsmöglichkeiten die Beschäftigung im
Rentenalter fördern. Die Wissenschaftler warnen vor Nebenwirkungen
der Pläne: Im ungünstigsten Fall könnten Arbeitgeber die geplante
Förderung missbrauchen, um Ältere auszunutzen und Löhne zu drücken.
Die WSI-Befragung ist repräsentativ für Betriebe und Dienststellen
mit mehr als 20 Beschäftigten und Betriebs- oder Personalrat.
Die Daten von 2023 zeigen, dass rund 55 Prozent der mitbestimmen
Betriebe Menschen beschäftigen, die eine Altersrente oder Pension
beziehen. Dabei unterscheiden sich Privatwirtschaft und öffentlicher
Dienst kaum voneinander. In den genannten Betrieben machen
Beschäftigte im Rentenalter 1,4 Prozent der Belegschaft aus.
Überdurchschnittlich häufig arbeiten sie in kleineren Betrieben und
in Dienstleistungsbranchen.
In der Befragung sollten
Betriebs- und Personalräte auch angeben, aus welchen Gründen Ältere
weiterbeschäftigt werden. 86 Prozent sagten, Wissen und Fähigkeiten
der Älteren würden im Betrieb weiter gebraucht. Knapp 57 Prozent
gaben zu Protokoll, dass keine anderen Arbeitskräfte verfügbar
gewesen seien und fast ebenso viele, dass sich Rentner*innen und
Pensionär*innen flexibel einsetzen ließen.
Andere Gründe –
Jüngere einarbeiten, Kostenersparnisse – spielten eine geringere
Rolle. 89 Prozent gaben zudem an, dass mit der Weiterbeschäftigung
den Interessen der Rentner*innen entsprochen werde.
Ruheständler*innen werden am häufigsten in Form von Minijobs
weiterbeschäftigt. Dies gilt vor allem für die private Wirtschaft.
In aller Regel arbeiten Ruheständler*innen, die im alten Betrieb
weiterbeschäftigt sind, auch in ihrem alten Tätigkeitsbereich.
Dabei genießen sie üblicherweise keine Vergünstigungen in Form
von weniger anstrengenden Aufgaben oder weniger Verantwortung. Sie
werden „eingesetzt und behandelt wie jüngere Beschäftigte“, so die
Forscher. Im Vergleich zu Jüngeren haben sie aber meist eine
geringere Wochenarbeitszeit, können ihre Arbeitszeiten relativ stark
selbst bestimmen und müssen keine Nacht- und Schichtarbeit leisten.
Es sei schwer zu sagen, ob die „Aktivrente“ und erleichterte
sachgrundlose Befristungen zu noch mehr Beschäftigung im Rentenalter
beitragen könnten, schreiben Blank und Brehmer. Zumal viele
Beschäftigte lieber früher als später in den Ruhestand wechseln
möchten und auch viele Unternehmen Möglichkeiten für einen früheren
Ausstieg aus dem Arbeitsleben anbieten.
Die Wissenschaftler
sehen aber eine gewisse Gefahr darin, dass die geplanten
Gesetzesänderungen einen neuen „zweitklassigen
Arbeitnehmer*innenstatus“ schaffen könnten, mit älteren
Beschäftigten, die arbeitsrechtlich weniger geschützt sind als ihre
jüngeren Kolleg*innen. „Im schlimmsten Fall würde die Verbindung aus
der Rente beziehungsweise Pension und der Steuererleichterung im
Sinne eines Kombilohns wirken“, erklären Blank und Brehmer. Dann
liefe es auf eine Subventionierung von Unternehmen hinaus, die
Ältere – die dank Rente weniger auf den Verdienst angewiesen sind –
mit geringeren Löhnen abspeisen könnten.
Das könnte wiederum
Druck auf die Einkommen der regulär Beschäftigten ausüben. „Anstelle
der geplanten Änderungen, deren Wirkungen völlig unklar sind und die
für den Staatshaushalt eine deutliche Belastung darstellen können,
sollte der Fokus auf gute Arbeit, auf die Gesundheit der
Beschäftigten und auf Anerkennung ihrer Leistungen gelegt werden“,
sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin
des WSI. „Davon würden alle Beschäftigten, jüngere wie ältere,
profitieren und sicher würden auch die Fähigkeit und die
Bereitschaft steigen, länger zu arbeiten.“
Bauturbo: Wichtiger Impuls für bezahlbares Wohneigentum, wenn
verantwortlich genutzt
Der Verband Wohneigentum fordert
Sorgfalt bei Umsetzung und Evaluierung. Mit dem
„Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur
Wohnraumsicherung“ – kurz Bauturbo – hat die Bundesregierung ein
zentrales Element ihrer Wohnungsbauoffensive umgesetzt. Der Verband
Wohneigentum begrüßt das Ziel, Verfahren zu vereinfachen und neue
Spielräume für den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Positiv
sei insbesondere, dass nun auch private Eigentümerinnen und
Eigentümer von den Erleichterungen profitieren können.
„Der
Bauturbo kann dabei helfen, Wohneigentum für Menschen erreichbarer
zu machen – etwa durch einfachere Genehmigungen bei
Dachaufstockungen und Anbauten oder bei der Umnutzung leerstehender
Gebäude“, erklärt Peter Wegner, Präsident des Verbands Wohneigentum.
„Gerade für Familien, die ihr Zuhause erweitern oder für
Generationenwohnen umbauen wollen, entstehen damit neue
Möglichkeiten. Diese Impulse für den Bestand sind ein wichtiger
Baustein für bezahlbares Eigentum.“
Das Gesetz erlaubt
befristet bis Ende 2030, in bestimmten Fällen von Bauvorschriften
abzuweichen, wenn die Gemeinde zustimmt. Damit können Kommunen
schneller auf lokale Wohnraumbedarfe reagieren, insbesondere bei
Nachverdichtung und Bestandsumbau (§ 246e BauGB). „Umbau, Sanierung
und Nachverdichtung im Bestand sind die nachhaltigste Form des
Bauens“, betont Verena Örenbas, Bundesgeschäftsführerin des
gemeinnützigen Verbands.
„Wenn Genehmigungen für solche
Maßnahmen künftig einfacher werden, ist das auch ein Gewinn für den
Klimaschutz. Wichtig ist, dass dabei Umwelt- und
Nachbarschaftsbelange nicht unter die Räder kommen.“ „Sorgfalt muss
Vorrang vor Tempo haben“ Kritisch sieht der Verband Wohneigentum,
dass das Gesetz auch Abweichungen von Lärm- und
Umweltschutzstandards ermöglicht. „Eigentum braucht gesunde
Lebensbedingungen. Hier muss Sorgfalt Vorrang vor Tempo haben“,
mahnt die Juristin Örenbas.
Positiv bewertet der Verband
hingegen, dass Gemeinden das finale Entscheidungsrecht behalten. Sie
können über Abweichungen vor Ort entscheiden und so eine gute
Balance zwischen Beschleunigung, Qualität und Nachhaltigkeit wahren.
„Jetzt kommt es darauf an, dass Kommunen und Länder die neuen
Freiräume verantwortungsvoll nutzen – für mehr Wohneigentum,
klimafreundliche Umbauten und lebenswerte Quartiere“, resümiert
Verbandspräsident Peter Wegner.
Forderung: umfassende
Evaluierung Der Verband Wohneigentum fordert, die Wirkung des
Gesetzes nach Auslaufen der Befristung Ende 2030 umfassend zu
evaluieren. Nur so könne sichergestellt werden, dass der Bauturbo
tatsächlich zu mehr Wohneigentum, nachhaltiger Bestandsentwicklung
und resilienten Siedlungsstrukturen beiträgt.
Clapton und mehr im Obermeidericher
Gospelgottesdienst
Am 2. November 2025
erklingen ab 17 Uhr in der Kirche an der Emilstraße 27
mitreißende Songs von Micha Keding, Peter Sandwall und
Eric Clapton: Die Evangelische Kirchengemeinde
Obermeiderich feiert nämlich einen Gospelgottesdienst und
der Projektchor der Gemeinde präsentiert, was er in
mehreren Proben seit September einstudiert hat und rahmt
damit den Gottesdienst wunderbar musikalisch ein.
Die musikalische Leitung und Begleitung am Flügel hat
Popkantor Daniel Drückes übernommen, der für die
kurzfristig erkrankte Kantorin Gundula Heller einspringt.
Die liturgische Leitung des Gottesdienstes - er trägt das
Motto „Rejoice!“ (Freut euch!) - hat Pfarrerin Sarah
Süselbeck. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.obermeiderich.de.

Gemeinsames Chorkonzert 2018 in der Obermeidericher Kirche
(Foto: Michael Schurmann).
Kunsthandwerk und Schönes auf dem Martinsmarkt - Gemeinde
lädt zum Stöbern und zur Begegnung nach Wanheim
Der
Martinsmarkt im Gemeindehaus Wanheim, Beim Knevelshof 45, ist in der
Evangelischen Rheingemeinde Duisburg schon gute Tradition. So öffnen
sich dort in diesem Jahr die Türen am 2. November pünktlich um 11.30
Uhr nach dem Gottesdienst. Bis 17 Uhr können Interessierte in
entspannter Atmosphäre Handwerkskunst bestaunen und erwerben.
An den Ständen gibt es dann unter dem Motto „Kunsthandwerk &
Schönes“ handgefertigte Schmuckstücke, leuchtend gebastelte
Kleinigkeiten, kreative Stickerei und Strickkunst, Lichterketten
sowie allerlei Dinge aus Holz, feine Mitbringsel aus Papier und
schöne Sachen aus Leinen-Stoff und vielfältig gefilzter Wolle. Wer
vom Shoppen Hunger bekommt, verköstigt sich mit Erbsensuppe,
Würstchen, Brot, Linsenbolognese mit Nudeln und natürlich mit
Kuchen.
Neben den vielen guten Angeboten bleibt sicher auch
Zeit für einen netten Plausch bei einer Tasse Kaffee. Organisiert
wird der Martinsmarkt von einem ehrenamtlichen Team um Ute Theisen,
seit 25 Jahren Presbyterin in der Gemeinde. Sie beantwortet auch
gerne Fragen rund um den Markt unter
ute.theisen.1@ekir.de.

Gemeindehaus Knevelshof zur honorarfreien Verfügung (Foto: Falko
Stampa).
Klönen, Kaffee und jede Menge Kuchen beim Neumühler
Turmcafé
Am Sonntag, 2. November, öffnet wieder das
beliebte Turmcafé der Evangelischen Kirchengemeinde Neumühl von
15 bis 17 Uhr in der Gnadenkirche am
Hohenzollernplatz/Obermarxloher Straße seine Türen. Auch dieses
Mal gibt es zu Kaffee und Tee leckere, meist selbstgebackene
Kuchen.
Das Turmcafé wird immer von unterschiedlichen
Gruppen der Gemeinde durchgeführt. Organisation, Service und
Bewirtung übernehmen diesmal die frühere Presbyterin und
„Turmcafé-Urgestein“ Gisela Usche und ihr Team. Der Verkaufserlös
von Kaffee und Kuchen fließt wieder in die Instandhaltung der
Gnadenkirche. Kuchenspenden sind gern gesehen und können im Alten
Pfarrhaus, Obermarxloher Straße 40, Tel. 0203 / 580448, abgegeben
werden.

Zahl der unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung
2025 um 5,6 % gesunken
• Zahl der betreuten Kinder
unter drei Jahren sinkt im zweiten Jahr in Folge, Betreuungsquote
steigt dennoch auf 37,8 %
• Erstmals sinkt auch die
Gesamtzahl der betreuten Kinder, demgegenüber weiterhin Zuwachs
bei Kitas und Beschäftigten
• Zahl der Tagesmütter und -väter
geht im fünften Jahr in Folge zurück WIESBADEN –
Die Zahl
der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuung ist zum
Stichtag 1. März 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 47 100 oder
5,6 % auf insgesamt 801 300 Kinder gesunken. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm die Zahl der unter
Dreijährigen in Kindertagesbetreuung damit im zweiten Jahr in
Folge ab (2024: -8 200 Kinder bzw. -1,0 % zum Vorjahr).
Dennoch stieg die Betreuungsquote unter Dreijähriger leicht auf
37,8 % (2024: 37,4 %). Der Anstieg der Betreuungsquote trotz
rückläufiger Betreuungszahlen ist darauf zurückzuführen, dass die
Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren stärker zurückging als
die Zahl der betreuten Kinder dieser Altersgruppe.
Die
Ursache dafür sind die sinkenden Geburtenzahlen der vergangenen
drei Jahre. Auch die Zahl der insgesamt betreuten Kinder ist
gesunken, während die Zahl der Kitas und die Zahl der
Beschäftigten in Kindertagesstätten weiter anstiegen.
Insgesamt 0,8 % weniger Kinder in Kindertagesbetreuung
Insgesamt waren am 1. März 2025 bundesweit 4 059 400 Kinder in
Kindertagesbetreuung. Das waren 33 800 oder 0,8 % weniger als im
Vorjahr. Damit war die Gesamtzahl der betreuten Kinder erstmals
seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2006 rückläufig, nachdem sie
zuvor kontinuierlich um durchschnittlich 60 500 Kinder pro Jahr
(+1,7 %) gestiegen war.
Bereits im Jahr 2024 war der
Anstieg nur gering (+0,1 %).
Von den insgesamt betreuten
Kindern wurden 3 913 400 (96,4 %) in einer Kindertageseinrichtung
betreut. 146 000 Kinder (3,6 %) wurden in einer öffentlich
geförderten Kindertagespflege, etwa durch Tagesmütter oder
-väter, betreut.
Betreuungsquoten unter Dreijähriger im
Osten nach wie vor höher als im Westen
Bei den
Betreuungsquoten unter dreijähriger Kinder gibt es nach wie vor
deutliche Unterschiede zwischen den östlichen und westlichen
Bundesländern. So waren in den östlichen Bundesländern
(einschließlich Berlin) zum Stichtag 1. März 2025
durchschnittlich mehr als die Hälfte aller Kinder unter drei
Jahren in einer Tagesbetreuung (54,9 %).
In den
westlichen Bundesländern war die Betreuungsquote mit 34,5 % nach
wie vor deutlich geringer. 0,6 % mehr Kitas, jedoch 5,9 % weniger
Tagesmütter und -väter als im Vorjahr Am 1. März 2025 gab es
bundesweit rund 61 000 Kindertageseinrichtungen. Das waren etwa
400 oder 0,6 % mehr als im Vorjahr. Die Zahl der dort als
pädagogisches Personal oder als Leitungs- und Verwaltungspersonal
beschäftigten Personen stieg um 17 500 oder 2,2 % auf 795 700.
Damit wuchs die Zahl der Beschäftigten in
Kindertageseinrichtungen weiter, obwohl die Zahl der betreuten
Kinder zurückging. Auch wenn der Anteil der Männer, die in der
Kindertagesbetreuung tätig sind, relativ gering ist, steigt
dieser stetig an. Am 1. März 2025 waren 67 400 Männer im
pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungsbereich in einer Kita
beschäftigt.
Im Vergleich zum Vorjahr waren dies 2 600
oder 4,0 % mehr. Der Männeranteil – bezogen auf alle tätigen
Personen in diesen Bereichen – lag damit bei 8,5 %. Im Gegensatz
zum Kita-Personal sank die Zahl der Tagesmütter und -väter im
fünften Jahr in Folge, und zwar um 2 300 auf 37 400 (-5,9 %).
Da die Zahl der Tagesväter nahezu unverändert blieb (-0,2 %),
ist der Rückgang fast ausschließlich auf die Tagesmütter
zurückzuführen. Der Männeranteil bei den Tagespflegepersonen lag
bei 4,5 %.
NRW: 2023 war jedes zwölfte
Unternehmen eine Neugründung
* Gründungsrate in NRW
mit 8,6 % über Bundesschnitt.
* Regionale Gründungsrate
variiert von 6,6 % im Kreis Olpe bis zu 10,7 % in Herne.
*
Höchste Gründungsrate im Bereich Kunst, Unterhaltung, Erholung
und Erbringung von sonstigen Dienstleistungen.
Von den
insgesamt 665.434 in Nordrhein-Westfalen aktiven Unternehmen sind
57.336 im Jahr 2023 neu gegründet worden; rein rechnerisch
handelte es sich damit um 8,6 % bzw. jedes zwölfte Unternehmen in
NRW. Wie das Statistische Landesamt anhand der Ergebnisse der
Unternehmensdemographie mitteilt, lag die Gründungsrate im Land
mit 8,6 % über dem für das gesamte Bundesgebiet ermittelten Wert
(8,4 %). Als Gründungsrate wird der Anteil der in einem Jahr
gegründeten Unternehmen am gesamten Unternehmensbestand desselben
Jahres bezeichnet.
Bezogen auf den Gesamtbestand der
aktiven nordrhein-westfälischen Unternehmen (665.434) ergibt sich
eine Schließungsrate von 8,8 %. Regionale Unterschiede bei
Unternehmensgründungen Insgesamt gab es die meisten Neugründungen
in den beiden größten NRW-Städten Köln (5.054) und Düsseldorf
(3.487). Die höchste Gründungsrate konnte Herne mit 10,7 %
verzeichnen.
Auf den weiteren Plätzen folgten Leverkusen
(10,6 %) und Duisburg (10,1 %). Die geringsten
Gründungsraten gab es im Kreis Höxter und im Hochsauerlandkreis
(mit jeweils 6,9 %) sowie im Kreis Olpe (mit 6,6 %).
Gründungsraten variieren je nach Wirtschaftszweig
Die höchste
Gründungsrate (11,1 %) wies der Bereich Kunst, Unterhaltung,
Erholung und Erbringung von sonstigen Dienstleistungen auf. An
zweiter und dritter Stelle rangierten die Wirtschaftszweige
Information und Kommunikation mit 10,9 % und Gastgewerbe mit
10,0 %. In allen drei aufgeführten Bereichen lag die Anzahl der
Gründungen über der Anzahl der Schließungen.
Die
niedrigsten Gründungsraten fanden sich mit 6,0 % im Bereich
Erziehung und Unterricht sowie Gesundheits- und Sozialwesen und
mit 6,7 % im Bergbau, Verarbeitenden Gewerbe, Energie und
Wasserversorgung. 14,4 % mehr Gründungen als Schließungen in dem
Bereich Kunst, Unterhaltung, Erholung und Erbringung von
sonstigen Dienstleistungen.
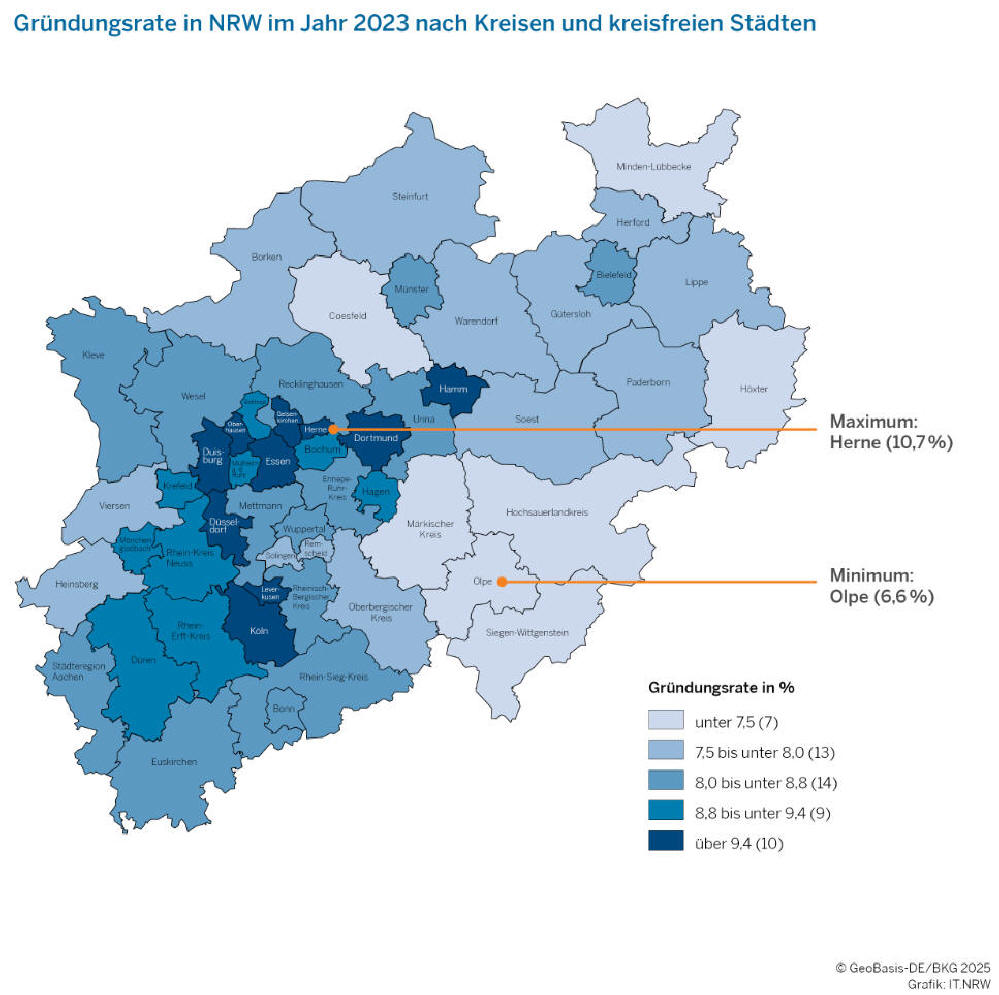
Der prozentuale Unterschied zwischen Gründungen und
Schließungen war im Bereich Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe,
Energie und Wasserversorgung am größten: Hier gab es mit 23 %
mehr Schließungen als Neugründungen. Im Wirtschaftszweig Finanz-
und Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und
Wohnungswesen, lag die Zahl der Gründungen rund 21 % über der
Zahl der Schließungen.
Baumschulen 2025: Rund 11 %
weniger Betriebe und Flächen als 2021
- Anbaufläche von
Bäumen für Parks, Alleen und Straßen steigt entgegen dem Gesamttrend
um rund 16 %
- Anteil von Laubbäumen steigt bei der Anzucht von
Forstpflanzen auf über 57 % - Niedersachsen weiterhin Bundesland mit
den meisten Baumschulen
Im Jahr 2025 bewirtschaften in
Deutschland 1 368 landwirtschaftliche Betriebe zusammen rund
15 350 Hektar Baumschulfläche. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, waren das 10,9 % oder 168 Betriebe weniger als
bei der vorherigen Erhebung im Jahr 2021. Die Baumschulfläche ging
in diesem Zeitraum um 10,5 % oder 1 810 Hektar zurück.
Gegenüber 2017 sank die Zahl der Baumschulen um 20,2 % oder
346 Betriebe und die bewirtschaftete Fläche um 17,5 %
oder 3 260 Hektar. Das Anbauspektrum der Baumschulen umfasst unter
anderem die Kultivierung von Jungpflanzen der Anbaugruppen
Ziersträucher und Bäume, Heckenpflanzen, Forstpflanzen, Obstgehölze,
Rosen und sonstige Gehölze wie beispielsweise Koniferen, zu denen
beliebte Weihnachtsbaumarten zählen.
Dabei liegen 97,8 %
(15 010 Hektar) der Baumschulfläche im Freiland. Knapp die Hälfte
der Betriebe (46,1 % bzw. 630) verfügen über Produktionsflächen
unter Glas oder hohen begehbaren Schutzabdeckungen, die zusammen
2,2 % (350 Hektar) der gesamten Baumschulfläche ausmachen.
Mehr Bäume für Parks, Alleen und Straßen trotz weniger Baumschulen
Die bedeutendste Anbaugruppe sind mit 6 770 Hektar die
Ziersträucher und Bäume (ohne Forstpflanzen). Sie wachsen im Jahr
2025 in 1 003 Baumschulbetrieben auf 45,1 % der gesamten
Freilandfläche heran. Die Produktion von Bäumen für Parks, Alleen
und Straßen ist hierbei die wichtigste Nutzungsart: Obwohl die Zahl
der produzierenden Betriebe seit 2021 um 9,3 % auf 622 Betriebe
abnahm, stieg die Fläche für die Anzucht dieser Bäume um 16,3 % auf
3 410 Hektar.
Die Ziersträucher und Laubgehölze (ohne
Heckenpflanzen) bilden eine weitere bedeutende Nutzungsart in dieser
Gruppe. 745 Betriebe erzeugen auf 1 650 Hektar diese Pflanzen, wobei
sowohl die Zahl der Betriebe als auch die bewirtschaftete Fläche
gegenüber 2021 stark rückläufig ist (-13,2 % bzw. -20,1 %). Mit
1 850 Hektar oder 12,3 % der Gesamtfläche im Freiland steht die
Anzucht von Gehölzen für die Forstpflanzung an zweiter Stelle der
Nutzungsartengruppen.
Die Zahl der Betriebe blieb hier mit
251 im Jahr 2025 nahezu unverändert gegenüber 2021 (250 Betriebe),
obwohl die Fläche in diesem Zeitraum um 8,4 % abnahm. Hielt sich die
Anzucht von Laub- und Nadelbäumen im Jahr 2021 mit jeweils rund
1 000 Hektar nahezu die Waage, liegt der Schwerpunkt im Jahr 2025
mit 57,6 % der Anzuchtfläche auf den Laubbäumen (+6,5 % auf
1 070 Hektar).
Die Jungpflanzenzucht von Nadelbäumen
verkleinerte sich dagegen um fast ein Viertel (-23,1 % auf
790 Hektar). Heckenpflanzen werden im Jahr 2025 auf 1 650 Hektar
oder 11,0 % der gesamten Baumschulfläche im Freiland von insgesamt
734 Betrieben angebaut. Mit 52,6 % und 47,4 % entfallen dabei
jeweils ähnliche Flächenanteile auf die Anzucht von Nadel- und
Laubgehölz-Heckenpflanzen.
Über ein Viertel der
Baumschulfläche befindet sich in Niedersachsen Unverändert befinden
sich im Jahr 2025 die meisten Baumschulen mit 346 Betrieben in
Niedersachsen auf einer Fläche von 4 060 Hektar, was einem Anteil
von mehr als einem Viertel (26,4 %) der gesamtdeutschen
Baumschulfläche entspricht. Danach folgen Nordrhein-Westfalen
(293 Betriebe und 3 230 Hektar) und Schleswig-Holstein (200 Betriebe
und 2 630 Hektar).