






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 47. Kalenderwoche:
20. November
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Freitag, 21. November 2025 - Bundesweiter Vorlesetag
Kommunalrat im RVR wählt Sören Link zum Vorsitzenden /
Thomas Kufen bleibt Stellvertreter
Der neu
zusammengesetzte Kommunalrat, die Runde der elf
Oberbürgermeister*innen und vier Landräte im Ruhrgebiet, hat sich
heute (20. November) beim Regionalverband Ruhr (RVR) in Essen
konstituiert und seine Arbeit aufgenommen. Zum neuen Sprecher
wählten die Stadt- und Kreisspitzen Sören Link, Oberbürgermeister
der Stadt Duisburg. Sein Stellvertreter bleibt Thomas Kufen,
Oberbürgermeister der Stadt Essen.

Die beiden frisch gewählten Vorsitzenden Thomas Kufen, OB Stadt
Essen, und Sören Link, OB Stadt Duisburg, (5 und 7 v.l.) beim ersten
Treffen des neu zusammengesetzten Kommunalrats beim RVR in Essen. ©
RVR/Wiciok
Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg
und Vorsitzender des Kommunalrats: "Ich freue mich sehr über das
Vertrauen meiner Kolleginnen und Kollegen, denn der Kommunalrat ist
eine starke Stimme im Ruhrgebiet und wichtige Klammer für die
Region. Zusammen mit dem direkt gewählten Ruhrparlament arbeiten wir
als Oberbürgermeister und Landräte an dem neuen Ruhrgebiet, das sich
seiner Stärken bewusst ist und diese selbstbewusst vertritt. Wir
wollen den Menschen im Ruhrgebiet eine Heimat mit Zukunft geben."
Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen und
stellvertretender Sprecher im Kommunalrat ergänzt: "Sich austauschen
und voneinander lernen - dieses vertrauensvolle Miteinander prägt
die Zusammenarbeit im Kommunalrat. Diesen Weg wollen wir in der
neuen Zusammensetzung weitergehen, und die Kräfte und Potenziale der
Region und im RVR noch stärker bündeln. Darum werden wir auch
intensiv prüfen, wo welche Aufgabe am besten erledigt werden kann."
RVR-Regionaldirektor Garrelt Duin sagt: "Wir werden uns im
Kommunalrat noch enger als bisher abstimmen, um selbstbewusst und
mit einer Stimme die Interessen des Ruhrgebiets in Düsseldorf,
Berlin und Brüssel zu vertreten." Der Kommunalrat ist ein wichtiges
Bindeglied zwischen den Mitgliedskörperschaften und dem RVR. Er tagt
bis zu acht Mal pro Jahr. Die Geschäftsstelle ist beim RVR
angesiedelt und bereitet die Sitzungen vor.
Dem neuen
Kommunalrat gehören an: Jörg Lukat, Oberbürgermeister Stadt Bochum,
Matthias Buschfeld, Oberbürgermeister Stadt Bottrop, Alexander Omar
Kalouti, Oberbürgermeister Stadt Dortmund, Sören Link,
Oberbürgermeister Stadt Duisburg, Thomas Kufen, Oberbürgermeister
Stadt Essen, Andrea Henze, Oberbürgermeisterin Stadt Gelsenkirchen,
Dennis Rehbein, Oberbürgermeister Stadt Hagen, Marc Herter,
Oberbürgermeister Stadt Hamm, Dr. Frank Dudda, Oberbürgermeister
Stadt Herne, Marc Buchholz, Oberbürgermeister Stadt Mülheim an der
Ruhr, Thorsten Berg, Oberbürgermeister Stadt Oberhausen,
Jan-Christoph Schaberick, Landrat Kreis Ennepe-Ruhr, Bodo Klimpel,
Landrat Kreis Recklinghausen, Mario Löhr, Landrat Kreis Unna, Ingo
Brohl, Landrat Kreis Wesel sowie RVR-Regionaldirektor Garrelt Duin.
idr
Einfaches Bauen nach dem Gebäudetyp E: BMJV und
BMWSB legen Eckpunkte vor
Bauen in Deutschland soll
einfacher, günstiger und schneller werden. Dazu kann der Gebäudetyp
E einen wichtigen Beitrag leisten. Beim Gebäudetyp E wird auf
zahlreiche Baustandards verzichtet, die gesetzlich nicht zwingend
sind. Dadurch reduzieren sich die Baukosten. Zukünftig soll es für
Vertragsparteien einfach und rechtssicher möglich sein, einen
Gebäudetyp E zu vereinbaren.
Zugleich soll der Gebäudetyp E in
der Praxis etabliert werden. Das sieht ein Eckpunktepapier vor, das
das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und das
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen heute
gemeinsam vorgelegt haben.
Bundesministerin der Justiz und
für Verbraucherschutz Dr. Stefanie Hubig erklärt dazu:
„Der
Gebäudetyp E ist ein bisschen wie Baupreisbremse und Bauturbo in
einem. Denn einfaches Bauen kostet weniger und geht schneller. Genau
dafür steht der Gebäudetyp E. Bislang wird in Deutschland fast immer
nach dem Goldstandard gebaut. Dabei geht gutes und sicheres Wohnen
oft auch günstiger. Nicht jeder braucht die fünfte Steckdose im
Wohnzimmer. Auch auf den Handtuchheizkörper im Bad legt nicht jeder
Wert, wenn es ohnehin eine Fußbodenheizung gibt.
Mit dem
Gebäudetyp-E-Vertrag wollen wir einen praktikablen Weg eröffnen, auf
hohe Baustandards zu verzichten – wenn alle Vertragsparteien das
wollen. Fachleute sind überzeugt: Dadurch lassen sich beim Bauen
erhebliche Kosten sparen. Das ist wichtig in Zeiten, in denen
bezahlbarer Wohnraum knapp ist. Wir unterstützen damit private
Bauherren bei der Verwirklichung ihres Traums vom Eigenheim. Und
auch Mieterinnen und Mieter werden profitieren, wenn der Neubau von
Wohnungen einfacher wird. Der Gebäudetyp E ist Teil unserer
Offensive für bezahlbares Wohnen.“
Bundesministerin für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Verena Hubertz erklärt dazu:
„Wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Dazu müssen wir
anders bauen und das ist der Gebäudetyp E. Gebäudetyp E heißt: Wir
bauen einfacher, schneller und günstiger, ohne an Qualität zu
sparen. Das geht, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren:
kompakte Grundrisse, robuste Materialien und weg von Schnick
Schnack, der den Bau verteuert.
Die Pilotprojekte zeigen es
längst: Fensterlüftung statt komplizierter Anlagen, weniger massive
Wände, serielle Bauweise mit schlanken Konstruktionen. Auf
Standards, die nicht unbedingt notwendig sind, kann verzichtet
werden, um allen Beteiligten das Planen und Bauen zu erleichtern.
Das gibt mehr Freiheit und sinkende Kosten für alle.“
Derzeit
muss die Baupraxis einen hohen Baustandard und zahlreiche anerkannte
Regeln der Technik einhalten, wenn nicht Gegenteiliges gesondert
vereinbart wird. Das kann dazu führen, dass eine Planung und
Bauausführung gewählt wird, die über den eigentlichen Bedarf
hinausgeht. Hier setzt der Gebäudetyp E an: Ist zum Beispiel bei den
Fenstern die Dreifachverglasung oder im Badezimmer der
Handtuchheizkörper zusätzlich zur Fußbodenheizung nicht
erforderlich, soll hier künftig eingespart werden können.
Der
Gebäudetyp E steht für einfaches bedarfsgerechtes Bauen. Zumeist
werden mit diesem Schlagwort Neubauprojekte bezeichnet, bei denen
durch einfaches und innovatives Bauen Kosteneinsparungen erzielt
werden, ohne dass dabei die Wohnqualität leidet. Das kann
beispielsweise die Konstruktion und Technik betreffen, aber auch den
Verzicht auf Komfortstandards bei der Ausstattung bedeuten. Ein
konkreter Gebäudetyp mit spezifizierten baulichen Eigenschaften ist
hingegen nicht gemeint. Der Gebäudetyp E ist sowohl beim Neubau als
auch beim Bauen im Gebäudebestand möglich.
Im Einzelnen sehen
die Eckpunkte zum Gebäudetyp E Folgendes vor:
Schaffung eines
Gebäudetyp-E-Vertrags
Es soll eine einfache und bürokratiearme
Möglichkeit eröffnet werden, einen Gebäudetyp-E-Vertrag zu
schließen. Der Vertrag soll ermöglichen, rechtssicher einfachere
Baustandards zu vereinbaren. Dabei soll an die technischen
Baubestimmungen der Länder angeknüpft werden. In den Bereichen, in
denen die technischen Baubestimmungen der Länder keine Regelungen
vorsehen, soll nur ein einfacher Standard geschuldet sein. Eine
Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik soll nicht mehr
stets zu einem Mangel führen. Der Verbraucherschutz soll dabei
gewährleistet bleiben. Wenn die Bauparteien keinen
Gebäudetyp-E-Vertrag schließen, bleibt es bei den üblichen
Standards.
Etablierung des Gebäudetyps E in der Praxis
Der
Gebäudetyp E soll in der Planungs- und Baupraxis etabliert werden.
Dazu sollen die geplanten zivilrechtlichen Regelungen mit einer
Vielzahl von Maßnahmen begleitet werden. Insbesondere sollen
vorhandene Erkenntnisse nutzbar gemacht und das Wissen über den
Gebäudetyp E noch weiter verbreitet werden. Beispielsweise sollen
Ergebnisse bisheriger Pilotprojekte ausgewertet und der
Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht, und es soll eine
Best-Practice-Sammlung, einschließlich Verträgen, erarbeitet werden.
In einem nächsten Schritt soll ein Austausch über die Eckpunkte
mit Ländern, Fachkreisen und Verbänden stattfinden. Auf der
Grundlage dieser Gespräche sollen anschließend praxistaugliche
gesetzliche Regelungen zum Gebäudetyp-E-Vertrag erarbeitet werden.
Aufbau für den schauinsland-reisen Lichtermarkt
hat begonnen
Im Landschaftspark Duisburg-Nord wird es
wieder festlich: Der Aufbau für den schauinsland-reisen Lichtermarkt
hat begonnen! In den kommenden Tagen verwandelt sich das historische
Industriegelände Schritt für Schritt in eine stimmungsvolle
Weihnachtskulisse. Bis zum ersten Adventswochenende vom 28. bis 30.
November 2025 entsteht ein Lichtermeer aus Kunsthandwerk, Kulinarik
und kreativen Ideen.
Zum 10. Jubiläum
zeigt sich der beliebte Markt in neuem Gewand: Neben den bekannten
weißen Pagodenzelten sorgen in diesem Jahr erstmals gemütliche
Holzhütten für ein besonders stimmungsvolles Flair – passend zum
Industrieambiente des Parks. Rund 70 Helfer*innen sind bereits im
Einsatz, um die neue Kulisse aufzubauen und alles für den
feierlichen Auftakt am Freitag, 28. November, vorzubereiten.
Auch in der Gießhalle 1 herrscht reger Betrieb: Hier entsteht
eine Urlaubswelt aus PLAYMOBIL, wie es sie noch nie gegeben hat. Das
REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND wird live vor Ort prüfen, ob
Reiseveranstalter schauinsland-reisen mit dem größten Urlaubsdiorama
der Welt tatsächlich Geschichte schreibt. Der spektakuläre
Weltrekordversuch startet um 17 Uhr – direkt nach der offiziellen
Eröffnung des Lichtermarkts.

Hüttenaufbau (C) Thomas Berns
Freitag, 28.11.2025
Öffnungszeiten: 13 Uhr bis 22 Uhr (offizielle Eröffnung um 17 Uhr)
Samstag, 29.11.2025 Öffnungszeiten: 13 Uhr bis 22 Uhr Sonntag,
30.11.2025 Öffnungszeiten: 11 Uhr bis 19 Uhr Vorverkauf
Erwachsene zahlen 6,50 €, Kinder bis 12 Jahren erhalten freien
Eintritt.
Die Tickets sind ausschließlich online unter
www.lichtermarkt.ruhr und
in der Touristinformation Duisburg,
Königstraße 86, 47051 Duisburg, erhältlich und berechtigen zum
einmaligen Besuch. Für den gesamten Veranstaltungsbereich
(Außengelände, Gebläsehalle, Gießhalle) ist ein Ticket erforderlich.
Während der Veranstaltung sind die Eintrittskarten vor Ort im
Landschaftspark am Eingang des schauinsland-reisen Lichtermarkts
erhältlich.
Immer am ersten Adventswochenende lädt der
schauinsland-reisen Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord
mit schönstem Kunsthandwerk und feinen Leckereien zum Stöbern,
Staunen und Genießen ein. Der adventliche Kunsthandwerkermarkt
präsentiert ein hochwertiges Angebot im beleuchteten Hüttenwerk und
der mit historischen Maschinen und Architekturbeleuchtung
ausgestatteten Gebläsehalle.
50 Jahre Bezirksbibliothek Homberg-Hochheide
Die Bezirksbibliothek Homberg-Hochheide besteht seit 50 Jahren an
der Ehrenstraße 20. Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten am Freitag, 21.
November, ab 19:00 Uhr, werden neben Bürgermeisterin Edeltraud
Klabuhn viele Ehrenamtliche, Kooperationspartner und langjährige
Kundinnen und Kunden erwartet.

Nach einigen Grußworten gibt es ein literarisch-musikalisches
Programm von Zepp Oberpichler.
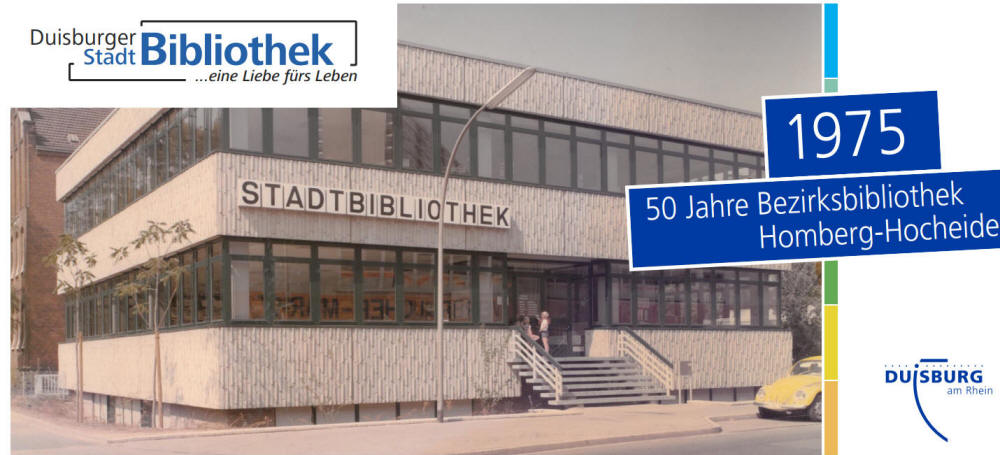
Bundesweiter Vorlesetag mit Oberbürgermeister Sören Link in
der Zentralbibliothek
Zum Bundesweiten Vorlesetag am
Freitag, 21. November, ab 15.30 Uhr findet in der Zentralbibliothek
an der Steinschen Gasse 26 in der Stadtmitte ein ganz besonderes
Vorlese-Event für Kinder ab sechs Jahren statt: Oberbürgermeister
Sören Link lässt es sich nicht nehmen auch in diesem Jahr in der
Kinder- und Jugendbibliothek vorzulesen. Die Stadtbibliothek
engagiert sich in allen Stadtteilen das gesamte Jahr über für das
Lesen und Vorlesen.
Vorlesepatinnen und Vorlesepaten
arbeiten ehrenamtlich und mit ganzem Herzen für die Leseförderung.
Darüber hinaus unterstützen auch zahlreiche Künstlerinnen und
Künstler sowie Autorinnen und Autoren dabei, die Sprach- und
Lesefähigkeiten von Kindern und Jugendlichen zu stärken.
Der
Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist online auf
www.stadtbibliothekduisburg.de unter „Veranstaltungen“ möglich.
Fragen beantwortet das Team der Bibliothek gerne persönlich oder
telefonisch unter 0203 283-4218. Die Servicezeiten sind montags von
13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie
samstags von 11 bis 16 Uhr.

Zum internationalen Vorlesetag liest Oberbürgermeister Sören Link
zwei vierten Klassen der GGS Böhmerstraße in der Stadtbibliothek
vor. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
Fußball bei Nacht
Nach mehr als vier Jahren
Pause trugen die städtischen Jugendzentren im vergangenen Jahr das
beliebte FairPlay-Fußballturnier „Fußball bei Nacht“ aus. Dieses
Jahr treten die Teams wieder gegeneinander an – und zwar in der
Nacht vom Freitag, 21., auf Samstag, 22. November.
Am Freitagabend
treffen sich die Mannschaften von acht Jugendzentren um 20 Uhr im
„Sunny“ - Regionalzentrum Süd, Mündelheimer Str. 117, 47259
Duisburg. Dort werden sie zunächst gemeinsam essen und die
speziellen Regeln des Turniers erläutert bekommen. Denn: Fairness
und Respekt spielen eine wichtige Rolle.
Um den sportlichen
Wettstreit nicht ganz aus den Augen zu verlieren, gibt es bei jedem
Spiel zusätzlich zu den Punkten für Sieg (3 Punkte) oder
Unentschieden (1 Punkt) Fairnesspunkte zu gewinnen, die gleichwertig
in die Tabelle einfließen (max. 2 Punkte pro Spiel). Ab 21 Uhr
kicken die Teams in der benachbarten Halle Süd im Ligasystem bis in
die frühen Morgenstunden.
"Applaus" für vier
Kulturstätten im Ruhrgebiet
Vier Kulturstätten im
Ruhrgebiet sind Träger des diesjährigen Applaus-Awards. Der
bundesweite Preis würdigt jährlich Konzertprogramme und
Spielstätten, die durch ihre Arbeit die kulturelle Vielfalt und
Qualität der deutschen Musikszene bereichern. Nach Dortmund geht
einer der begehrten und mit 40.000 Euro dotierten Hauptpreise: In
der Kategorie "Beste Livemusikprogramme" wird das Dortmunder domicil
gewürdigt.
Über Preisgelder in Höhe von jeweils 10.000 Euro
freuen sich der Musikclub Parzelle im Depot, ebenfalls in Dortmund,
sowie die Konzertagentur Indie Radar aus Oberhausen und das "Lokal
Harmonie" in Duisburg.
Insgesamt wurden 88 Auszeichnungen in
sechs Kategorien sowie Preisgelder in Höhe von rund 1,7 Millionen
Euro vergeben. Der Applaus-Award wird seit 2013 vom Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien verliehen und von der
Initiative Musik umgesetzt. idr - Informationen:
https://applaus-award.de
REWE testet hochautomatisierte Lebensmittellieferung
In Bochum testet REWE als nach eigenen Angaben erster
Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland die Auslieferung von Waren
mit einem selbstfahrenden Fahrzeug im Realbetrieb. Gemeinsam mit dem
Schweizer Technologieunternehmen LOXO und der Bochumer
Wirtschaftsentwicklung liefert ein speziell ausgerüsteter Van
Bestellungen aus – begleitet nur von einem Sicherheitsfahrer.
Im Pilot-Zeitraum von ca. sechs Monaten will REWE Lösungsansätze
finden, wie man einen technisch autonomen Lieferservice mit
möglichst hoher Kapazität auf die Straße bringen kann. Und wie
selbstfahrende hochautomatisierte Fahrzeuge den bestehenden
Lieferprozess ergänzen können. Beliefert werden Wohngebiete rund um
das REWE-Lager in Wattenscheid. idr
Neue Scan-Technik für
Polizeibehörden
Die Polizei Nordrhein-Westfalen stattet die
Kreispolizeibehörden Dortmund, Recklinghausen und Unna mit neuen
Fernauslesegeräten für LKW-Kontrollen aus. Die sogenannten
DSRC-Geräte (Dedicated Short Range Communication) ermöglichen es,
die Fahrtenschreiber von Lastwagen im Vorbeifahren zu scannen.
Ziel ist es, Fahrer, die manipuliert haben, schneller zu
erkennen und Verstöße effizienter aufzudecken. Die neuen Geräte
werden landesweit in insgesamt zehn Kreispolizeibehörden eingesetzt.
idr
Fit für die Zukunft mit
den IHK-Weiterbildungen - Neues Programm online
Beruflicher Neustart, gezielte Spezialisierung oder einfach Lust auf
neues Wissen: Die Kurse der IHK-Weiterbildung bieten allen
Lernbegeisterten das passende Angebot. Das neue Programm für das
erste Halbjahr 2026 ist ab sofort online. Im Fokus: Zukunftsthemen
wie Künstliche Intelligenz, digitale Transformation, moderne
Unternehmensführung und New Work.
In innovativen Formaten
werden die praxisnahen Inhalte vermittelt. Es gibt Online-Trainings
und hybride Lernmodelle, aber weiterhin auch Präsenzseminare. Das
Angebot richten sich an Fach- und Führungskräfte ebenso wie an
Berufs- und Quereinsteiger. Alle Details zum
Weiterbildungsprogramm und zu möglichen Fördermöglichkeiten finden
Sie unter:
https://www.ihk.de/niederrhein/weiterbildung.
Kinder in Not: Wichtelaktion bringt Weihnachtsfreude nach Neumühl
Das Projekt LebensWert in Duisburg startet in diesem
Jahr erneut die Weihnachtsaktion "Kinder in Not Wichtelaktion" und
setzt damit ein Zeichen der Nächstenliebe für Kinder aus belasteten
Lebenssituationen. Gemeinsam mit Pater Tobias, dem Marathon Pater,
möchte die Initiative mehr als hundert Mädchen und Jungen zwischen
vier und zwölf Jahren mit einem persönlichen Weihnachtsgeschenk
beschenken und ihnen damit ein Stück Freude und Hoffnung schenken.
Alle Mitwirkenden sind eingeladen, ein liebevoll verpacktes
Geschenk im Wert von etwa 15 Euro zu spenden. Bitte neuwertig, keine
gebrauchten Sachen. Wichtig ist ein Hinweis darauf, ob das Präsent
für ein Mädchen oder einen Jungen gedacht ist und welches Alter
berücksichtigt werden soll. Die Päckchen können bis zum 9.12.2025 im
Spenden Cafe Offener Treff an der Holtener Strasse 176 in Duisburg
Neumühl, Montag - Freitag 9 - 15 Uhr, abgegeben werden.
Neben
Sachspenden sind auch finanzielle Beiträge willkommen. Sie sichern
die Aktion dauerhaft ab und kommen vollständig den beteiligten
Kindern zugute. Spenden können unter dem Stichwort "Geschenke für
Kinder" auf folgendes Konto überwiesen werden
Projekt LebensWert
- IBAN DE34360602950010766036.
Ein besonderer Moment erwartet
alle Beteiligten am 19.12.2025 um 16 Uhr. Dann findet in der Herz
Jesu Kirche in Duisburg Neumühl eine kleine, adventliche Feier
statt, in deren Rahmen Pater Tobias die Geschenke an die Kinder
überreicht. Die Atmosphäre des Advents und die gemeinsamen
Begegnungen machen diesen Nachmittag zu einem bewegenden Höhepunkt
der Aktion.
Ein herzliches Dankeschön gilt schon jetzt allen
Menschen, die mit ihrem Engagement dazu beitragen, Kindern eine
fröhliche und hoffnungsvolle Weihnachtszeit zu ermöglichen. Jede
Unterstützung zeigt, dass Mitmenschlichkeit gerade in
herausfordernden Zeiten stark macht und verbindet.
Pragmatismus statt Protest: Wie die Gen Z Mobilität neu bewertet
Es ist noch nicht lange her, da protestierten junge Menschen mit
Fridays for Future für eine ökologische Verkehrswende, sogenannte
Klimakleber blockierten Kreuzungen. Von der Gen Z zeichnet eine groß
angelegte Mobilitätsstudie nun ein ganz anderes Bild: Ihr Blick
richtet sich weg von der globalen Klimakrise hin zur persönlichen
Komfortzone. Doch die Autoren warnen vor voreiligen Schlüssen: Wer
den moralischen Zeigefinger hebt, versteht diese Generation nicht
und hat kaum Aussicht, sie zu erreichen.

Viele Wünsche, wenig Hoffnung – so blickt die Gen Z auf Mobilität.
Laut einer Studie der ADAC Stiftung ist keine Generation so
unzufrieden mit den derzeitigen Mobilitätsangeboten und schaut so
desillusioniert in die Zukunft der Mobilität wie die 16- bis
27-Jährigen. Diese Haltung mündet in ein Mobilitätsverhalten, das
sich höchst pragmatisch daran orientiert, schnell, verlässlich und
günstig von A nach B zu kommen.
Der Gen Z ist bei der Wahl
ihrer Verkehrsmittel am wichtigsten, dass sie schnell (52 Prozent),
verlässlich (48), günstig (44) und flexibel (43) sind. Die Befragten
konnten aus 15 Eigenschaften maximal fünf benennen, die für sie den
Ausschlag geben, welches Verkehrsmittel sie nutzen.
Umweltfreundlichkeit wurde nur von 12 Prozent der jungen Menschen
genannt. Dieser Anteil ist geringer als in der Gesamtbevölkerung (15
Prozent).
Welches Verkehrsmittel diese Kriterien jeweils am
ehesten erfüllt, entscheiden die 16- bis 27-Jährigen von Fall zu
Fall unterschiedlich. 59 Prozent nutzen mindestens einmal pro Woche
den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV). In der
Gesamtbevölkerung sind das nur 35 Prozent. Auch E-Scooter, Leihräder
und Car-Sharing sind bei der Gen Z überdurchschnittlich beliebt. 48
Prozent der Gen Z greifen mindestens einmal pro Woche aufs Auto
zurück (Gesamtbevölkerung 61 Prozent). Auch für Urlaubsreisen nutzt
die Gen Z (24 Prozent) das Auto seltener als die Gesamtbevölkerung
(37 Prozent). Dafür verreisen 37 Prozent der Gen Z mit dem Flugzeug,
mehr als jede andere Altersgruppe.
Dieses Nutzerverhalten
spiegelt sich in dem Wunsch, mehrere Verkehrsmittel zur Auswahl zu
haben. 61 Prozent der Gen Z ist das wichtig. Auch deshalb büßt das
Auto bei den jungen Menschen nichts von seiner Attraktivität ein –
als Teil des Mobilitätsmix ebenso wie als Verkehrsmittel, zu dem
eine besonders hohe emotionale Bindung besteht. Der Führerschein
gilt den meisten als Muss. 58 Prozent der Gen Z sind bereits im
Besitz des Führerscheins. 27 Prozent planen, ihn in Kürze zu machen.
Darin unterscheidet sich die Gen Z so gut wie gar nicht von ihren
Vorgängergenerationen.
„Alles deutet darauf hin, dass wir
eine Entideologisierung der Haltung zu Mobilität erleben – weniger
Fixierung aufs Auto, aber auch weniger Glaube, durch individuelles
Verhalten Dinge zum Guten beeinflussen zu können“, sagt Christina
Tillmann, Vorständin der ADAC Stiftung. Zwar fühlten sich laut
Studie 53 Prozent der Gen Z moralisch verpflichtet,
umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen. Im Alltag ist das
allerdings kaum handlungsleitend, wie die Kriterien zur Wahl eines
Verkehrsmittels und Reiseverhalten zeigen. Stattdessen bestimmt die
Funktionalität das Mobilitätsverhalten.
Die
Entideologisierung geht nicht einher mit einem Desinteresse an
Politik, insbesondere an Verkehrspolitik. Das Politikfeld Verkehr
und Mobilität besitzt für die Jüngeren erheblich höhere Bedeutung
als für die Gesamtbevölkerung (28 vs. 19 Prozent).
Die Studie
zeigt, dass die Gen Z von Politik und Anbietern in erster Linie eine
funktionierende Mobilität erwartet, dass bestehende Defizite behoben
und technologische Möglichkeiten schneller und nutzerfreundlicher
umgesetzt werden. Zufrieden mit den bestehenden Mobilitätsangeboten
ist in der Gen Z nur jeder Zehnte. Das sind erheblich weniger als
etwa bei den über 60-Jährigen, von denen mehr als jeder Vierte sagt,
die Mobilitätsangebote seien gut und ausreichend.
Dementsprechend offen sind die 16- bis 27-Jährigen gegenüber neuen
Mobilitätsformen: 44 Prozent befürworten den breiten Einsatz
autonomer Fahrzeuge und digital vernetzter Mobilitätsangebote im
Alltag. Für E-Mobilität sprechen sich 43 Prozent aus, für Flugtaxis
36 Prozent. 25 Prozent wünschen sich mehr Haltestellen mit
unterschiedlichen Mobilitätsangeboten, sogenannte multimodale
Verkehrsknotenpunkte. Diese Werte liegen allesamt oberhalb der
Zustimmung in der Gesamtbevölkerung. Vor allem im Vergleich zu den
Babyboomern ist die Gen Z deutlich affiner gegenüber neuen
Technologien.
Auf eine praktische Umsetzung neuer
Mobilitätsformen blickt die Gen Z allerdings skeptisch. Eine auf
Nachhaltigkeit ausgelegte Verkehrswende halten in der Gen Z 53
Prozent für wünschenswert, aber nur 43 Prozent für machbar. Eine
Fortschreibung des Status Quo mit Fokus auf private Automobilität
betrachten 52 Prozent als wahrscheinlich, obwohl sich das lediglich
34 Prozent wünschen.
„Die Ergebnisse der Studie offenbaren
ein hohes Maß an Enttäuschung und Resignation. Viel stärker als
andere Altersgruppen denkt die Gen Z offensichtlich: Wandel wäre
gut, aber er kommt ja doch nicht“, sagt Christina Tillmann. „Aus
dieser Frustration entspringt in der Gen Z kein Protest, sondern
eher Rückzug ins unmittelbare Umfeld und auf persönliche
Bedürfnisse.“
Gegenüber Appellen an die Verantwortung des
Einzelnen zeigen sich die jungen Menschen vergleichsweise
unempfänglich. Die Gen Z erwarte im Verkehrssektor vielmehr
konkrete, alltagstaugliche Lösungen. Wenn funktionale Lösungen faire
Teilhabe und Klimaschutz befördern, seien sie bei der Gen Z sehr
willkommen. „Erziehungsversuche und visionäre Überhöhungen kommen
bei der Gen Z nicht an. Aber wenn Politik verlässlich und
realitätsnah kommuniziert und Mobilität alltagstauglich gestaltet,
wird sich die Gen Z einer Mobilitätswende nicht verschließen“, so
Christina Tillmann.
Über die Studie:
Die ADAC Stiftung hat
gemeinsam mit dem SINUS-Institut und der Universität Duisburg-Essen
erforscht, wie junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren über
Mobilität denken, wie sie heute unterwegs sind und was sie sich von
der Zukunft erwarten. Der aus der repräsentativen Befragung mit
Milieuanalysen und den qualitativen Studienmodulen entstandene
Datensatz ist der bislang umfangreichste in Deutschland zum
Mobilitätsverhalten und zu den Mobilitätseinstellungen der Gen Z.
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Erhebungen sind
ausführlich dargestellt in einer Grundlagen- und einer
Vertiefungsstudie. Diese, sowie empirischen Detailauswertungen,
weiterführende Analysen und konzeptionelle Vertiefungen, stehen zum
Download bereit unter: https://stiftung.adac.de/presse
Über
die ADAC Stiftung:
Die ADAC Stiftung konzentriert sich in ihrer
Arbeit auf zwei Themen: Mobilität und Lebensrettung. Sie setzt sich
dafür ein, dass alle Menschen in Deutschland ihrem Bedürfnis nach
Mobilität sicher und nachhaltig nachkommen können. Und dass Menschen
mit akuten Verletzungen oder in lebensbedrohlichen Situationen im
ganzen Land schnelle und wirksame Hilfe erhalten.
Im
Mobilitätsbereich verbindet die ADAC Stiftung wissenschaftliche
Analysen mit praxisnahen Programmen: Sie erforscht Einstellungen und
Verhalten, entwickelt Konzepte für nachhaltige Mobilität und
vermittelt jedes Jahr ca. 600.000 Kindern und Jugendlichen
Mobilitätskompetenz. Damit ist sie eine führende Akteurin in
Deutschland, wenn es darum geht, Mobilität sicherer, zukunftsfähiger
und menschenzentriert zu gestalten.
Solarbetriebene
DHL Packstation in Duisburg-Hochemmerich eröffnet
Die
DHL hat eine neue Packstation an der Friedrich-Alfred-Str. 217 (LIDL
Markt) in Duisburg-Hochemmerich in Betrieb genommen. Die Bedienung
erfolgt einfach per App mit dem Smartphone, der Paketempfang und
-versand ist rund um die Uhr möglich. Die Kapazität des neuen,
solarbetriebenen Automaten umfasst 66 Fächer.

Kundinnen und Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre
Pakete abholen, vorfrankierte Sendungen verschicken. Die
App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm aus. Für die
Nutzung benötigen Kundinnen und Kunden lediglich die kostenlose Post
& DHL App.
Für die Be- und Entladung der Packstationen
stehen bundesweit unter anderem bereits mehr als 35.000
Elektro-Fahrzeuge zur Verfügung. Die Packstationen befinden sich in
der Regel an zentralen Orten des täglichen Lebens, wie zum Beispiel
an Supermärkten, Tankstellen oder auf Firmengeländen. Ebenso spielen
Wohnungsbaugesellschaften als Standortgeber in Wohngebieten eine
bedeutende Rolle.
Auch der Öffentliche Personennahverkehr
und bundesweite Bahnhöfe als zentrale Drehscheiben mitten in der
Stadt stehen im Vordergrund. Die App-gesteuerte Packstation benötigt
kein Display, da die Kundin oder der Kunde sie ausschließlich mit
seinem Smartphone bedient. „Wir haben die App-gesteuerten
Packstationen intensiv getestet.
Meidericher
Gemeinde lädt zur Kirchenkneipe ein
An einem der vier
Freitage jeden Monats öffnet im Gemeindezentrum der Evangelischen
Kirchengemeinde Duisburg Meiderich, Auf dem Damm 8, die
Kirchenkneipe.
So auch am 28. November 2025, wo Besucherinnen
und Besucher nach dem 19-Uhr-Wochenabschlussandacht ab 19.30 Uhr
wieder gute Getränke, leckere Kleinigkeiten und eine gemütliche
Atmosphäre erwarten können, die zum Wohlfühlen einlädt und Platz für
nette Gespräche lässt. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter 0203-4519622.

Mitglieder des Teams der Meidericher Kirchenkneipe (Foto:
www.kirche-meiderich.de).

NRW-Industrie: Metalle und KFZ-Branche mit größten
Umsatzrückgängen in den ersten neun Monaten 2025
*
Insgesamt erwirtschafteten eine Millionen Beschäftige einen
Gesamtumsatz von 259 Milliarden Euro.
* Nur Nahrungs- und
Futtermittel mit Umsatzplus.
* KFZ-Branche mit stärkstem
Beschäftigungsrückgang.
Die 4.872 nordrhein-westfälischen
Industriebetriebe mit 50 oder mehr Beschäftigten haben in den ersten
neun Monaten des Jahres 2025 einen nominalen (also nicht
preisbereinigten) Umsatz von 259 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie
das Statistische Landesamt mitteilt, waren das 2,4 % weniger als in
den ersten neun Monaten des Jahres 2024.
Dabei gingen sowohl
die Inlandsumsätze (−2,4 %) als auch die Umsätze im Auslandsgeschäft
(−2,3 %) gegenüber Januar bis September 2024 zurück. Nur
Nahrungsmittelbranche im Plus – Metallerzeugung und -bearbeitung mit
deutlichem Minus Innerhalb der umsatzstärksten Industriebranchen
konnte erneut nur die Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln
(30,8 Milliarden Euro; +5,0 %) eine nominale Umsatzsteigerung
erzielen.
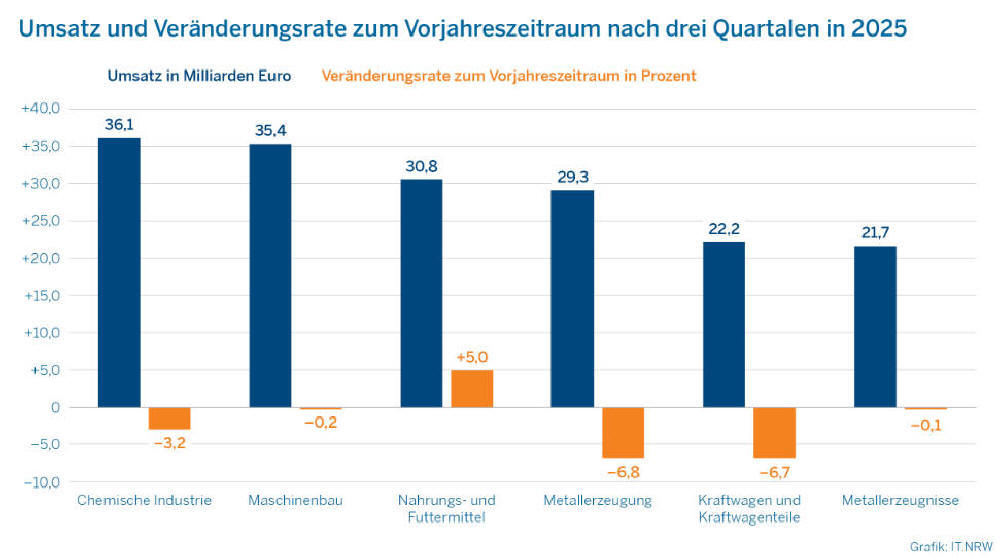
Alle weiteren Branchen verzeichneten hingegen Umsatzrückgänge:
Die Metallerzeugung und –bearbeitung musste den prozentual größten
Rückgang hinnehmen (29,3 Milliarden Euro; −6,8 %), dicht gefolgt von
der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (22,2 Milliarden
Euro; −6,7 %).
Auch die chemische Industrie (36,1 Milliarden
Euro; −3,2 %) und der Maschinenbau (35,4 Milliarden Euro; −0,2 %)
konstatierten rückläufige Umsätze. Beschäftigung um 2,0 % gesunken –
Größter Beschäftigungszuwachs in der Nahrungsmittelbranche In den
ersten neun Monaten dieses Jahres waren bei den
nordrhein-westfälischen Industriebetrieben durchschnittlich
1.038.468 Personen beschäftigt; das sind 2,0 % weniger Personen als
im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
In den meisten Branchen
waren Beschäftigungsrückgänge zu beobachten: Beschäftigungsstärkste
Branche war der Maschinenbau (176.979 Personen; 1,3 % weniger als in
den ersten neun Monaten 2024). Weitere 128.492 Personen (−1,2 %)
waren im Bereich der Herstellung von Metallerzeugnissen beschäftigt.
Die Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln vermeldete
mit 103.950 Personen (+6,7 %) den größten Beschäftigungszuwachs. Bei
der Beschäftigungsentwicklung wies die Herstellung von Kraftwagen
und Kraftwagenteilen mit 57.189 Personen (−9,4 %) erneut den größten
Rückgang auf.
NRW: Verurteilungen wegen Verstößen gegen das
Waffengesetz um rund 21 % höher als vor 10 Jahren
*
Höchststand im Jahr 2019 mit 1.470 Verurteilungen.
* Geldstrafe
ist die am häufigsten auferlegte Strafe.
* Für 44,8 % der
Verurteilten war es nicht die erste Verurteilung.
Die
Gerichte in NRW haben im Jahr 2024 insgesamt 1.202 Personen wegen
Verstößen gegen das Waffengesetz verurteilt. Wie das Statistische
Landesamt mitteilt, waren dies 20,8 % mehr Verurteilungen als im
Jahr 2014. Die Zahl der Verurteilungen erreichte im
Zehnjahreszeitraum ihren Höchststand im Jahr 2019. Damals wurden
1.470 Personen wegen dieses Straftatbestandes verurteilt.

Nach einem Rückgang der Verurteilungen in den Corona-Jahren 2020
und 2021 ist die Anzahl der Verurteilungen zuletzt wieder gestiegen.
Sie liegt jedoch unter dem Vor-Corona-Niveau. Überwiegende Mehrheit
zu Geldstrafe verurteilt Die meisten Verurteilungen wegen Verstößen
gegen das Waffengesetz erfolgten im Jahr 2024 mit 92,4 % nach
allgemeinem Strafrecht und 7,6 % nach Jugendstrafrecht.
Für
die 1.111 Verurteilungen nach allgemeinem Strafrecht liegen auch
Daten zu den verhängten Strafen vor: In 1.034 Fällen – und damit der
überwiegenden Mehrheit – wurde eine Geldstrafe auferlegt. Bei den
übrigen 77 Verurteilungen wurde eine Freiheitsstrafe ausgesprochen,
die in 63 Fällen zur Bewährung ausgesetzt wurde.
Rund 45 %
der Verurteilten wurden bereits zuvor rechtskräftig verurteilt
Von den insgesamt 1.202 Verurteilten wegen Verstößen gegen das
Waffengesetz sind 44,8 % zuvor schon mindestens einmal rechtskräftig
verurteilt worden. Diese Verurteilung kann auch wegen eines
Verstoßes gegen einen Straftatbestand eines anderen Gesetzes erfolgt
sein.
Fast drei Viertel der Verurteilten mit deutscher
Staatsangehörigkeit Von den Verurteilten im Jahr 2024 wegen
Verstößen gegen das Waffengesetz hatten 72,6 % die deutsche und
27,4 % nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Damit gab es bei
diesem Straftatbestand überdurchschnittlich viele Verurteilte mit
deutscher Staatsangehörigkeit: Über alle Straftaten hinweg lag der
Anteil der Verurteilten mit deutscher Staatsangehörigkeit bei
60,6 %.
Insgesamt gab es im Jahr 2024 in NRW 130.470
Verurteilungen, die in der Strafverfolgungsstatistik erfasst wurden.
Der Anteil der Verurteilungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz
lag damit bei 0,9 %.