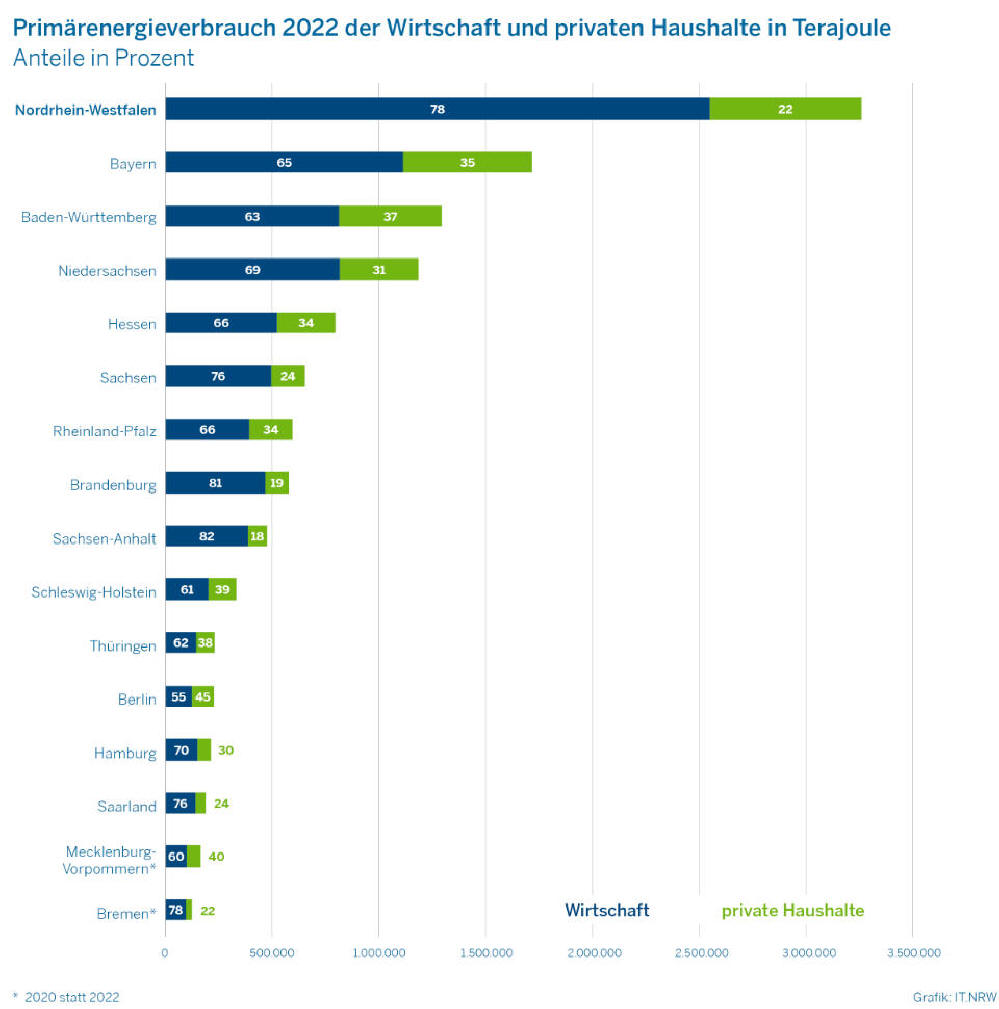|
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 47. Kalenderwoche:
19. November
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 20. November 2025
Duisburg leuchtet orange – Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen
In diesem Jahr beteiligt sich Duisburg wieder an der
weltweit stattfindenden Aktion „Orange your City“ der Vereinten
Nationen, um auf den seit 1991 stattfindenden „Internationalen Tag
zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ aufmerksam zu machen.
Am Dienstag, 25. November, werden hierzu zahlreiche Gebäude im
Stadtgebiet orange leuchten. So etwa der imposante Stadtwerketurm,
die Türme der Schwanentorbrücke und das denkmalgeschützte alte
Hallenbad in Hamborn, in dem das jobcenter seinen Sitz hat. Ebenso
der Eingangsbereich der Schauinsland-Reisen-Arena und die
Mercatorhalle.

Wie im letzten Jahr ist auch der Stadtwerketurm dabei und wird in
seiner.ganzen Länge orange erleuchten. Fotos Ilja Höpping / Stadt
Duisburg
MercatorOne und die Weihnachtsbeleuchtung von
Duisburg Kontor am Hauptbahnhof und dem Eingang zum Weihnachtsmarkt
an der Königsstraße sowie das Riesenrad der Familie Gormanns am Ende
der Kuhstraße beteiligen sich ebenfalls an der Aktion.

In Orange erstrahlen werden erstmals auch die Eingangsbereiche des
Landessportbundes NRW an der Friedrich-Alfred-Allee und des
Stadtsportbundes an der Bertaallee im Sportpark Duisburg.

Zudem werden an verschiedenen Örtlichkeiten wieder orangefarbene
Fahnen mit der Aussage „Wir sagen NEIN! zu Gewalt gegen Frauen!“
wehen, um ebenfalls ein Zeichen zu setzen. So vor dem Rathaus am
Burgplatz und dem Theater, aber auch vor dem Polizeipräsidium und
dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW am Innenhafen.
Die Evangelischen Dienste Duisburg gGmbH, die unter anderem
mit ihren Frauenhäusern Zuflucht und Schutz bieten, bekennen
ebenfalls Farbe und beteiligen sich an der Aktion. Im
Eingangsbereich des „FORUM Duisburg“ auf der Königstraße wird
außerdem am Samstag, 22. November, von 13 bis 18 Uhr der Runde Tisch
„Gewaltschutz für Duisburg“ auf den besonderen Tag aufmerksam machen
und über Hilfsangebote informieren.
Weitere Informationen
und Aktionen rund um das Thema „Gewaltschutz für Duisburg“ finden
sich auf der städtischen Internetseite unter
https://www.duisburg.de/gewaltschutz
Personalversammlung der Stadtverwaltung Duisburg: Einschränkungen im
Publikumsverkehr am 3. Dezember
Zahlreiche
Beschäftigte der Stadtverwaltung werden am Mittwoch, 3. Dezember, ab
8.30 Uhr in der Mercatorhalle zur diesjährigen Personalversammlung
des Personalrats „Innere Verwaltung“ erwartet. Aus diesem Grund muss
in allen städtischen Dienststellen mit Beeinträchtigungen des
Publikumsverkehrs von 8 bis 15 Uhr gerechnet werden. Auch Call
Duisburg wird ganztägig nur eingeschränkt erreichbar sein.
Davon ausgenommen ist die Tätigkeit der Feuerwehr und der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg. Die Bürger-Service-Stationen und das
Bezirksmanagement sind erst ab 14 Uhr geöffnet. Das
Straßenverkehrsamt bleibt ganztägig geschlossen. Auch das Bürgerund
Ordnungsamt und das Amt für Integration und Einwanderungsservice
einschließlich sämtlicher Außenstellen sind am 3. Dezember nicht
geöffnet.
Bereits vereinbarte Termine bleiben jedoch
bestehen. Beim Amt für Rechnungswesen und Steuern bleibt das
Frontoffice der Vollstreckung ganztägig geschlossen. Das
Gesundheitsamt bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch
hier bleiben bereits vereinbarte Termine bestehen. Das Amt für
Soziales und Wohnen ist an diesem Tag im Bereich Unterbringung und
Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen auf der Beekstraße
geschlossen, ebenso die Außenstellen des Amtes für Soziales und
Wohnen im Bereich der Grundsicherung.
Der Zugang zum
Stadthaus ist zu den regulären Öffnungszeiten möglich. Die
Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr bleibt durchgehend
geöffnet. Die Ausgabestelle für Parkausweise öffnet um 14 Uhr. Die
Zentralbibliothek öffnet um 10 Uhr, die Servicezeit mit Personal
beginnt um 11 Uhr. Bei den Öffnungszeiten der Zweigstellen kommt es
zu Einschränkungen.
Tagesaktuelle Informationen dazu sind
auf www.stadtbibliothek-duisburg.de zu finden. Ab 15 Uhr haben alle
Standorte wieder regulär geöffnet. Die Open Libraries in Vierlinden,
Neumühl, Beeck und Wanheimerort stehen Kundinnen und Kunden mit
einem gültigen Bibliotheksausweis ab 7 Uhr zur Verfügung. Beim
Bücherbus entfallen die Haltepunkte in Marxloh, und Röttgersbach.
Die an diesen Standorten entliehenen Medien werden entsprechend
verlängert.
Die Kurse der Volkshochschule und Musik- und
Kunstschule finden wie geplant statt. Die VHS-Geschäftsstelle Mitte
öffnet um 10 Uhr, die Geschäftsstellen Nord und West um 14 Uhr. Das
Kultur- und Stadthistorische Museum sowie das Museum der Deutschen
Binnenschifffahrt sind ebenso zu den normalen Öffnungszeiten
geöffnet (10 bis 17 Uhr) wie die Kasse des Theaters der Stadt (10
bis 18.30 Uhr).
Die städtischen Schwimmbäder (Hallenbäder
Neudorf und Toeppersee, das Rhein-Ruhr-Bad sowie das Allwetterbad
Walsum) werden am Tag der Personalversammlung durchgehend
geschlossen sein. Informationen zu den Bädern gibt es auf der
Homepage www.duisburgsport.de und unter der InfoHotline 0203
283-4444. Die Geschäftsstelle des Studieninstituts Duisburg bleibt
ganztägig geschlossen. Für städtische Beschäftigte der
Kernverwaltung Duisburg findet kein Unterricht am Studieninstitut
statt.
EU-Digital-Paket: TÜV-Verband fordert
Klarheit bei KI-Prüfstrukturen
Der TÜV-Verband begrüßt
das EU-Digitalpaket, fordert aber einen schnellen Aufbau
behördlicher Strukturen und eine zeitnahe Benennung von
Prüforganisationen zur erfolgreichen Umsetzung der KI-Verordnung in
Europa.
Vereinfachung der
Digitalgesetzgebung: Einsparungen: bis 2029: 5 Mrd Verwaltungskosten
- 150 Mrd für Unternehmen
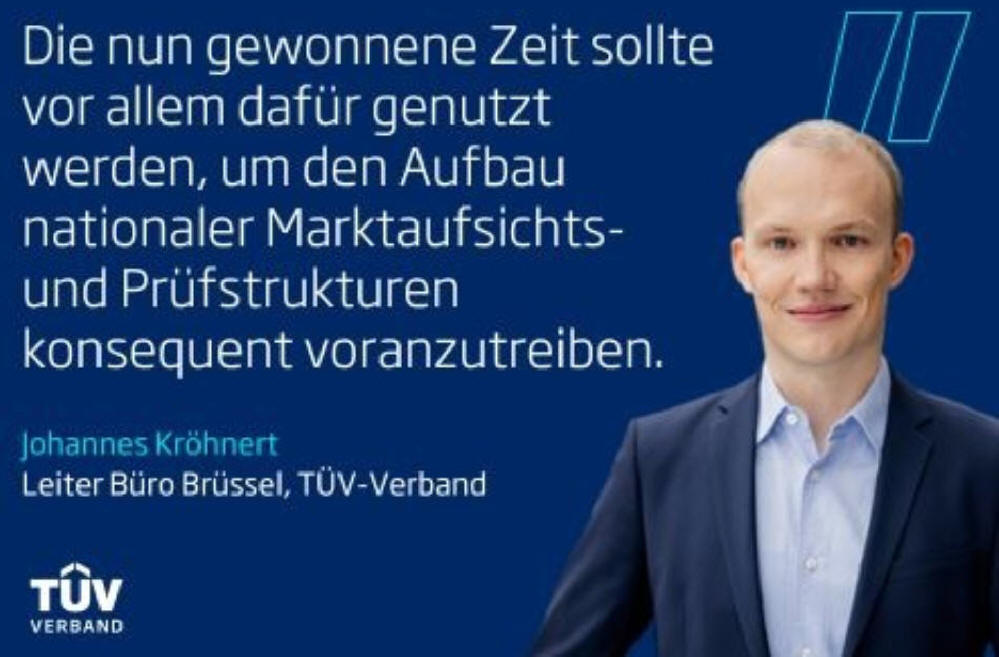 ©
TÜV-Verband
©
TÜV-Verband
Das veröffentlichte
Digital-Paket („Digital-Omnibus“) der EU-Kommission ist aus Sicht
des TÜV-Verbands ein Schritt in die richtige Richtung. Neben der
Konsolidierung des europäischen Datenrechts bringt der Vorschlag vor
allem Nachschärfungen bei der europäischen KI-Verordnung („AI Act“),
um rechtliche Unsicherheiten zu beseitigen und Vereinfachungen zu
ermöglichen.
Der TÜV-Verband begrüßt vor allem, dass die
Verfahren zur Benennung unabhängiger Prüfstellen für die Prüfung von
Hochrisiko-KI-Systemen vereinfacht werden sollen. Noch ist
allerdings weiterhin unklar, wie genau die behördliche Benennung
erfolgen soll. Dies gilt insbesondere für diejenigen Produkte,
welche bereits heute einer verpflichtenden Drittprüfung unterliegen
wie Medizinprodukte.
„Wir plädieren dafür, bestehende
Benennungen als Basis zu nehmen und um den KI-Aspekt zu erweitern,
im Sinne einer Scope-Erweitung der Prüfstellen“, sagt Johannes
Kröhnert, Leiter des Brüsseler Büros des TÜV-Verbands. Damit könnten
zeitaufwendige Neubenennungen vermieden sowie der schnelle Aufbau
einer robusten KI-Prüfinfrastruktur und der rechtzeitige
Markteintritt von innovativen Produkten sichergestellt werden.
Für eine zeitnahe Benennung brauche es neben klaren und
umsetzbaren Kriterien auch ausreichend Personal und Know-how in den
zuständigen nationalen Behörden. Auch hierbei sei der europäische
Gesetzgeber weiter gefordert. Moderate Verschiebung der
Anwendungsfristen erlaubt mehr Vorbereitungszeit Laut dem aktuellen
Vorschlag sollen die zentralen Hochrisiko-KI-Anforderungen mit einer
Verschiebung der Fristen von maximal zwölf bzw. sechszehn Monaten in
Kraft treten.
„Wir begrüßen es, dass sich die EU-Kommission
trotz des großen politischen Drucks nur für eine moderate
Verschiebung der Anwendungsfristen entschieden hat“, sagt Kröhnert.
„Die etwas verlängerte Übergangsfrist verschafft allen
Wirtschaftsakteuren mehr Spielraum für die Vorbereitung, ohne die
von KI-Systemen ausgehenden Risiken aus den Augen zu verlieren.“
Eine längere Verschiebung hätte Europas Anspruch untergraben,
zum weltweit führenden Standort für sichere und vertrauenswürdige KI
zu werden. Kröhnert: „Die nun gewonnene Zeit sollte vor allem dafür
genutzt werden, um den Aufbau nationaler Marktaufsichts- und
Prüfstrukturen konsequent voranzutreiben.“
Qualität sichern:
Warum es jetzt auf die Prüfstrukturen ankommt Ein zentraler Hebel
für eine wirksame Umsetzung der KI-Verordnung liegt in den
sogenannten Benennungsverfahren – also in der behördlichen
Kompetenzfeststellung unabhängiger Prüfstellen, die
Hochrisiko-KI-Systeme wie Medizinprodukte oder Maschinen vor der
Markteinführung auf Sicherheit und Rechtskonformität prüfen.
„Ohne behördlich anerkannte Prüfstellen kann der AI Act nicht
umgesetzt werden“, mahnt Kröhnert. Während sich Prüfstellen wie die
TÜV-Organisationen seit mehreren Jahren auf die Prüfungen von
KI-Systemen vorbereiten, bestehe die Gefahr, dass die notwendigen
behördlichen Strukturen nicht Schritt halten. Aus Sicht des
TÜV-Verbands ist daher jetzt Tempo gefragt.
Kröhnert: „Nur wenn
Verfahren, Zuständigkeiten und Anforderungen schnell geklärt werden,
kann sich das neue Regelwerk in der Praxis bewähren und Vertrauen in
KI-Systeme wachsen.“
„Maler und Lackierer“ als Schulprojekt
Berufsorientierung auf Augenhöhe: An der Theodor-König-Gesamtschule
lernen Schülerinnen und Schüler das Malerhandwerk kennen, indem sie
mit Auszubildenden des Malerbetriebs Dorscheid die Wände ihrer
Schule gestalten.
Ziel des Schulprojektes ist es, den jungen
Menschen wertvolle Erfahrungen in einem traditionsreichen
Handwerksberuf zu vermitteln. Bildungsdezernentin Astrid Neese,
Malermeister Werner Dorscheid und Schulleiter Harm Betzinger stellen
bei diesem Termin am Donnerstag, 20. November 2025 um 10 Uhr
gemeinsam das Projekt vor.
Universität
Duisburg-Essen wird für die Universitätsallianz Ruhr
NRW-HPC-Standort - Landeskonzept für wissenschaftliches
Hochleistungsrechnen
wird umgesetzt
Das Ministerium
für Kultur und Wissenschaft und die Digitale Hochschule NRW haben im
Rahmen des vierten HPC-Landeskonzepts die Universitätsallianz Ruhr
mit der Universität Duisburg-Essen als Konsortialführerin zum
vierten NRW-weiten Standort für Hochleistungsrechnen (High
performance Computing, HPC) benannt – nach Köln, Aachen und
Paderborn. Das Ziel ist es, moderne
High-Performance-Computing-Systeme landesweit bereitzustellen.
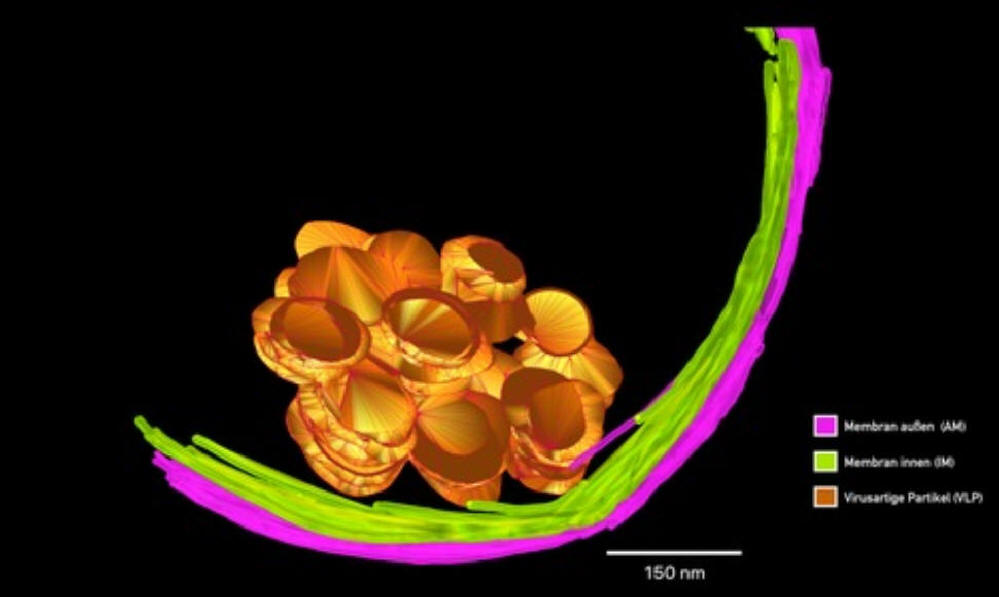
Zellezoom - Bild: Lea Griesdorn / Kristian Parey / Alexander Probst
HPC-Rechner sind erforderlich, um beispielsweise komplexe
Netzwerke von tausenden verschiedenen Viren und Mikroben in
natürlichen Ökosystemen zu entschlüsseln. Dieses Bild zeigt eine
dreidimensionale Rekonstruktion eines Mikroorganismus aus dem
Grundwasser, in dem sich Viren replizieren. Die Identifizierung der
Viren und der Mikroben erfolgte mittels HPC-gestützter Analyse des
Erbguts. Die Aufnahmen der Zelle wurden mittels
Cryo-Elektronentomographie erstellt. Bild: Lea Griesdorn / Kristian
Parey / Alexander Probst
Wissenschaftsministerin Ina Brandes:
„Rechenleistung ist der entscheidende Rohstoff im digitalen
Zeitalter. Neben unserem herausragenden Supercomputer in Jülich
treiben wir die Versorgung unserer Hochschulen mit Rechenkapazität
weiter voran. Forschung und Industrie in Nordrhein-Westfalen können
so in kürzerer Zeit mehr computergestützte Simulationen durchführen
und riesige Datenmengen auswerten. Das macht Wissenschaft präziser
und den Transfer der Erkenntnisse in die Anwendung schneller. Der
breite Zugang zu Hochleistungscomputern verschafft dem
Wissenschaftsstandort einen echten Wettbewerbsvorteil.“
Das
HPC-Landeskonzept NRW sieht vier Standorte für Hochleistungsrechnen
(HPC-Cluster) auf der Ebene 3 (Tier-3: Fachcluster) vor. In Köln
wird der Basis-Service für HPC-Leistungen bereitgestellt. In
Paderborn gibt es einen Fachcluster für Physik und Chemie. Der
Cluster der RWTH Aachen fokussiert vorrangig auf die
Ingenieurwissenschaften. Die Universität Duisburg-Essen wird
wissenschaftliches Hochleistungsrechnen insbesondere für die
Bereiche Biologie, Biochemie und Angewandte Mathematik anbieten.
An den drei Fachcluster-Standorten wird zudem maschinelles
Lernen als Basistechnologie unterstützt werden. Über ein
Verteilungssystem können sich alle Hochschulen in NRW anteilig
Rechenzeit sichern. Der neue Betriebsstandort wird sich im künftigen
Technologie-Quartier Wedau im derzeitigen Data Center des Zentrums
für Informations- und Mediendienste der Universität Duisburg-Essen
befinden.
Prof. Dr. Barbara Albert, Sprecherin der
Universitätsallianz Ruhr, Rektorin der Universität Duisburg-Essen
und Mitglied im erweiterten Vorstand der Digitalen Hochschule NRW
(DH.NRW) begrüßt die Entscheidung des Ministeriums: „Mit dem
Landeskonzept für wissenschaftliches Hochleistungsrechnen verfolgt
das Ministerium für Kultur und Wissenschaft mit der DH.NRW eine
kluge Strategie, um HPC-Ressourcen zu bündeln, zu stärken und durch
die Hochschulen betreiben zu lassen. So ist man gemeinsam
leistungsfähiger, effizienter und nachhaltiger.“
Der neue
HPC-Standort Duisburg-Essen der Universitätsallianz Ruhr überzeugt
auch durch sein innovatives Nachhaltigkeitskonzept: „Da mittlerweile
in allen Wissenschaftsbereichen der Einsatz von computergestützten
Methoden nicht mehr wegzudenken ist, gewinnt die zentrale und
gleichzeitig nachhaltige Bereitstellung von Rechenressourcen stark
an Bedeutung. Hierzu trägt die Möglichkeit, die Abwärme der
Hochleistungsrechner für die Nah- und Fernwärme-Versorgung der
Region zu nutzen, entscheidend bei.“, sagt Prof. Dr. Pedro Marron,
Prorektor für Transfer, Innovation und Digitalisierung an der
Universität Duisburg-Essen.
Für den Betrieb eines effizienten
HPC-Ökosystems ist ein breit aufgestelltes Betriebs- und
Support-Personal notwendig. Dazu arbeiten bereits jetzt 19
Mitarbeitende der zentralen IT-Betreiber ZIM, IT.Services und ITMC
aus den drei Universitäten in Duisburg-Essen, Bochum und Dortmund
eng zusammen. Sie werden künftig die Abläufe rund um das
hpcFachCluster.nrw in der Universitätsallianz Ruhr gemeinsam
umsetzen. Die Inbetriebnahme ist für voraussichtlich Anfang 2028
geplant.
Bürger- und Ordnungsamt: Christoph Sagante
ist neuer Bezirksdienstmitarbeiter für den Stadtbezirk Süd
Der Bezirksdienst beim Städtischen Außendienst des Bürger- und
Ordnungsamtes hat seinen Dienst aufgenommen. Christoph Sagante ist
als einer der Ersten ab sofort für den Stadtbezirk zuständig, der
den Duisburger Süden umfasst: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe,
weil sie mir die Möglichkeit gibt, direkt für die Bürgerinnen und
Bürgern da zu sein, ansprechbar, verlässlich und lösungsorientiert.
Mein Wunsch ist es einen positiven Beitrag für den Bezirk zu
leisten.“
Der Stadtbezirk Süd ist der größte in Duisburg.
Dort leben über 73.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf über 49
Quadratkilometern. „DuisburgSüd zeichnet sich durch eine besondere
Mischung aus städtischem Leben und naturnahen Rückzugsorten aus. Die
Nähe zum Rhein, die vielen Grünflächen und die gewachsenen
Strukturen in den Stadtteilen machen den Bezirk lebens- und
liebenswert“, so Sagante.
Insgesamt ist Duisburg für ihn
eine Stadt mit vielen Möglichkeiten und ein Ort, an dem man gerne
Zeit verbringt. Der 43-Jährige war von 2015 bis 2025 beim
Städtischen Außendienst des Bürger- und Ordnungsamtes beschäftigt,
bevor er zum Bezirksdienst wechselte. Zuvor war im kaufmännischen
Bereich in verschiedenen Unternehmen tätig. In seiner Freizeit steht
die Familie von Christoph Sagante im Mittelpunkt.
Er ist
Vater von zwei Kindern und verbringt seine freie Zeit am liebsten
mit spontanen Ausflügen innerhalb Deutschlands oder auf gemeinsamen
Urlaubsreisen. Zu seinen weiteren Hobbies zählt Musik und Lesen. Der
städtische Bezirksdienst Die neuen Bezirksdienstmitarbeitenden sind
ab sofort täglich, weitestgehend zu Fuß und uniformiert, in den
verschiedenen Stadtteilen unterwegs, um aktiv auf Bürgerinnen und
Bürger sowie Vereine und Gewerbetreibende zuzugehen.

Christoph Sagante, Bezirksdienstmitarbeiter für den Stadtbezirk Süd.
Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
Zukünftig sollen in
allen Duisburger Stadtbezirken insgesamt zwei
Bezirksdienstmitarbeitende unterwegs sein. Neben der fußläufigen
Sichtbarkeit der Bezirksdienstmitarbeitenden im jeweiligen
Stadtbezirk ist auch geplant, regelmäßig Mobile Wachen,
beispielsweise auf verschiedenen Wochenmärkten sowie Infostände auf
Stadtfesten anzubieten. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben
dort die Möglichkeit ihre Fragen und Anregungen loszuwerden.
Außerdem soll die bestehende Ordnungspartnerschaft durch gemeinsame
Streifgänge mit den Bezirksbeamten der Polizei weiter ausgebaut
werden.
Christoph Sagante kann – genau wie seine Kolleginnen
und Kollegen vom Bezirksdienst – jederzeit persönlich in den
Stadtbezirken angesprochen werden. Kontakt mit dem Bezirksdienst
kann auch per E-Mail an sad@stadtduisburg.de oder telefonisch unter
0203 283-3900 über die Führungs- und Koordinierungsstelle des
Bürger- und Ordnungsamtes aufgenommen werden. Weitere Informationen
online unter www.duisburg.de/bezirksdienst.
#GemeinsamGründen: Über 30
IHK-Veranstaltungen für angehende Gründer in NRW
Mit
der bundesweiten Aktionswoche „#GemeinsamGründen“, die vom 17. bis
21. November 2025 stattfindet, setzen die Industrie- und
Handelskammern ein Zeichen für mehr Mut zur Selbstständigkeit. Auch
Nordrhein-Westfalen beteiligt sich mit über 30 Veranstaltungen, die
Menschen mit einer Geschäftsidee oder kurz vor der Gründung
unterstützen sollen. Alle Termine aus NRW sowie die bundesweite
Übersicht der Aktionswoche sind verfügbar unter: IHK-Aktionswoche
#GemeinsamGründen am Start
Ob Fragen zur Finanzierung, zur
passenden Rechtsform, zum Businessplan, zum Marketing oder zum
Einsatz von KI – die IHKs bieten unter dem Motto #GemeinsamGründen
vielfältige Online-Seminare, Workshops und persönliche Gespräche an.

„Viele Menschen haben eine gute Idee, wissen aber nicht, wie sie
anfangen sollen“, sagt Dr. Nikolaus Paffenholz, Fachpolitischer
Sprecher für Existenzgründung & Unternehmensförderung von IHK NRW.
„Wir möchten ihnen Mut machen und zeigen, welche Schritte
wirklich wichtig sind. Und wir bieten das Wissen und die Kontakte,
die man braucht, um erfolgreich zu starten. Gründungen bringen
frische Ideen in die Region und oft entstehen daraus auch neue Jobs.
Deshalb ist die Aktionswoche ein guter Einstiegspunkt für alle, die
ihre Idee endlich umsetzen möchten.“
IMK
Konjunkturindikator: Rezessionsrisiko leicht gesunken – Aussichten
auf Erholung verdichten sich
Die Aussichten für die
deutsche Wirtschaft haben sich in den vergangenen Wochen leicht
verbessert. Das signalisiert der monatliche Konjunkturindikator des
Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der
Hans-Böckler-Stiftung. Für den Zeitraum von November bis Ende Januar
weist der Indikator, der die neuesten verfügbaren Daten zu den
wichtigsten wirtschaftlichen Kenngrößen bündelt, eine
Rezessionswahrscheinlichkeit von 30,4 Prozent aus. Anfang Oktober
betrug sie für die folgenden drei Monate noch 34,8 Prozent.
Etwas gesunken ist auch die statistische Streuung im Indikator, die
eine Verunsicherung von Wirtschaftsakteuren widerspiegelt – sie
beträgt aktuell 13,1 Prozent nach 17,7 Prozent im Vormonat.
Die Aufhellung ist zwar nicht so stark, dass der nach dem
Ampelsystem arbeitende Indikator von der aktuellen Phase „gelb-rot“
auf das günstigere „gelb-grün“ schalten würde. Der Indikator
signalisiert damit weiterhin „konjunkturelle Unsicherheit“ für die
kommenden drei Monate, aber keine akute Rezessionsgefahr.
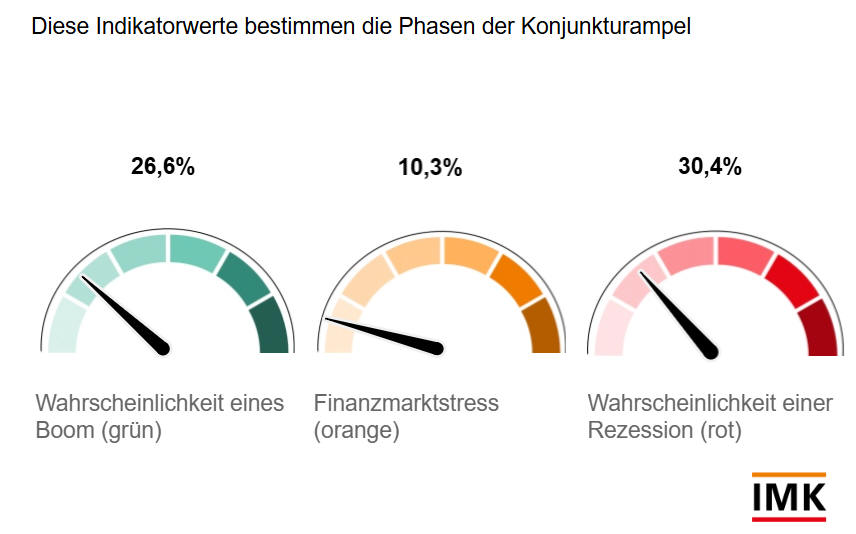
In dieser Situation seien Wirtschaftsakteur*innen wie
Wirtschaftspolitiker*innen besonders gefragt, einen kühlen Kopf zu
bewahren, betont Prof. Dr. Sebastian Dullien, der wissenschaftliche
Direktor des IMK. „Die aktuellen Daten zeigen: Die wirtschaftliche
Lage ist besser, als es in der öffentlichen Diskussion derzeit
dargestellt wird.
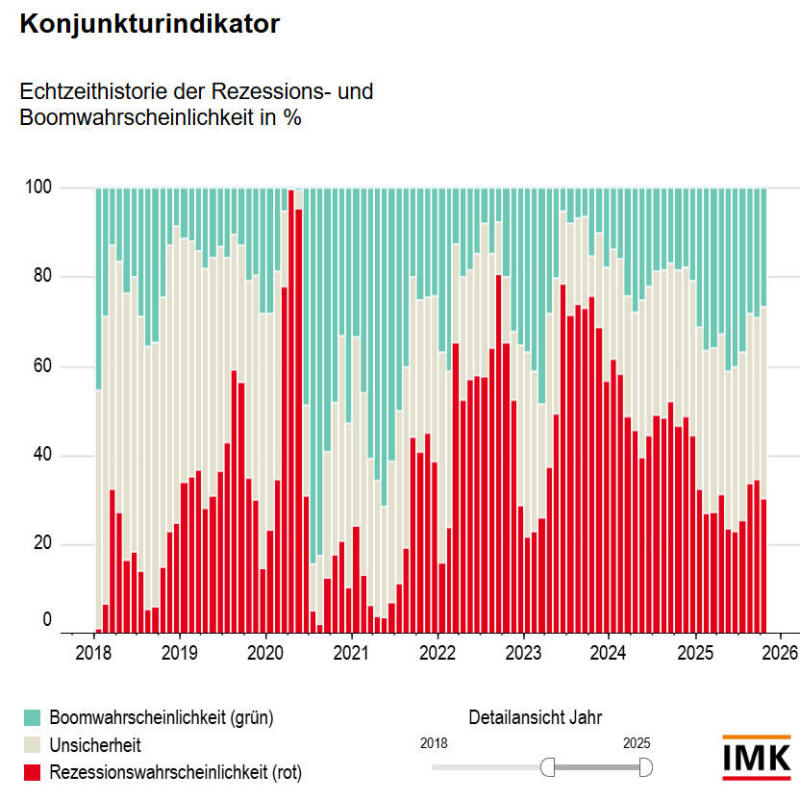
Die Zeichen stehen auf Erholung im kommenden Jahr. Jetzt ist
wichtig: Den Aufschwung nicht zerreden. Eine wichtige Säule der
Erholung in den kommenden Quartalen ist der private Konsum.
Wenn man jetzt nur über Einschnitte im Sozialsystem – von Rente bis
Krankenversicherung – redet, verunsichert man die Menschen und legt
die Axt an die wirtschaftliche Erholung in Deutschland“,
sagt Dullien. Das sei im Übrigen nicht nur gefährlich, sondern auch
unnötig. Denn die Sozialstaatsfinanzierung stelle sich weitaus
stabiler dar als manche Äußerungen Glauben machen.
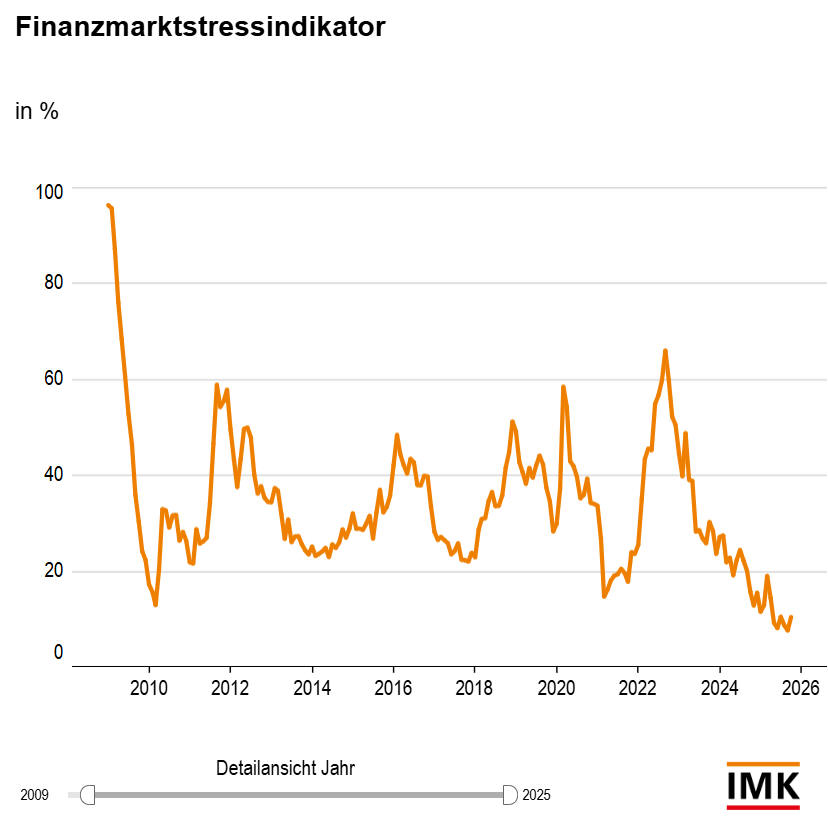
Die leichte Aufhellung bei den Aussichten für die kommenden
Monate beruht in erster Linie auf positiven Signalen von
realwirtschaftlichen Indikatoren und von Stimmungsindikatoren. So
sind die Auftragseingänge des Verarbeitenden Gewerbes aus dem Inland
seit dem zweiten Quartal 2025 in der Tendenz aufwärtsgerichtet.
Aktuell gilt dies auch für die Gesamtheit der Auftragseingänge ohne
Großaufträge, die die konjunkturelle Grunddynamik besser
widerspiegeln.
Auch die Mehrzahl der Stimmungsindikatoren
lassen laut IMK auf leicht verbesserte Konjunkturaussichten
schließen. Beispielsweise liegt der Einkaufsmanagerindex für die
Gesamtwirtschaft nun deutlich oberhalb der Expansionsschwelle.
Allerdings ist bei Indikatoren des Konsumentenvertrauens bislang
kein Aufwärtstrend zu sehen.
Dass die
Rezessionswahrscheinlichkeit nicht noch stärker zurückgegangen ist,
liegt vor allem an Finanzmarktindikatoren, etwa am leichten Rückgang
der Aktienkurse im CDAX. Auch der IMK-Finanzmarktstressindex, der
einen breiten Kranz von Kapitalmarktindikatoren zu einem einzigen
Maß bündelt, verzeichnet auf moderatem Niveau einen leichten
Anstieg.
In der Gesamtschau prognostiziert das IMK weiterhin
ein Mini-Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2 Prozent in
diesem Jahr. Für 2026 erwarten die Konjunkturforscher*innen in ihrer
aktuellen Konjunkturprognose eine spürbare Erholung und eine
BIP-Zunahme um 1,4 Prozent.
Freundeskreis IGA 2027
Ruhrgebiet gegründet
Der frühere Zehnkämpfer Frank
Busemann, NRW-Finanzminister Dr. Marcus Optendrenck und
Mondpalast-Gründer Christian Stratmann - das sind nur einige der
Unterstützer des neuen Freundeskreises der Internationalen
Gartenausstellung (IGA) 2027 Ruhrgebiet. Rund 100 Gäste nahmen an
der Gründungsveranstaltung in Dortmund teil.
Der
Freundeskreis soll Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur,
Vereinen und Gesellschaft zusammenzubringen, um die Gartenschau
ideell zu begleiten und nachhaltig zu fördern. Zum Vorsitzenden des
Freundeskreises wurde der ehemalige Vorstandsvorsitzende der
Stiftung Zollverein, Prof. Hans-Peter Noll, gewählt.
Seine
Stellvertreterin ist Eva Kähler-Theuerkauf, Präsidentin des
Zentralverbandes Gartenbau. "Der Freundeskreis ist wie der Stein,
der ins Wasser geworfen wird – von hier aus entstehen die Wellen,
die die Begeisterung für die Gartenschau weit über die Region
hinaustragen", beschreibt Hanspeter Faas, Sprecher der
Geschäftsführung der IGA 2027, die Rolle.
Die Mitglieder
können Ideen und Anliegen der IGA 2027 als Multiplikatoren in der
Region vertreten, Veranstaltungen und Aktionen organisieren oder das
Programm der IGA bereichern. Garrelt Duin, Aufsichtsratsvorsitzender
der IGA 2027 und Regionaldirektor des Regionalverbandes Ruhr (RVR),
freut sich über die breite Unterstützung: "Der große Zulauf bei der
Gründungsveranstaltung zeigt mir deutlich, wie sehr die IGA gewollt
und getragen wird." Mitglied werden können Einzelpersonen ebenso wie
Unternehmen und Vereine. idr - Infos:
https://www.iga2027.ruhr
Spieleabend in der Rheinhauser Bibliothek
Die Bezirksbibliothek Rheinhausen an der Händelstraße 6 lädt am
Freitag, 28. November, ab 19 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr zum
Spieleabend ein. Alte Hasen, Gelegenheitsspieler oder Neugierige,
die einfach mal reinschnuppern möchten, sind herzlich willkommen.
Die Bibliothek hält eine große Auswahl an Spielen bereit. Wer
möchte, kann auch seine eigenen Lieblingsspiele mitbringen.
Für eine gemütliche Atmosphäre bei Snacks und Getränken ist gesorgt.
Wer möchte, kann gerne etwas dazu beitragen. Der Eintritt ist frei,
eine Anmeldung ist nicht nötig. Für Fragen steht das Team der
Bibliothek vor Ort oder telefonisch unter 02065/905-4235 zur
Verfügung. Die Bezirksbibliothek ist dienstags bis freitags von
10.30 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis
13 Uhr geöffnet.
Weihnachtliche
Musik von Alphörnern und Posaunenchor vor der Duisserner Kirche
Die Evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg lädt Groß und
Klein wieder ein, an den Adventsamstagen ab 18 Uhr vor der
Lutherkirche in Duisburg Duissern an der Martinstraße 35 entspannte
30 Minuten besinnliche Live-Musik zu hören, zu summen oder
mitzusingen und dabei zu träumen oder einfach Mal innezuhalten.
Am 29. November verzaubert ein Alphorn-Trio mit adventlicher
Musik und wird dem Publikum den akustischen Beweis bringen, dass mit
den vermeintlich simplen Instrumenten wunderbare Melodien gespielt
werden können, die weit über die volkstümliche Musik der Berge
hinausreichen.
- Am 6. Dezember gibt zur gleichen Uhrzeit
am gleichen Ort der Neudorfer Posaunenchor Adventliches zum Hören.
- Am 13. Dezember sind Chöre zu Gast vor der Lutherkirche… und
bringen mit schönen, bekannten Liedern vorweihnachtliche Harmonie.
- Zum Abschluss gibt es am 20. Dezember - auch um 18 Uhr vor der
Kirche - das große Weihnachtsliedersingen, bei dem Kirchenmusiker
Andreas Lüken die Vielzahl der Stimmen aus Chören der Lutherkirche
und Publikum zum schönen Klang zusammenbringt.
Eingerahmt
wird das Ganze jedes Mal mit einem Glühweinausschank - auch
alkoholfrei - neben der Kirche, an dem sich das Publikum aufwärmen
kann. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist
frei. Rückfragen beantwortet Pfarrer Stefan Korn (Tel: 0203 /
330490); Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.ekadu.de.

Klang von Alphörnern vor rund 120 Menschen Adventsstimmung im Jahr
2022 brachte. (Foto: Stefan Korn).

NRW: Jedes zweite betreute Kind unter 6 Jahren ist 45
Stunden und mehr pro Woche in Tagesbetreuung
*
Betreuungsumfang in Kitas und Tagespflege in den letzten zehn Jahren
um rund eine Stunde gestiegen.
* Kinder in Tagesbetreuung hatten
2025 im Schnitt einen Betreuungsumfang von 39,7 Stunden pro Woche.
* Regionale Unterschiede bei Betreuungsumfängen.
Im Jahr
2025 hatte etwa jedes zweite in einer Tagesbetreuung untergebrachte
Kind zwischen 0 und 6 Jahren einen Betreuungsumfang von 45 Stunden
und mehr. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt mitteilt, war bei den unter 6-Jährigen am
zweithäufigsten ein Betreuungsmodell von mehr als 25 bis zu
35 Stunden vertreten; rund 42 % der Kinder belegten dieses
Betreuungsmodell.
Einen Betreuungsumfang von mehr als 35 bis
unter 45 Stunden hatten rund 3 % der betreuten unter 6-jährigen
Kinder. Der durchschnittliche Betreuungsumfang von Kindern unter
6 Jahren in Kitas und Tagespflege hat sich in den letzten 10 Jahren
um mehr als eine Stunde pro Woche erhöht. Im Jahr 2025 waren unter
6-Jährige im Schnitt 39,7 Stunden pro Woche in Kindertagesbetreuung.
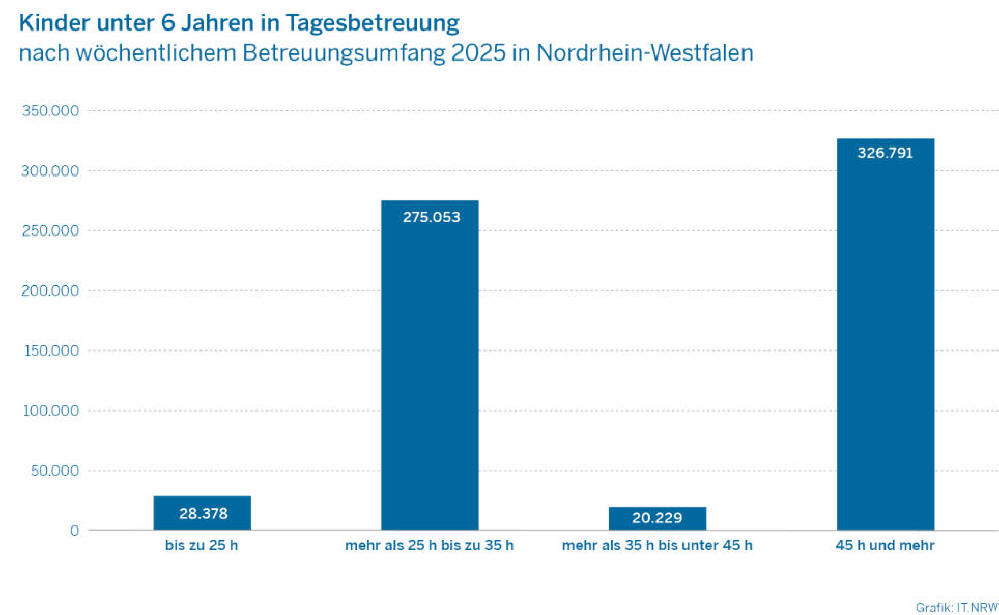
2015 hatte der durchschnittliche Betreuungsumfang in NRW bei
38,4 Stunden pro Woche gelegen. Der durchschnittliche
Betreuungsumfang pro Tag lag 2025 damit bei knapp 8 Stunden; 2015
waren es täglich 7,7 Stunden gewesen.

Regionale Unterschiede bei Betreuungsumfängen – Köln mit
höchstem und Gelsenkirchen mit niedrigstem Betreuungsumfang
Bei
den unter 6-Jährigen waren regionale Unterschiede in den
Betreuungsumfängen zu beobachten: So hatten knapp drei Viertel aller
betreuten Kinder in Köln einen Betreuungsumfang von 45 Stunden und
mehr; das war NRW-weit der höchste Anteil. Es folgten Düsseldorf mit
69,0 % und Münster mit 68,1 %.
Anteilig die wenigsten
betreuten Kinder mit Betreuungsumfängen von über 45 Stunden pro
Woche gab es in Gelsenkirchen mit 29,0 %, dem Kreis Warendorf mit
29,5 % und dem Kreis Euskirchen mit 30,5 %. Insgesamt waren zum
Stichtag 1. März 2025 rund 650.000 Kinder unter 6 Jahren in
Kindertagesbetreuung. Von ihnen besuchten rund 593.000 Kinder eine
Kindertageseinrichtung und rund 57.000 eine Tagespflege.
NRW: Primärenergieverbrauch privater
Haushalte seit 1995 um fast 22 % zurückgegangen
*
Primärenergieverbrauch der Wirtschaft im gleichen Zeitraum um fast
20 % rückläufig.
In NRW ist der Primärenergieverbrauch der privaten Haushalte von
1995 auf 2022 um 21,8 % zurückgegangen. Wie das Statistische
Landesamt mitteilt, verringerte sich im gleichen Zeitraum der
Primärenergieverbrauch der Wirtschaft um 19,9 %.
Während sich
für den betrachteten Zeitraum insgesamt ein klarer Trend zu einem
geringeren Verbrauch abzeichnet, gab es in beiden Bereichen auch
immer wieder Perioden, in denen der Primärenergieverbrauch temporär
zunahm.
Der Primärenergieverbrauch umfasst die für
Umwandlung, Transport und Endverbrauch benötigte Energie, die aus
Primärenergieträgern gewonnen wird. Zu den Primärenergieträgern
zählen beispielsweise erneuerbare Energieträger, Erdöl, Erdgas sowie
Braun- und Steinkohle.
Anteil des Primärenergieverbrauchs
der Wirtschaft bei rund 78 % im Jahr 2022
Im Jahr 2022 wurden in
Nordrhein-Westfalen insgesamt 3,3 Millionen Tonnen Terajoule
Primärenergie verbraucht. Das entspricht einem Rückgang von 3,5 %
gegenüber 2020. Anteilig wurden davon 78,2 % in der Wirtschaft und
21,8 % in den privaten Haushalten verbraucht.
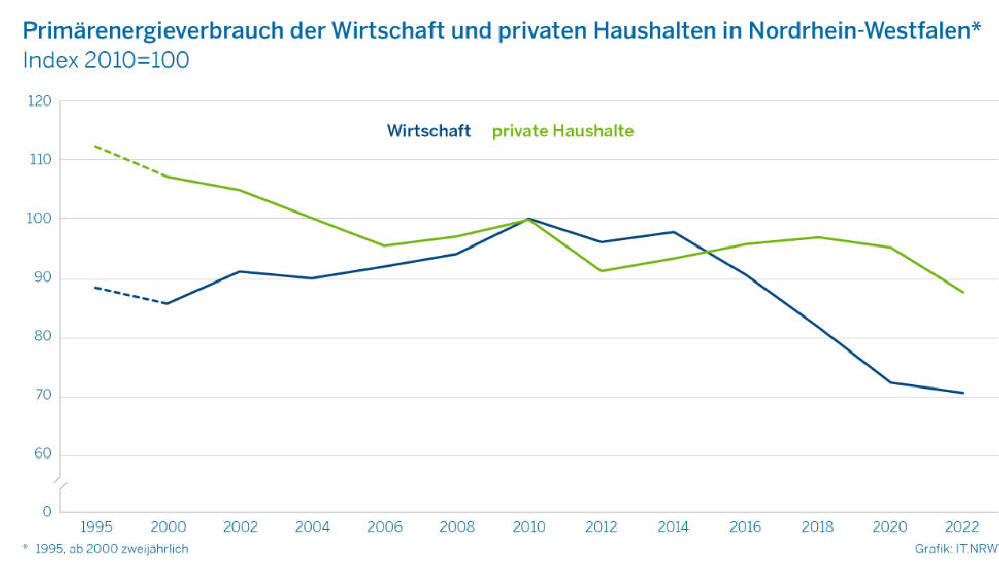
Berlin und Schleswig-Holstein mit höchstem Anteil am
Primärenergieverbrauch der privaten Haushalte – Sachsen-Anhalt und
Brandenburg mit niedrigstem Wert
Der Anteil des
Primärenergieverbrauchs der privaten Haushalte am gesamten
Primärenergieverbrauch variierte zwischen den Bundesländern: In
Berlin (45,3 %) und Schleswig-Holstein (38,6 %) war der Anteil der
privaten Haushalte am Primärenergieverbrauch vergleichsweise hoch.
In Sachsen-Anhalt (18,3 %) und Brandenburg (19,3 %) war dieser
Anteil am niedrigsten.
Die Verteilung des
Primärenergieverbrauchs auf die Wirtschaft und die privaten
Haushalte wird u. a. davon beeinflusst, wie energieintensiv die
Branchen sind, die in dem Bundesland ansässig sind. So hat z. B. das
Verarbeitende Gewerbe einen hohen Energiebedarf. Bei den privaten
Haushalten wird der Großteil der Primärenergie zum Heizen und für
die Warmwasserbereitung verwendet.