






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 5. Kalenderwoche:
25. Januar
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Montag, 27. Januar 2025 - Holocaust-Gedenktag
Internationaler
Holocaust-Gedenktag: Erklärung der Mitglieder des Europäischen Rates
Die EU-Staaten haben anlässlich des Internationalen Tages des
Gedenkens an die Opfer des Holocaust vor einer Zunahme des
Antisemitismus in Europa gewarnt. Am diesjährigen Internationalen
Holocaust-Gedenktag jährt sich die Befreiung des deutschen
nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers
Auschwitz-Birkenau zum 80. Mal.
In der Erklärung heißt
es: „Derzeit erleben wir einen beispiellosen Anstieg von
Antisemitismus auf unserem Kontinent, wie er seit dem Zweiten
Weltkrieg nicht zu beobachten war. Wir verurteilen auf das Schärfste
die besorgniserregende Zunahme gewaltsamer antisemitischer Vorfälle,
von Leugnung und Verfälschung des Holocaust sowie von
Verschwörungstheorien und Vorurteilen gegenüber Jüdinnen und Juden.“
In der Erklärung heißt es weiter: „Mehr denn je ist es
ist von entscheidender Bedeutung, dass wir unserer Verantwortung,
die Opfer des Holocaust zu ehren, gerecht werden. Wir sind
entschlossen, Antisemitismus zu bekämpfen und jüdisches Leben in
Europa zu schützen und zu fördern.
Wir verurteilen alle
Formen von Diskriminierung, Intoleranz, Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit und werden entschlossene Maßnahmen ergreifen,
um diesen Bedrohungen für demokratische Gesellschaften
entgegenzuwirken. Die Achtung der Menschenwürde, der Freiheit, der
Demokratie, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit und der
Menschenrechte, einschließlich der Meinungs-, Religions- und
Weltanschauungsfreiheit, sowie der Rechte von Personen, die
Minderheiten angehören, muss und wird – im Einklang mit den Werten,
auf die sich unsere Europäische Union gründet und die uns allen
gemeinsam sind – unser Handeln stets leiten. „Nie wieder“ gilt
jetzt.“
Niemand muss auch nur einen
Moment warten, um zu beginnen, die Welt zu verbessern
- Superintendent Dr. Urban erinnert
in Video-Botschaft zum Holocaust-Gedenktag an Anne Frank
Der 27. Januar ist Holocaust-Gedenktag und erinnert an die sechs
Millionen Kinder, Frauen und Männer, die Opfer des
Nationalsozialismus wurden. Pfarrer Dr. Christoph Urban erinnert in
seiner Stellungnahme zum Gedenktag auch an Anne Franks
Tagebuchaufzeichnungen, die das Leid, aber auch die Kraft und den
Lebenswillen der verfolgten und ermordeten Jüdinnen und Juden
sichtbar machen.
„Es ist ein wichtiges Zeugnis, damit
wir verstehen, dass es im Gedenken an den Holocaust nicht abstrakt
um Opfer und Zahlen geht, sondern konkret um Menschen“ sagt der
Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg in seinem
Videostatement. Anne Frank habe uns in ihrem Tagebuch Worte
hinterlassen, „die inspirieren – gerade auch dann, wenn sich die
Unmenschlichkeit unter uns wieder breitmacht.“
Er zitiert
Anne Frank: „Wie herrlich ist es, dass niemand auch nur einen Moment
warten muss, um zu beginnen, die Welt zu verbessern.“
Das
Video ist auch auf dem Youtubekanal „Evangelisch in Duisburg“ zu
sehen. Infos zum Kirchenkreis, den Gemeinden und Einrichtungen gibt
es im Netz unter www.kirche-duisburg.de.
Vor 80 Jahren
befreiten sowjetische Truppen das Konzentrationslager Auschwitz. Zur
gleichen Zeit – vermutlich im Februar 1945 – starb das Mädchen Anne
Frank im Lager Bergen-Belsen. Für viele war und ist ihr Tagebuch bis
heute ein berührendes Dokument. Anne Franks Aufzeichnungen machen
das Leid, aber auch die Kraft und den Lebenswillen der verfolgten
und ermordeten Jüdinnen und Juden sichtbar.
Es ist ein
wichtiges Zeugnis, damit wir verstehen, dass es im Gedenken an den
Holocaust nicht abstrakt um Opfer und Zahlen geht, sondern konkret
um Menschen. Menschen haben einander Schreckliches angetan, und sie
tun es bis heute. Anne Frank hat uns in ihrem Tagebuch Worte
hinterlassen, die inspirieren – gerade auch dann, wenn sich die
Unmenschlichkeit unter uns wieder breitmacht. Sie schreibt: „Wie
herrlich ist es, dass niemand auch nur einen Moment warten muss, um
zu beginnen, die Welt zu verbessern.“

Screenshot aus dem Videostatement zur honorarfreien Verwendung. Dort
ist auch ein Foto von Anne Frank zu sehen - (Foto mit freundlicher
Genehmigung von Anne Frank House – Amsterdam, www.annefrank.org).
Duisburger Architektur des Jugendstils und Art Déco
Das Stadtarchiv Duisburg, Karmelplatz 5 am Innenhafen,
lädt am Donnerstag, 6. Februar, um 18.15 Uhr in Kooperation mit der
MercatorGesellschaft zu einem Vortrag von Karina Sosnowski ein.
Thema des Abends in der Reihe „Stadtgeschichte donnerstags“ ist die
„Duisburger Architektur des Jugendstils und Art Déco von Hanns
Wissmann, Wilhelm Brenschede u. a.“
Um 1900 befindet
sich das Gebiet der Kunstproduktion und Architektur in einer
hochspannenden Phase. Der akademischen, traditionellen und
konservativen Formensprache stellen sich immer mehr progressive
Kräfte entgegen, die — vom Geist der Moderne getrieben — eine
erneuerte, reformierte Kunstproduktion fordern. Das Fundament für
den Jugendstil und das Art Déco bildet die englische „Arts &
Crafts-Bewegung“, die die moderne Kunstproduktion auf dem
europäischen Kontinent stark beeinflusst.
Form, Funktion
und dekorative Wirkung bilden das Primat in der Kunstvorstellung
bedeutender Kunsttheoretiker der Zeit, die selbst als Künstler tätig
waren. In dieser Zeit wird die Vorstellung von der Einheit der
Künste und damit des „Gesamtkunstwerkes“ geboren. Hermann Muthesius
ist einer der wichtigsten Botschafter der „Arts & Crafts Bewegung“
im wilhelminischen Kaiserreich und wird um 1910 in Duisburg-Duissern
stadtplanerisch tätig.
Auf der Keetmanstraße, die in das
stadtplanerische Gebiet Muthesius‘ fällt, befinden sich besonders
schöne Beispiele der Art Déco-Architektur von Wissmann und
Brenschede, die zu dieser Zeit ein gemeinsames Duisburger
Architekturbüro betreiben. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gebäude in Duissern im Stile des Art Déco (2024) - Foto Karina
Sosnowski
Treffen der NATO-Verteidigungsminister – Brüssel, 13.
Februar 2025
Die Verteidigungsminister der Alliierten
treffen sich am 13. Februar 2025 im NATO-Hauptquartier in Brüssel.
Den Vorsitz des Treffens führt der NATO-Generalsekretär.
Trauercafé am 2. Februar im Malteser Hospizzentrum
St. Raphael
Der Verlust eines geliebten Menschen
schmerzt und reißt eine große Lücke in das Leben von Verwandten und
Freunden. Die geschulten und erfahrenen Mitarbeitenden des Malteser
Hospizzentrum St. Raphael bieten unterschiedliche Beratungsangebote
für Hinterbliebene. Die Trauerberatung ist eine Hilfestellung, den
schwierigen Übergang in ein anderes „Weiter-Leben“ während der
Trauerphase zu begleiten und neue Wege zu finden.
Das
Trauercafé findet einmal im Monat im Malteser Hospizzentrum St.
Raphael, Remberger Straße 36, 47259 Duisburg, statt. Der nächste
Termin ist am 2. Februar von 15.00 bis 16.30 Uhr. Menschen, die nahe
stehende Angehörige oder Freunde verloren haben, können sich hier
für die bevorstehenden Wochen stärken und ihre Erfahrungen mit
anderen Betroffenen austauschen.
Begleitet wird das
Trauercafé von den geschulten und erfahrenen Mitarbeitenden des
Malteser Hospizzentrum St. Raphael. Eine Anmeldung für das
Trauercafé ist nicht notwendig.
Ausbau der
Stromnetze: Finanzierung durch Privatinvestoren kommt
Stromkund*innen fast doppelt so teuer wie durch den Staat
Der für die Energiewende unerlässliche massive Ausbau der deutschen
Stromnetze wird für private Stromverbraucher*innen und Unternehmen
finanziell relativ herausfordernd, aber insgesamt tragbar, wenn die
öffentliche Hand bei der Finanzierung eine zentrale Rolle einnimmt.

Trotz des hohen Investitionsbedarfs von 651 Milliarden Euro bis 2045
würden die durchschnittlichen Netzentgelte im Falle einer
öffentlichen Finanzierung nur moderat um 1,7 Cent pro Kilowattstunde
(kWh) steigen, wobei die finanzielle Gesamtbelastung durch einen
Verbrauch von 1.100 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2045 nicht zu
unterschätzen ist. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue, von der
Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie von Ökonomen der Universität
Mannheim.*
Fast doppelt so stark, um 3 Cent pro
Kilowattstunde, müssen hingegen die Netzentgelte angehoben werden,
wenn private Investoren das nötige Kapital zur Verfügung stellen.
Denn diese verlangen deutlich höhere Renditen für ihren
Kapitaleinsatz, wie langjährige Erfahrungen mit privat finanzierten
Infrastrukturprojekten zeigen.
Kurzfristig noch teurer
wäre es für Privathaushalte und gewerbliche Verbraucher, wenn die
Unternehmen, die die Übertragungs- sowie die lokalen
Verteilungsnetze betreiben, den Ausbau aus ihren laufenden Einnahmen
bezahlen müssten. Dann würden die durchschnittlichen Netzentgelte
mit Beginn des Netzausbaus um 7,5 Cent pro Kilowattstunde steigen,
haben die Studienautoren Prof. Dr. Tom Krebs und Dr. Patrick
Kaczmarczyk berechnet.

Zum Vergleich: 2021 betrugen die Netzentgelte, über die
Stromabnehmer*innen sowohl den Netzbetrieb als auch Investitionen
refinanzieren, im Mittel etwa 5,1 Cent/kWh. 2024 waren es 7,7 Cent.
„Unsere Studie legt somit nahe, dass ein nachhaltiger und
effizienter Ausbau der Stromnetze nur mit einer massiven Stärkung
der Eigenkapitalbasis der Netzbetreiber möglich ist – und dies durch
öffentliches Kapital erfolgen sollte, um die Kosten für Wirtschaft
und Gesellschaft zu minimieren und die Energiewende
sozialverträglich und wirtschaftlich tragfähig zu gestalten“, lautet
das Fazit von Krebs und Kaczmarczyk. „Trotz der hohen
Investitionssummen, die bis 2045 in den Netzausbau fließen müssen,
wäre die Energiewende damit finanzier- und realisierbar, ohne für
soziale oder wirtschaftliche Verwerfungen zu sorgen.“
Ganz
anders sähe das aus, wenn die Kapitalbeschaffung im Wesentlichen
über private Geldgeber wie Banken oder in- und ausländische
Finanzinvestoren laufen würde, wie es beispielsweise der Ökonom
Professor Lars Feld oder die Beratungsgesellschaft Deloitte in
Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW) vorgeschlagen haben.

Quelle: BNetzA. Hinweis: Alle Daten inklusive Messstellenbetrieb.
Die Daten für die Haushaltskunden sind mengengewichtete
Durchschnittswerte für 2500-5000 kWh Verbrauch. Die
Nettonetzentgelte für die Gewerbe- und Industriekunden sind
arithmetische Werte für eine
Durch die weitaus höheren
Finanzierungskosten und die entsprechend stärkere Anhebung der
Netzentgelte „bezahlen Wirtschaft und Gesellschaft jedes Jahr bis zu
14 Milliarden Euro zusätzlich für die Nutzung der Stromnetze, damit
internationale Finanzinvestoren wie BlackRock hohe Renditen
einfahren können“, warnen Krebs und Kaczmarczyk für dieses Szenario.

Die Selbstfinanzierung durch die Netzbetreiber sei wegen des
schnellen, drastischen Anstiegs der Netzentgelte erst recht „keine
ökonomisch sinnvolle Option.“ Die Studie zeigt, so Christina
Schildmann, Leiterin der Abteilung Forschungsförderung der
Hans-Böckler-Stiftung, wie wichtig die Diskussion darüber ist,
welche Rolle der Staat beim Ausbau von Infrastrukturen spielen soll,
die für die Transformation essenziell sind.

Dies verdeutlicht eine Nordwest-Südost-Achse, entlang derer die
Netzentgelte geringer ausfallen, während die mit Abstand höchsten
Netzentgelte im Nordosten der Bundesrepublik anfallen. Die
vergleichsweise höheren Nettonetzentgelte in Hessen für die
Industrie (4,78 ct/kWh) fallen bei dieser grundsätzlichen Tendenz
etwas aus dem Bild. Allerdings sind die Netzentgelte für diese
Verbrauchergruppe durch eine insgesamt geringere Varianz geprägt,
sodass das grundlegende Muster bestehen bleibt.
Die
Gründe für die hohen Netzentgelte im Osten der Republik sind
einerseits auf den hohen Zubau an Erneuerbaren und andererseits auf
die geographischen Strukturen zurückzuführen. In Nord- und
Ostdeutschland wird vor allem über die Windkraft deutlich mehr Strom
produziert als verbraucht – und die Integration und der Transport
der Erneuerbaren in den industriellen Süden erfordert teure
Netzausbau- und Netzengpassmanagementmaßnahmen.
Aufgrund
der geringeren Bevölkerungsdichte und Verbrauchsstruktur sowie den
tendenziell größeren Netzflächen werden die Netzkosten auf weniger
Verbraucher umgelegt, was die Netzentgelte in die Höhe treibt. Das
Ungleichgewicht dabei ist offenkundig: die Regionen, die für das
Gelingen der Energiewende die größten Anstrengungen unternehmen,
tragen derzeit die höchsten Kosten.
Forscher
durchleuchten drei aktuell diskutierte Szenarien
Den
Investitionsbedarf von insgesamt 651 Milliarden Euro bis 2045 haben
die Mannheimer Wirtschaftswissenschaftler kürzlich in einer
ebenfalls von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Vorläuferstudie
auf Basis der aktuellen Netzausbaupläne zum Erreichen der Klimaziele
ermittelt.
In der neuen Untersuchung kommen sie nun zu dem
Ergebnis, dass es für die Bezahlbarkeit der Energiewende einen
entscheidenden Unterschied macht, wie genau der Netzausbau
finanziert wird. Dazu haben sie drei Szenarien durchgerechnet, die
aktuell diskutiert werden:
Im ersten Finanzierungsszenario
erfolgt eine Ausweitung der Eigenkapitalbasis der Netzbetreiber mit
öffentlichem Kapital und eine zusätzliche Aufnahme von Fremdkapital,
um die notwendigen Neuinvestitionen zu finanzieren. Dafür könnte
sich der Staat etwa über die staatliche Förderbank KfW oder eine neu
gegründete Infrastrukturgesellschaft an großen Netzbetreibern
beteiligen, bis hin zu einer vollständigen Übernahme, was deren
Eigenkapital vergrößern würde.
Aktuell muss der Bund 2,5
Prozent Zinsen für dazu notwendige Kredite bezahlen. Krebs und
Kaczmarczyk kalkulieren in ihren Berechnungen mit einem öffentlichen
Fremdkapitalzins von 3 Prozent und einer moderaten öffentlichen
Eigenkapitalrendite von ebenfalls 3 Prozent, weil die öffentliche
Hand hauptsächlich gemeinwohlorientiert und nicht gewinnorientiert
agieren sollte.
Dieser finanzielle Vorteil kann an die
privaten und gewerblichen Stromkund*innen durchgereicht werden, was
den Anstieg der Netzentgelte auf die bereits genannten 1,7 Cent/kWh
begrenzen würde. Mit der Schuldenbremse ist das staatliche
Engagement in dieser Konstellation laut den Ökonomen vereinbar.
Im zweiten Szenario wird ebenfalls die Eigenkapitalbasis der
Netzbetreiber ausgeweitet und zusätzliches Fremdkapital aufgenommen,
aber das Eigenkapital wird von privaten Finanzinvestoren
bereitgestellt. Bei dieser Finanzierungsoption veranschlagen die
Ökonomen in ihrer Berechnung eine Eigenkapitalverzinsung von 9
Prozent und Fremdkapitalkosten von 4 Prozent, wodurch sich ein
gewichteter Kapitalzinssatz von 6 Prozent ergibt – in etwa ein
Prozentpunkt über dem Niveau, das die Bundesnetzagentur derzeit
veranschlagt.
Der in der Studie verwendete
Eigenkapitalzins orientiert sich an den Renditen von privaten
Investoren bei bereits realisierten Infrastrukturprojekten, die
zuletzt zwischen 8 und 10 Prozent betrugen. Private Investoren
begründen happige Aufschläge auf ihre eigenen Kreditkosten mit
Ausfallrisiken, die ihnen bei Großprojekten entstünden. Allerdings
forderten Finanz- und Energiewirtschaft gleichzeitig regelmäßig
staatliche Absicherungen, kritisieren Kaczmarczyk und Krebs. Das sei
widersprüchlich und ökonomisch nicht sinnvoll. Im konkreten Szenario
belaste eine Privatfinanzierung völlig unnötig private und
gewerbliche Stromverbraucher*innen, deren Netzentgelte um 3 Cent/kWh
steigen.
Im dritten Szenario wird kein zusätzliches
Eigenkapital und kein zusätzliches Fremdkapital aufgenommen, so dass
die notwendigen Neuinvestitionen aus eigenen Mitteln der
Netzbetreiber finanziert werden müssen (Selbstfinanzierung). Diese
Option erfordert einen sofortigen Anstieg der Netzentgelte um 7,5
Cent/kWh, denn der Aufschlag muss zeitgleich mit den
Investitionsausgaben erfolgen, während die ersten beiden
Finanzierungsoptionen eine zeitliche Entkopplung der Einnahmen aus
Netzentgelten und Ausgaben für Neuinvestitionen ermöglichen.
Zwar würde in Szenario drei der Aufschlag auf die
Netzentgelte im Laufe der Zeit deutlich zurückgehen und nach 2045
wieder auf das Ausgangsniveau fallen, während er in Szenario eins
und zwei dauerhaft nötig wäre. Allerdings „wären die drastischen,
kurzfristigen Anstiege der Netzentgelte bis 2037 für Unternehmen und
Haushalte kaum tragbar“, warnen die Ökonomen der Universität
Mannheim. „Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen wären
voraussichtlich verheerend.“
ACV Umfrage:
Über 80 Prozent würden nicht bei Cannabis-Konsumenten mitfahren
Der 63. Verkehrsgerichtstag diskutiert unter anderem
über verkehrsrechtliche Vorschriften im Zuge der Teillegalisierung
von Cannabis. Eine Civey-Umfrage im Auftrag des ACV verdeutlicht den
erheblichen Aufklärungsbedarf in Bezug auf die geltenden Regeln zum
Umgang mit Cannabis im Straßenverkehr.
Mit der
Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland gelten seit August
2024 auch neue Regelungen für den Straßenverkehr: Der Grenzwert für
den berauschenden Wirkstoff THC beträgt nun 3,5 Nanogramm pro
Milliliter Blutserum. Der 63. Verkehrsgerichtstag in Goslar (29. –
31. Januar 2025) wird sich mit den Konsequenzen dieser Neuerung und
deren Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit befassen.
Der
ACV Automobil-Club Verkehr ließ im Vorfeld eine repräsentative
Umfrage durchführen, um gezielt die Einstellungen und das Wissen der
Bevölkerung zum Thema Cannabis im Straßenverkehr zu erfassen. Das
Meinungsforschungsinstitut Civey befragte hierfür 2.500
Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 18 Jahren.
Die
Ergebnisse sind eindeutig: Über 80 Prozent der Befragten lehnen eine
Mitfahrt bei einer Person ab, die zuvor Cannabis konsumiert hat.
Auffällig ist jedoch die erhöhte Risikobereitschaft junger Menschen
(18–29 Jahre): In dieser Altersgruppe sind fast 30 Prozent bereit,
bei Personen, die Cannabis konsumiert haben, mitzufahren.
ACV
fordert verstärkte Aufklärungsarbeit
Der ACV positionierte sich
bereits bei Einführung des neuen THC-Grenzwerts eindeutig: „Wer
unter der Wirkung von Cannabis steht, fährt nicht“, erklärt
ACV-Geschäftsführer Holger Küster. Diese Botschaft muss unabhängig
vom Grenzwert ein unmissverständliches Signal bleiben – im Sinne der
Vision Zero. „Cannabis-Konsum führt nachweislich zu
Konzentrationsmängeln und verlängerten Reaktionszeiten, was die
Unfallgefahr erheblich erhöht. Verkehrsteilnehmende müssen umfassend
über diese Risiken aufgeklärt werden“, betont Küster.
Die
Umfrage zeigt, wie groß der Aufklärungsbedarf ist: Fast 70 Prozent
der Befragten beurteilen die bisherigen Informationsmaßnahmen zu den
Risiken des Cannabis-Konsums im Straßenverkehr als schlecht. Zudem
kennen 85 Prozent nicht den geltenden THC-Grenzwert für Personen
außerhalb der Führerschein-Probezeit und über 21 Jahre.
Polizei fehlen technische Möglichkeiten für Cannabis-Test
Beim
63. Verkehrsgerichtstag steht auch die Diskussion über polizeiliche
Kontrollmaßnahmen des aktuellen THC-Grenzwerts im Fokus. Derzeit
verfügt die Polizei bei Verkehrskontrollen über keine Schnelltests,
mit denen der THC-Grenzwert verlässlich gemessen werden kann. Eine
genaue Überprüfung ist nur durch eine Blutprobe möglich.
„Es
ist unverständlich, dass ein THC-Grenzwert für den Straßenverkehr
gesetzlich festgelegt wurde, ohne der Polizei geeignete Mittel zur
Überprüfung bereitzustellen“, kritisiert Küster. „Diese technischen
Möglichkeiten müssen dringend und flächendeckend verfügbar gemacht
werden, sonst leidet die Verkehrssicherheit darunter.“
ACV
unterstützt Präventionskampagne „Don’t drive high“
Um die
Bevölkerung besser über die Risiken des Fahrens unter
Cannabis-Einfluss zu informieren, unterstützt der ACV die
Präventionskampagne „Don’t drive high“ der
Verkehrssicherheitsinitiative #mehrAchtung.
Die Ergebnisse
der Umfrage
Die Ergebnisse der Umfrage zu Cannabis im
Straßenverkehr stellt der ACV hier zur Verfügung: Civey-Dashboard
Zur Umfrage:
Civey hat für den ACV Automobil-Club Verkehr
e.V. vom 14.01. bis 15.01.2025 online 2.500 Bundesbürgerinnen und
Bundesbürger ab 18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von
Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung
des statistischen Fehlers von 3,4 Prozentpunkten beim jeweiligen
Gesamtergebnis.
Winter ade: Tipps vom Gartenbauexperten für
den erfolgreichen Start ins neue Gartenjahr
Während der
letzten kalten Wochen ist ausreichend Zeit, Gartengeräte,
Pflanzgefäße, Rankgitter und Co. für die Gartensaison vorzubereiten.
Quelle: Pixabay

Quelle Pixabay
Garten- und
Naturfreunde können es kaum erwarten, in die neue Gartensaison zu
starten. Wie sie die letzten Winterwochen nutzen können, um sich,
ihre Pflanzen und den Boden vorzubereiten, erklärt Gartenbauexperte
Dr. Lutz Popp vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und
Landespflege e. V. (BLGL).
Auch wenn der Boden noch gefroren
ist und mancherorts sogar noch Schnee fällt, können Gartler:innen
bereits einiges für einen erfolgreichen Start in die neue
Gartensaison tun – sowohl im Zier- als auch im Nutzgarten.
Gut vorbereitet ist halb gepflanzt
Dr. Lutz Popp vom BLGL
empfiehlt, nach und nach das letzte Wintergemüse von den Beeten zu
ernten. Auch für eine Bodenanalyse ist zu Beginn des Frühjahrs die
letzte Gelegenheit. Hierbei kann man Bodenart, Nährstoffgehalt,
pH-Wert sowie den Kalkbedarf ermitteln. „Das Ergebnis bildet die
Grundlage für anschließende Bodenverbesserungsmaßnahmen wie das
Einbringen von Kompost oder Düngern“, erklärt der Gartenbauexperte.
Während der letzten kalten Wochen ist zudem ausreichend Zeit,
Gartengeräte, Pflanzgefäße, Rankgitter und Co. für die Saison
vorzubereiten – und beschädigte Utensilien bei Bedarf instand zu
setzen. „Wer zudem seine Anbauplanung bereits erledigt hat und schon
weiß, welche Pflanzen er anbauen möchte, kann jetzt Saatgut
bestellen und eventuell notwendige Frühbeete bauen“, rät Dr. Popp.
„Hier gilt: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Denn gerade zu Beginn
der Gartensaison können Samen beliebter Pflanzensorten auch im
Fachhandel manchmal vergriffen sein.“
Den Garten auf
Vordermann bringen
Die Vorbereitung des Gartens umfasst jedoch
nicht nur eine gewissenhafte Anbauplanung, sondern auch das Bereiten
der Beete. Hierzu gehört, Gründüngung rechtzeitig flach
einzuarbeiten oder zu kompostieren, den Boden mittels eines Sauzahns
oder einer Grabegabel aufzulockern, die Oberfläche mit einem
Kultivator zu bearbeiten und die passende Menge an Kompost
auszubringen. „Ist der Boden gut vorbereitet, genügt es, ihn kurz
vor der Aussaat noch einmal aufzulockern und einzuebnen“, weiß Dr.
Popp.
Bei bereits im Garten wachsenden Pflanzen stehen vor
dem Frühjahr noch diverse Pflegemaßnahmen an: Gartler:innen sollten
ihre Obstgehölze auf Schädlingsbefall prüfen und – im Idealfall bei
nicht unter -5 °C – zurückschneiden sowie die Stämme zum Frostschutz
kalken. Dabei auch Fruchtmumien, Rundknospen, Misteln und weitere
unerwünschte Parasiten beseitigen.
„Außerdem sollten
Gartenfreunde Unkraut und ungewollte Wurzelausläufer entfernen,
bevor sie sich immer weiter ausbreiten. Im Frühjahr lassen sie sich
noch vergleichsweise einfach herausreißen“, so der Tipp des
Gartenbauexperten.
Übrigens: Pflanzen wie Stiefmütterchen
oder Hornveilchen, die bereits früh im Jahr blühen, sollten
Hobbygärtner:innen mit Gartenvlies gegen kalte Temperaturen
schützen, solange es noch zu stärkeren Frösten kommt.
Neue
Pflanzen für den Garten
Für Gartler:innen, die von ihren Pflanzen
Steckholz schneiden oder Ableger heranziehen möchten, ist vor dem
Frühling die letzte Gelegenheit. „Viele Sträucher und Bäume lassen
sich durch Steckholz vermehren. Dazu vollausgereifte Triebe von der
Pflanze abschneiden, frostfrei lagern und im Frühjahr an einem
halbschattigen Ort in humusreichen Boden stecken, sodass die
Steckhölzer nur wenige Zentimeter aus der Erde ragen. Nach einigen
Wochen bilden die Triebe Wurzeln und können umgepflanzt werden“, so
Dr. Popp.
Für Ableger biegen Gartler:innen im Frühjahr
einen vorjährigen Trieb in seiner ganzen Länge in eine ca. zehn
Zentimeter tiefe Rinne und stecken ihn mit Drahtbügeln fest. Wenn
der Austrieb der Augen auf dem liegenden Zweig etwa eine Handbreit
über die Erdoberfläche reicht, ist die Rinne mit Boden zu füllen. Im
Laufe des Jahres bilden sich Wurzeln an der Basis dieser Neutriebe,
die die Hobbygärtner:innen dann von der Mutterpflanze abtrennen und
verpflanzen können.
Manche Gartler:innen wollen ihre Pflanzen
aber nicht nur wie gerade beschrieben vegetativ vermehren, sondern
auch generativ durch Samen, weiß Dr. Popp. Damit kann man ebenfalls
jetzt schon loslegen, da manche Kulturen ab Januar und Februar im
Haus in Aussaatschalen ausgesät und kultiviert werden,
beispielsweise Roter Sonnenhut, Artischocke, Knollensellerie,
Kopfsalat und Blockpaprika.
Frühe Möhrensorten können ab
Ende Februar sogar ohne Vorkultur im Haus direkt ins Gemüsebeet
gesät werden. „Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten, andere,
kälteempfindliche Pflanzen erst nach den Eisheiligen Mitte Mai ins
Freiland zu pflanzen“, rät der Experte.
Und auch an tierische
Gartenbewohner sollten Naturfreunde jetzt denken und Nistkästen
aufstellen. Denn sobald die Temperaturen milder werden, beginnt für
viele Gartenvögel die Brutzeit. Und welcher Naturfreund kann sich
das Frühlingserwachen des eigenen Gartens schon ohne das Gezwitscher
von Amsel, Blaumeise und Co. vorstellen?
Filip Alilovic – Gitarrenkonzert
Der
letzte Montag im Monat widmet sich im Das PLUS am Neumarkt in diesem
Jahr fast durchgehend der Gitarrenmusik mit Filip Alilovic und
gelegentlichen Gästen. Filip Alilovics Kompositionen sind
durchdrungen von gefühlvollen Klängen, wie er bei Konzerten im
letzten Jahr eindrücklich unter Beweis stellte. Dabei schwingt stets
der Hauch folkloristischer Einflüsse aus den Gefilden Südost-Europas
mit.
Seine Werke sind unter Kennern der klassischen
Gitarre bekanntes Repertoire. In den vielen Jahren seines kreativen
Schaffens wurden bis dato 200 seiner Solowerke, mehrere
kammermusikalische Werke, sowie auch symphonische Gitarrenkonzerte
veröffentlicht. Zudem hat er viele Werke anderer Komponisten für die
Sologitarre arrangiert.

Foto Dirk Leiss
Filip Alilovic - Gitarrenkonzert: Montag,
27. Januar 2025, 19 Uhr.
Das PLUS am Neumarkt, Neumarkt 19, 47119
Duisburg-Ruhrort. Eintritt frei(willig) - Hutveranstaltung
Erinnerungen an Pauline Leicher: Lesung im
Obermeidericher Gemeindezentrum
Am 27. Januar ist
Holocaust Gedenktag. An diesem Tag lesen Heiner Feldhoff und Claudia
Schwamberger in der Kirche der Evangelischen Gemeinde Duisburg
Obermeiderich, Emilstr. 27, um 18 Uhr aus Feldhoffs Buch „Pauline
Leicher oder Die Vernichtung des Lebens“. Pauline Leicher, 1904 in
Lautzert im Westerwald geboren, war geistig behindert; den Nazis
galt sie als „unwertes Leben“.
1941 wurde sie in der
Gaskammer von Hadamar ermordet. Trotz fehlender Quellen und
Dokumente – es gibt von ihr keine einzige Fotografie – hat Heiner
Feldhoff wesentliche Ereignisse aus ihrem 37jährigen Leben
zusammentragen können. Der Weg der Recherche zum Buch des in
Duisburg geborenen Autors macht deutlich, wie sehr Verdrängung und
Tabuisierung das Gedenken an die Opfer der NS-Euthanasie bis heute
erschweren.
Das Buch ist ein sehr persönlicher Appell
gegen das Vergessen, eine engagierte Erinnerung an die Verbrechen
damals in Hadamar und anderen sogenannten Tötungsanstalten. Und ein
ganz eigener Aufruf zur Wachsamkeit heute. Den musikalischen Rahmen
der Lesung gestaltet Martin Feldhoff am Flügel. Der Eintritt ist
frei. Infos zum Autor gibt es um Netz unter www.heinerfeldhoff.de,
zur Gemeinde unter
www.obermeiderich.de.
Über den Autor: Heiner
Feldhoff, geb. 1945, wuchs in Duisburg auf und ging dort aufs
Max-Planck-Gymnasium. Seit 1972 lebt er in Lautzert im Westerwald.
Bis 1996 im Schuldienst. Schreibt Lyrik und Prosa, Übersetzungen,
Biographien (Henry David Thoreau, Albert Camus, Paul Deussen). 2018
veröffentlichte er seine Jugenderinnerungen („Die Sonntage von
Duisburg-Beeck). Zuletzt erschien im Aisthesis-Verlag das „Lesebuch
Heiner Feldhoff“ (2022).
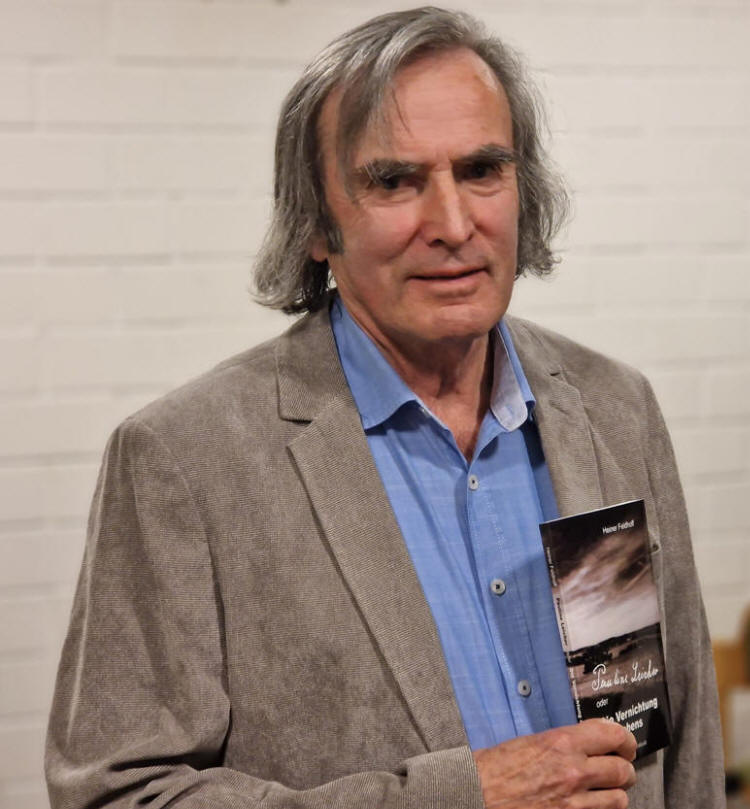
Heiner Feldhoff (Foto: Jens Schawaller).
Die
Citykirche kennenlernen - Kostenfreie Führung durch Salvator
Die Salvatorkirche am Burgplatz gehört zu Duisburgs
bekanntesten und imponierendsten Gotteshäusern. An jedem ersten
Sonntag im Monat informieren geschulte Gemeindeleute, meist
Ehrenamtliche, über die Geschichte, den Baustil und die besonderen
Fenster der über 700 Jahre alten Stadtkirche neben dem Rathaus.

Salvatorkiche - Foto Rolf Schotsch
Am Sonntag, 2. Februar 2025 um 15 Uhr macht Folker
Nießalla mit Interessierten an verschiedensten Stellen der Kirche
halt und berichtet dazu Wissenswertes und Kurzweiliges. Eine
Anmeldung ist nicht notwendig, alle Kirchenführungen in der
Salvatorkirche sind kostenfrei. Infos zum Gottesshaus gibt es unter
www.salvatorkirche.de.

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im November 2024:
+7,9 % zum Vormonat
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe,
November 2024 +7,9 % zum Vormonat (real, saison- und
kalenderbereinigt) +16,6% zum Vorjahresmonat (real,
kalenderbereinigt) +16,9 % zum Vorjahresmonat (nominal) Umsatz im
Bauhauptgewerbe, November 2024 -2,5 % zum Vorjahresmonat (real)
-0,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Der reale
(preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist nach
Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im November 2024
gegenüber Oktober 2024 kalender- und saisonbereinigt um 7,9 %
gestiegen. Dabei nahm der Auftragseingang im Hochbau um 7,8 % und im
Tiefbau um 7,9 % zu.
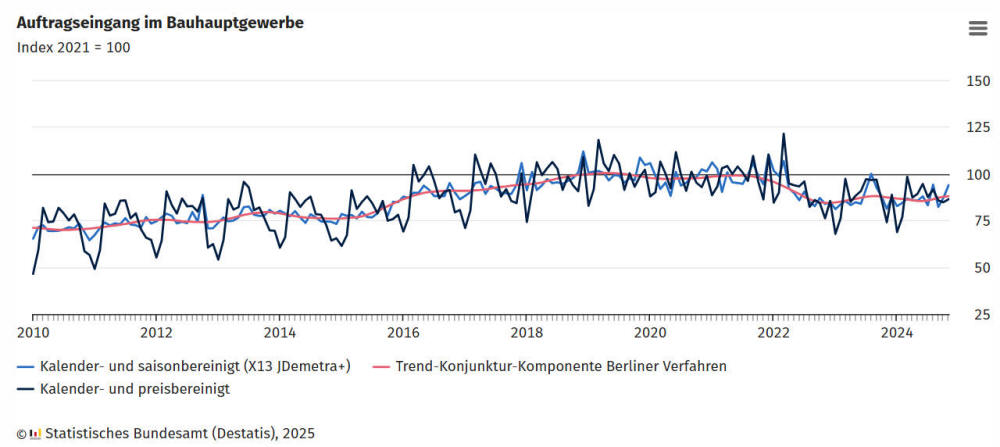
Im Vergleich zum Vorjahresmonat November 2023 stieg der reale,
kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe um 16,6 %.
Dabei nahm der Auftragseingang im Hochbau um 3,1 % und im von
Großaufträgen geprägten Tiefbau um 30,3 % zu. Der nominale (nicht
preisbereinigte) Auftragseingang lag 16,9 % über dem
Vorjahresniveau.
Bisher umsatzstärkster Monat im Jahr
2024 – aber weiterhin unter Vorjahresniveau Der reale Umsatz im
Bauhauptgewerbe nahm im November 2024 gegenüber dem Vorjahresmonat
um 2,5 % ab (nominal: -0,1 %). Im Hochbau sank der Umsatz real um
5,2 % (nominal: -3,2 %), während er im Tiefbau um 0,1 % anstieg
(nominal: +2,9 %). Mit 11,5 Milliarden Euro Umsatz war der November
allerdings der bisher umsatzstärkste Monat im Jahr 2024.
In den ersten elf Monaten 2024 sanken die Umsätze im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum real um 1,1%, nominal nahmen sie um 0,5 % zu.
Innerhalb des Bauhauptgewerbes sanken die Umsätze in diesem Zeitraum
im Hochbau real um 5,0 %, während sie im Tiefbau um 3,8 % anstiegen.
Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im November
2024 gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 % ab.
Zahl der deutschen Studierenden im Ausland 2022 um knapp
1 % gestiegen
• Insgesamt 138 800 deutsche Studierende
an Hochschulen im Ausland
• Studierendenzahlen im Ausland
verzeichnen Aufwärtstrend nach Corona- Jahr 2020
Im Jahr
2022 wurden rund 138 800 deutsche Studierende an ausländischen
Hochschulen gezählt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, waren das 1 300 oder 0,9 % Auslandsstudierende mehr als im
Vorjahr. Der Anstieg ist insbesondere auf zusätzliche rund 1 700
Studierende in Österreich, 600 in Portugal und 500 in Dänemark
zurückzuführen.
Den prozentual größten Zuwachs an
deutschen Studierenden gab es in Malta (405 %), Finnland (83 %),
Malaysia (58 %), Südafrika (54 %) sowie in Kroatien (51 %). Nach
einem pandemiebedingten Rückgang der deutschen Studierenden im
Ausland im Jahr 2020 ist seit 2021 wieder ein Aufwärtstrend
sichtbar.
Die Zahl der deutschen Studierenden im Ausland
stieg inzwischen im Vergleich zum Pandemiejahr 2020 um 4,5% und
erreicht damit ein Niveau, das sogar leicht über dem Vor-Corona-
Zeitraum von 2019 liegt. Betrachtet man die deutschen Studierenden
im Ausland weltweit, so kamen auf 1 000 deutsche Studierende im
Inland 54 im Ausland.