






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 22. Kalenderwoche:
29. Mai
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Freitag, 30. Mai 2025
Brückentag 30. Mai und
Erreichbarkeit der Stadt
A42: Seilprüfungen auf der Brücke
Beeckerwerth werden fortgesetzt
Noch bis Freitag (30.5.), 5 Uhr, laufen
die Seilprüfungen auf der Brücke Beeckerwerth. Auf der A42 zwischen
den Anschlussstellen Duisburg-Baerl und Duisburg-Beeck sind daher
die Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen verengt. Diese Prüfungen
müssen turnusgemäß alle sechs Jahre durchgeführt werden.
Zur
Nachbereitung der Prüfungen und für das Aufbringen von
Korrosionsschutz muss die Brücke dann noch einmal komplett gesperrt
werden, und zwar von Freitag (30.5.), 21 Uhr, bis Montag
(2.6.), 5 Uhr. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Dortmund
an der Anschlussstelle Duisburg-Baerl abgeleitet, in Fahrtrichtung
Kamp-Lintfort an der Anschlussstelle Duisburg-Beeck. Die Umleitungen
erfolgen weiträumig über die A40, A57 und A59.
NATO PV in Dayton: Ein starkes und vitales Verteidigungsbündnis
Die Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung der NATO trafen
sich vom 23. bis 26. Mai 2025 im amerikanischen Dayton zu ihrer
Frühjahrstagung. Für den Bundesrat nahm Minister Roman Poseck
(Hessen) teil. Die Versammlung verabschiedete zwei Erklärungen zum
anstehenden NATO-Gipfeltreffen in Den Haag und zur Unterstützung der
Ukraine.

Wolfgang Hellmich, Roman Poseck und Marja-Liisa Völlers bei der
Frühjahrstagung der Parlamentarische Versammlung der NATO in Dayton
© Innenministerium Hessen
„Die Versammlung hat deutlich
gemacht, dass die NATO auch nach mehr als 75 Jahren ein starkes und
vitales Verteidigungsbündnis ist, das für aktuelle und zukünftige
geopolitische Herausforderungen gerüstet ist“, zog Poseck Bilanz.
„Sie hat in ihren Abschlussdokumenten die Bedeutung der
transatlantischen Zusammenarbeit und der weiteren Unterstützung der
Ukraine hervorgehoben.
Die Mitglieder haben die Steigerungen
der Verteidigungsausgaben sowie die angekündigten erheblichen
Investitionen in der Zukunft ausdrücklich begrüßt. Dabei haben wir
auch die klare aktuelle Prioritätensetzung in Deutschland für ein
höheres Verteidigungsbudget hervorgehoben. Außerdem hat sich die
Versammlung zu einer starken und unabhängigen Ukraine bekannt und
die weitere Unterstützung zur Wahrung der Souveränität und
territorialen Integrität der Ukraine bekräftigt. Die Versammlung hat
eine sehr deutliche Verurteilung der russischen Aggressionen gegen
die Ukraine ausgesprochen.“
Gemeinsame Erklärung des
„Weimarer Dreiecks“
Die Delegationsleitungen der
Parlamentskammern des Weimarer Dreiecks einigten sich am Rande der
Vollversammlung auf eine gemeinsame Erklärung. In dieser bekräftigen
die französischen, polnischen und deutschen Delegationsleitungen die
klare Unterstützung für die Ukraine. Russland stelle nach wie vor
die größte und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheiten der
Bündnisstaaten dar und griffe systematisch die europäische
Sicherheitsarchitektur an.
Die Vertreter des Weimarer
Dreiecks halten eine Reihe von Maßnahmen für zwingend erforderlich,
darunter das Anheben der Sicherheits- und Verteidigungsausgaben auf
deutlich mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes und die
Bereitstellung der erforderlichen Streitkräfte, Fähigkeiten,
Ressourcen und Infrastrukturen für die derzeitigen
Verteidigungspläne des Bündnisses. Zudem solle die Zusammenarbeit in
der NATO verstärkt werden, um hybride Bedrohungen und Desinformation
zu bekämpfen und die eigene Resilienz zu stärken.
Treffen der
Delegationen
Am Rande der Frühjahrstagung sprachen die deutschen
Vertreter auch mit der Delegation der Ukraine und sagten diesen
weiterhin die starke Unterstützung durch die Bundesrepublik zu. Auch
bei Zusammentreffen mit Delegationen aus Frankreich, Großbritannien,
Polen und Kanada war dies der übereinstimmende Tenor.
Die Rolle
der Vereinigten Staaten
Von besonderem Interesse für die
transatlantischen Verbündeten war rund ein halbes Jahr nach dem
Amtsantritt von Präsident Donald Trump der Austausch mit den
Vertretern der Vereinigten Staaten. Die USA hätten sich
unmissverständlich zum Fortbestand der NATO und einem starken
amerikanischen Engagement bekannt, fasste Roman Poseck seine
Eindrücke zusammen. Gleichzeitig scheine eine wertebasierte
Außenpolitik nicht mehr leitend zu sein - im Mittelpunkt stünden
selbst definierte nationale Interessen.
Die USA erwarteten von den Europäern,
auf dem eigenen Kontinent mehr Verantwortung zu übernehmen. „Ich
hätte mir von den US-Vertretern ein klareres Bekenntnis zu den
verbindenden Werten der westlichen Welt, wie Demokratie und
Freiheit, gewünscht. Unabhängig davon trete ich aber weiter für eine
enge Kooperation mit den Vereinigten Staaten ein. Diese Form der
Zusammenarbeit liegt auch in der Zukunft in unserem eigenen
Interesse. Die Parlamentarische Versammlung hat dabei gezeigt, dass
es hierfür nach wie vor eine starke Basis gibt“, erklärte der
Delegationsleiter des Bundesrates.
Die Lehren des Daytoner
Abkommens
Die Parlamentarische Versammlung fand 30 Jahre nach der
Unterzeichnung des Daytoner Friedensabkommens für Bosnien und
Herzegowina statt. Der Rückblick auf die damalige Situation und
mögliche Ansätze für eine Befriedung der Ukraine waren Thema
mehrerer Veranstaltungen auf der Konferenz. Vertreterinnen und
Vertreter der Balkan-Staaten, darunter der kroatische
Premierminister Andrej Plenković und der albanische Präsident Bajram
Begaj, riefen dazu auf, den Frieden zu bewahren und berichteten von
entsprechenden Anstrengungen in ihren Staaten.
Zur NATO PV

Seit 1955 begleitet die Parlamentarische Versammlung der NATO die
Arbeit der NATO. Die NATO PV ist ein Gremium, in dem insgesamt 281
Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus den 32
Nato-Mitgliedsländern über sicherheits- und verteidigungspolitische
Themen beraten und beschließen. Sie tritt zweimal pro Jahr zu einer
Plenarsitzung zusammen; im Frühjahr und im Herbst. Die nächste
Versammlung wird im Oktober 2025 in Ljubljana stattfinden.
Homepage of the NATO Parliamentary Assembly (EN)
NATO Parliamentary Assembly
Was
folgt auf „Aura“? Langenscheidt sucht das Jugendwort des Jahres
Level up, die junge Generation ist wieder gefragt: Das Voting zum
Jugendwort des Jahres geht in eine neue Runde. Langenscheidt ruft ab
sofort alle zwischen 11 und 20 Jahren auf, ihre Vorschläge
einzureichen. Die Bekanntgabe des Siegerwortes erfolgt wie im
vergangenen Jahr auf der Frankfurter Buchmesse. Doch zunächst werden
die Top 10 ermittelt.
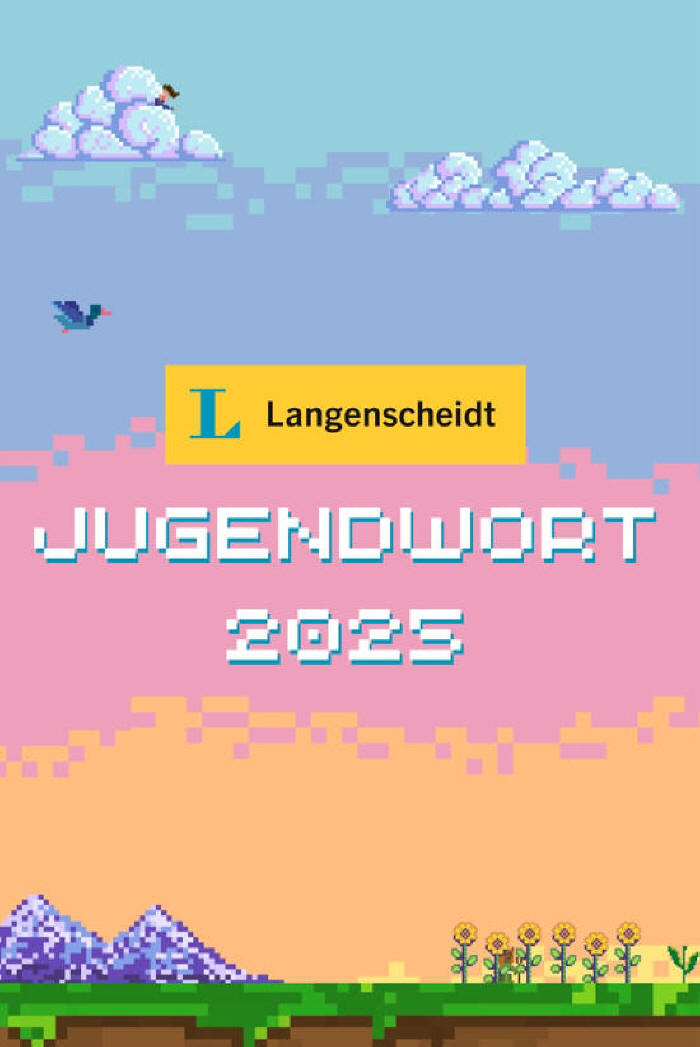
Langenscheidt, der Verlag, der die Abstimmung zum Jugendwort des
Jahres ins Leben gerufen hat, sucht Begriffe, die zum üblichen
Sprachgebrauch der Jugendlichen zwischen 11 und 20 Jahren gehören.
Die Einreichungen liegen daher komplett in deren Hand. Ein
Langenscheidt-Gremium prüft lediglich die häufige Nutzung der
Begriffe in der digitalen Welt. Offensichtliche Fakes und von
Influencern oder einzelnen Gruppen initiierte Kampagnen werden nicht
berücksichtigt. Ebenso wenig jene Begriffe mit beleidigendem,
diskriminierendem oder sexistischem Charakter.
In Memes,
Talkshows und am Küchentisch: über Jugendsprache wird gesprochen
„Wörter verbinden – oder spalten. Und jedes Jahr zeigen junge
Menschen aufs Neue, wie sehr Sprache bewegt. Ob in Memes, Talkshows
oder Insta-Reels: Jugendwörter spiegeln, was Gen Z & Gen Alpha
fühlen, denken und feiern“, erklärt Patricia Kunth, Projektleitung
Jugendwort des Jahres bei Langenscheidt. „Lassen wir uns
überraschen, über welche Begriffe in diesem Jahr in Familien und
Öffentlichkeit debattiert wird.“
Am Voting teilnehmen darf
grundsätzlich jeder, berücksichtigt werden jedoch nur Begriffe, die
von Teilnehmenden im Alter zwischen 11 und 20 Jahren eingereicht
wurden. Wo Jugendsprache drauf steht, soll schließlich auch
Jugendsprache drin sein.
Jedoch müssen die Wörter nicht
zwingend deutsch sein. Auch Begriffe aus anderen Sprachen zählen,
wenn sie genutzt werden und eine relevante Verbreitung erreichen.
Englische, türkische oder inzwischen auch arabische Ausdrücke
tauchen daher ebenfalls in den Top 10 auf. In den vergangenen Jahren
konnten im Schnitt drei Viertel der Einreichungen auch
berücksichtigt werden.
Und so läuft das Voting zum Jugendwort
2025 ab:
Phase 1: Getting started – Punkt 9 Uhr am 29. Mai 2025
geht es los. Unter jugendwort.de können die Vorschläge eingereicht
werden.
Phase 2: Battle der Top 10 – Am 29. Juli stehen die Top
10 fest und werden bekanntgegeben. Ab dann startet auch schon die
nächste Phase des Votings. Alle dürfen für ihre Favoriten aus den
Top 10 abstimmen.
Phase 3: Endspurt – Am 9. September geht die
Abstimmung dann in die letzte Runde: Die Top 3 werden vorgestellt
und bis zum 8. Oktober bleibt Zeit für die Stimmabgabe zum
Jugendwort 2025. Die Bekanntgabe des Jugendwortes 2025 erfolgt am
18. Oktober live auf der Frankfurter Buchmesse.
Amazons Alexa
mit im Boot
Pünktlich zum Start ist daher auch Amazons Alexa in
ihrer Gen-Z-Ära angekommen und flext mit Jugendwörtern. Auf die
Frage „Alexa, kannst du Jugendsprache?“ reagiert die KI mit einer
Antwort. Zum Beispiel: „Ob es eine persönliche KI mit noch mehr Swag
gibt? Nein Pascal, ich denke nicht.“ Und falls man bei Jugendwörtern
gerade komplett lost ist, erklärt Alexa auf die Bitte „Alexa, erklär
mir Jugendsprache” einen Jugendsprache-Begriff – mit konkretem
Anwendungsbeispiel und für jede Generation verständlich. Dies
funktioniert auf allen Alexa-fähigen Geräten.
Mercator-Ehrennadel und
Heimat-Preis: Fristen verlängert
Ob engagierte
Einzelpersonen, beeindruckende Initiativen oder langjährige
Herzensprojekte – es ist wieder Zeit, Danke zu sagen! Die
Kulturbetriebe der Stadt Duisburg würdigen auch in diesem Jahr
bürgerliches Engagement mit zwei bedeutenden Auszeichnungen: der
Mercator-Ehrennadel und dem Duisburger Heimat-Preis. Beide Ehrungen
stehen für gelebte Vielfalt und ehrenamtlichen Einsatz. Denn lokales
Engagement muss sichtbar werden.
Nun gibt es eine
Verlängerung der Nominierungsfrist. Alle Vorschläge können bis
einschließlich Montag, 30. Juni 2025, eingereicht werden. Eine Jury,
bestehend aus Mitgliedern des Kulturausschusses, entscheidet über
die Vergabe beider Preise. Die Verleihung findet jeweils Ende des
Jahres im Duisburger Rathaus statt.
•
Mercator-Ehrennadel: für Kultur, Bildung und Stadtgeschichte Sie
ist klein, doch ihre Bedeutung ist groß: Seit 2004 werden drei
Persönlichkeiten oder Institutionen mit der Mercator-Ehrennadel
geehrt, deren unermüdliches Wirken das kulturelle Leben der Stadt
bereichern – sei es durch Projekte, Publikationen oder besondere
Initiativen in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Bildung, Heimat-
und Brauchtumspflege oder Stadtgeschichte.
•
Duisburger Heimat-Preis 2025
„Duisburg – Heimat hat viele
Wurzeln“. So lautet das Motto des Duisburger Heimat-Preises. Es
stehen nachahmenswerte, generationsübergreifende Projekte im Fokus,
die Toleranz und ein lebendiges Miteinander stärken. Gestaltet von
Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Das
Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro kann auf bis zu drei Initiativen
aufgeteilt werden.

Foto Tanja Pickartz Stadt Duisburg
Der Duisburger Heimat-Preis ist Teil der Landesinitiative
#NRWheimatet und wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau
und Digitalisierung des Landes NRW gefördert. Kulturelle Akteurinnen
und Akteure bzw. Institutionen erhalten weitere Informationen rund
um die Bewerbung für die Mercator-Ehrennadel sowie dem Heimat-Preis
auf den Internetseiten des Kulturbüros:
https://www.duisburg.de/microsites/kulturbueroduisburg/foerderung/Mercator-Ehrennadel.php
https://www.duisburg.de/microsites/kulturbueroduisburg/foerderung/heimatpreis.php
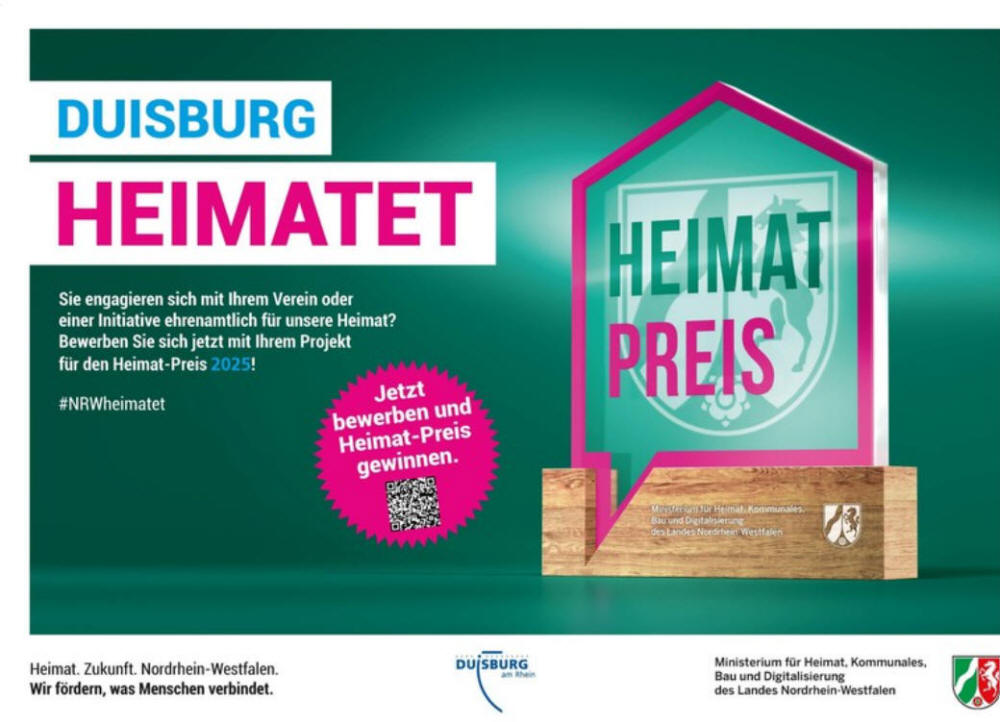
(C) Stadt Duisburg
Für
Rückfragen zur Mercator-Ehrennadel steht Gudrun Tomberg telefonisch
unter (0203) 283-62264 zur Verfügung. Bei Rückfragen zum
Heimat-Preis kann Anika Huskic telefonisch unter (0203) 283-62188
kontaktiert werden.
Verlängerung der Ausstellung
„Scheinsein – Kunst im Dialog“
Die erfolgreiche
Kunstausstellung „Scheinsein – Kunst im Dialog“ im Bezirksamt
Duisburg-Süd wird bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Die Ausstellung,
die im Rahmen der Duisburger Akzente 2025 eröffnet wurde, zeigt
Werke der Künstler Bernd Beuscher, Marion Köllner und Dieter Schwabe
und hat seit dem 17. März zahlreiche Besucherinnen und Besucher
begeistert.
„Die Ausstellung hat unser Haus mit Leben und
kreativer Energie gefüllt – sie zeigt eindrucksvoll, wie Kunst zum
Dialog einlädt und Menschen verbindet. Ich freue mich sehr, dass wir
nun noch einen Monat mehr Gelegenheit bieten können, diese
außergewöhnlichen Arbeiten zu erleben“, so Bezirksbürgermeisterin
Beate Lieske.

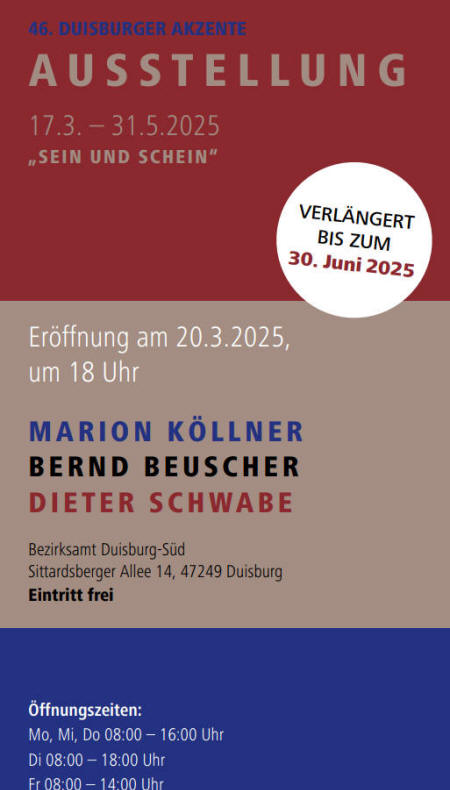
Die Ausstellung thematisiert auf vielfältige Weise Urbanität, Natur
und das Verhältnis von Mensch und Raum. Sie ist zu den regulären
Öffnungszeiten des Bezirksamts sowie in den Flächen der
Bezirksbibliothek frei zugänglich (montags, mittwochs und
donnerstags von 8 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 18 Uhr, freitags
von 8 bis 14 Uhr). Der Eintritt ist frei.
40 Jugendliche von TEN
SING-Duisburg bringen komplette Show in Meiderich auf die Bühne
Duisburg, 9. Mai 2025 - Die Vorbereitungen für die
nächste große Show von TEN SING Duisburg, bei der diesmal fast 40
Jugendliche mitmachen, laufen auf Hochtouren. Karten für die beiden
Mai-Termine sind ab jetzt erhältlich. Zu sehen ist die Premiere ist
der „Kampf der Gefühle – jetzt in 4D“ am 30. Mai 2025 um 19 Uhr im
evangelischen Gemeindezentrum Meiderich, Auf dem Damm 6.
Eine zweite Vorstellung gibt es direkt am nächsten Tag, am 31. Mai,
am gleichen Ort zur gleichen Uhrzeit, denn der Aufwand für das
Spektakel war wieder Mal groß: Die jungen Leute im Alter zwischen 13
und 24 Jahren haben sich das Show-Thema gut überlegt, geprobt, was
die Bühnenbretter, die Tanzschuhe, die Trommeln, Notenständer,
Lötkolben und was nicht alles hergeben, um wieder ein
faszinierendes, selbst erarbeitetes Programm zu präsentieren.
Dazu wurden Chorsätze einstudiert, Soli geübt, Bandarrangements
geschrieben und geprobt, Drama-Texte gelernt, Tanzchoreographien
erarbeitet, Technik überarbeitet und auf Bühnentauglichkeit
getestet, Plakate und Logos entworfen, gebastelt, gemalt,
geschreinert…
Mail: karten@tensing-duisburg.de), bei dem
auch Karten im Vorverkauf acht Euro reserviert werden können. Karten
kosten an der Abendkasse neun Euro, ermäßigt sieben Euro.
Zusatzinfos über "TEN SING": TEN SING bedeutet „Teenager singen“ und
steht für ein Konzept von kirchlicher Jugendarbeit, das im
norwegischen CVJM entwickelt wurde.

TEN SING Duisburg im Jahr 2022 (Foto: Silke Arend)
Eine TEN
SING-Gruppe arbeitet ungefähr ein Jahr auf ein Konzert hin. Dort
sind die unterschiedlichsten Elemente enthalten, für die es einzelne
Workshops gibt. Alle Workshops bilden zusammen den sogenannten
Großchor. Mitmachen können in einer TEN SING-Gruppe jede und jeder.
Die Show jedoch ist nur das Ergebnis, welches präsentiert
wird. Im Vordergrund stehen die Gemeinschaft, gemeinsame Aktionen,
der Spaß an der Sache und Jesus Christus. Deutschlandweit existieren
mittlerweile etwa 130 TEN SING-Gruppen mit insgesamt ca. 5000
begeisterten TEN SINGern.

Die diesjährige Besetzung der TEN SING Duisburg (Foto: TEN
SING Duisburg)
Mehr als die Hälfte der Politiker*innen wurde
im Rahmen ihres Engagements schon Opfer von Aggressionen
oder Gewalt
Neue Befragung des
Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen
Rund sechs von zehn Politiker*innen in Deutschland sind
im Verlaufe ihres politischen Engagements bereits
mindestens einmal Opfer von Aggressionen oder sogar von
körperlicher Gewalt geworden. Das ergibt sich aus einer
neuen, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten
Untersuchung des Kriminologischen Forschungsinstituts
Niedersachsen (KFN). Knapp die Hälfte hat nach eigenen
Angaben auch in den sechs Monaten vor der Befragung
mindestens einmal Aggressionen und/oder Gewalt erlebt.
Die Ergebnisse der zwischen Mai 2024 und Februar 2025
durchgeführten Online-Befragung geben nach Einschätzung
des KFN-Projektteams einen detaillierten Einblick in ein
Problemfeld, das von einem großen Dunkelfeld geprägt ist.
Von 1479 Politiker*innen, die in der Kommunalpolitik, auf
Landes- oder Bundesebene aktiv sind, konnten Daten zu
Aggressions- und Gewalterfahrungen und deren
individuellen und politischen Folgen ausgewertet werden.
Auch wenn die Repräsentativität der Ergebnisse
auf Grund einer niedrigen Teilnahmebereitschaft etwas
eingeschränkt ist, erlauben statistische Gewichtungen,
einige Verzerrungen der Ergebnisse zu verringern, wobei
jedoch von einer Überrepräsentation von betroffenen
Politiker*innen auszugehen ist.
Am häufigsten
erlebten Politiker*innen Beleidigungen und verbale
Diskriminierungen (gut jede*r Zweite), Verleumdungen (gut
ein Drittel) und soziale Ausgrenzungen. Etwa jede*r
Siebte war auch von Sachbeschädigungen, etwa jede*r Achte
auch von Bedrohungen betroffen, etwa jede*r Dreizehnte
auch von sexualisierten Aggressionen und sexualisierter
Gewalt. Sechs Prozent der Politiker*innen sind im
Zusammenhang mit ihrem politischen Engagement Opfer von
tätlichen Angriffen geworden. Bei etwa jeder*m achten
Politiker*in mit Aggressions- und/oder Gewalterfahrungen
in den sechs Monaten vor der Befragung war bei mindestens
einer Tat auch das private Umfeld betroffen,
beispielsweise Partner*innen oder Kinder.
Die
meisten Politiker*innen, die Zielscheibe von Aggressionen
oder Gewalt geworden sind, verarbeiteten die Erfahrung im
Austausch mit ihrem persönlichen oder engen politischen
Umfeld. Etwa ein Drittel hat über mindestens eine in den
sechs Monaten vor der Befragung erlebte Aggressions- oder
Gewalterfahrung gar nicht gesprochen. Etwa drei von zehn
Betroffenen haben dagegen Angriffe öffentlich gemacht, 13
Prozent haben wenigstens eine der Taten angezeigt.
Jede*r Fünfte der Politiker*innen mit Aggressions-
oder Gewalterfahrung gab an, deshalb im politischen
Engagement zurückgesteckt zu haben und beispielsweise
weniger aktiv im Wahlkampf zu sein oder sich weniger zu
kontroversen Themen zu äußern.
„Trotz gewisser
methodischer Grenzen: Die Ergebnisse zeigen leider auf
jeden Fall, dass Aggressionen und Gewalterfahrungen für
politisch Engagierte kein Randphänomen sind, sondern weit
verbreitet“, sagt Christina Schildmann, die Leiterin der
Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung. „Die
Polarisierung der politischen Auseinandersetzung hat
drastische Folgen – für die direkt Betroffenen, aber auch
weit darüber hinaus: Mit jeder Beleidigung und erst recht
mit jeder Bedrohung, jedem physischen Angriff wächst das
Risiko einer Lähmung demokratischer Institutionen. Das
schwächt den demokratischen Prozess sowie den
gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt.“
Die
neuen Befragungsergebnisse unterstreichen eine
Problematik, die beispielsweise auch Auswertungen des
Bundeskriminalamts zeigen: Für 2024 meldete das BKA
vergangene Woche einen deutlichen Anstieg politisch
motivierter Straftaten, von denen insgesamt gut die
Hälfte dem rechten Spektrum zugeordnet wurden. Die
BKA-Statistik verzeichnet für 2024 gut 6.000 Straftaten
gegen „Amts- und Mandatsträger“ – auch hier ein
deutlicher Zuwachs gegenüber dem Jahr zuvor.
Im
Kontext der Wahlen 2024 waren Politiker*innen oder
Einrichtungen der Grünen am häufigsten Ziel von
Straftaten, gefolgt von AfD und SPD. Bekannt gewordene
Fälle von Angriffen werden gesellschaftlich breit
diskutiert, insbesondere Gewaltverbrechen wie der Mord am
Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) durch einen
Rechtsextremen – oder wenn sich prominente
Politiker*innen wie etwa die frühere
Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas, der ehemalige
Ostbeauftragte Marco Wanderwitz (beide CDU) oder der
frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert aus der Politik
zurückziehen und das auch mit einem Klima der Aggression
begründen.
Das von der Hans-Böckler-Stiftung
geförderte KFN-Forschungsprojekt „Aggressionen und Gewalt
gegen Politiker*innen in Deutschland. Formen, Verbreitung
und Folgen für Individuum und Gesellschaft“ beschäftigt
sich mit der Frage nach dem Vorkommen, der Formen und
Folgen von Aggressionen und Gewalt gegen Politiker*innen
in Deutschland aus verschiedenen Perspektiven. Die
Online-Befragung ist der erste Teil einer wiederholten
Befragung, aus dem nun Ergebnisse vorliegen.
Eine
erneute Befragung der Teilnehmer*innen im Abstand von 6
Monaten zur Erstbefragung läuft aktuell, insbesondere
auch, um die mittelfristigen Folgen besser untersuchen zu
können. Darüber hinaus wurden u.a. 21 Interviews mit von
Aggressionen und/oder Gewalt betroffenen Politiker*innen
aller politischer Ebenen und aller zum Erhebungszeitpunkt
im Bundestag vertretenen Parteien geführt, um einen
vertieften Einblick in das individuelle Erleben
betroffener Politiker*innen zu bekommen.
Weitere
Informationen zum Forschungsprojekt und detaillierte
Ergebnisse:
Wer hat teilgenommen?
Insgesamt wurden
22.264 Politiker*innen zur Befragung eingeladen, nach
Datenbereinigung konnten die Antworten von 1.479 Personen
ausgewertet werden. Die Rücklaufquote lag dementsprechend
bei 6,6 Prozent. Im Folgenden werden für alle
Häufigkeitsangaben Schätzungen für die Population der
Politiker*innen in Deutschland auf Basis der gewichteten
Stichprobe berichtet. Die Mehrheit der Politiker*innen
war zum Befragungszeitpunkt auf Kommunalebene (rund 99
Prozent) tätig.
Weitere 1 Prozent waren auf
Landes- und 0,4 Prozent auf Bundesebene tätig. 66 Prozent
der Politiker*innen sind nach eigener Angabe männlich, 33
Prozent weiblich. Auf Grund des hohen Anteils an
Kommunalpolitiker*innen ist ein großer Anteil der
Politiker*innen parteilos (31%) bzw. gehört kleineren, in
der Befragung nicht gesondert erfassten Parteien an (6%).
Die weiteren Politiker*innen verteilen sich auf CDU/CSU
(21 %), SPD (16 %), Bündnis 90 / Die Grünen (12 %), die
AfD (3 %), die Freien Wähler (7 %), die FDP (2%) und die
Linke (1%).
Wie viele Politiker*innen haben welche
Art von Aggressionen und Gewalt erlebt?
Basierend auf
den gewichteten Daten der Stichprobe ergibt sich ein
geschätzter Wert von etwa 61 Prozent der Politiker*innen
in Deutschland, die während ihrer politischen Laufbahn
bereits mindestens einmal von Aggressionen und Gewalt
betroffen waren. Knapp die Hälfte (46 %) hat dabei auch
in den sechs Monaten vor der Befragung mindestens einmal
Aggressionen und/oder Gewalt erlebt. Verbale Aggressionen
kommen weitaus am häufigsten vor, aber auch körperliche
Angriffe, sexuelle Aggressionen und Sachbeschädigungen
sind keine Einzelfälle (siehe Abbildung 1 im
KFN-Factsheet; Link unten).
Worauf zielten die
Aggressions- und Gewalterfahrungen ab?
Die
Teilnehmenden wurden befragt, worauf die erlebten
Aggressionen und Gewalttaten der letzten sechs Monate vor
der Befragung ihrer Einschätzung nach abzielten. In den
meisten Fällen wurde die erlebte Gewalt als auf die
eigenen sachpolitischen inhaltlichen Positionen (52 %),
die eigene Parteizugehörigkeit (51 %) oder eigene
konkrete politische Äußerungen (44 %) abzielend erlebt.
Konkrete Merkmale der Person wurden hingegen deutlich
weniger als Ziel von Aggressionen und Anfeindungen
wahrgenommen. Am häufigsten wurde hier das Geschlecht als
wahrgenommenes Ziel genannt (16 %, siehe Abbildung 2 im
KFN-Factsheet).
Wie sind die Betroffenen mit der
Aggressions- und Gewalterfahrungen umgegangen?
Ungefähr vier von fünf Politiker*innen sprachen nach
Aggressions- und/oder Gewalterfahrungen in den letzten
sechs Monaten vor der Befragung mit ihrem privaten Umfeld
über die Tat. Etwa drei Viertel tauschten sich mit
Kolleg*innen aus der Politik über die Taten aus. Ein
Drittel gab an, nach mindestens einer der
Gewalterfahrungen geschwiegen zu haben bzw. „es mit sich
selbst ausgemacht“ zu haben.
Drei von zehn
Politiker*innen machten die Taten öffentlich.
Unterstützungsmöglichkeiten der eigenen Partei oder auch
parteiübergreifend zum Umgang mit Gewalterfahrungen
nutzten 17 Prozent. Zur Anzeige brachten 13 Prozent der
betroffenen Politiker*innen mindestens eine der Taten
(siehe Abbildung 3 im KFN-Factsheet).
Welcher
Zusammenhang besteht zwischen Aggressions- und
Gewalterfahrungen und dem psychischen Wohlbefinden?
Ein Vergleich von Politiker*innen mit Aggressions-
und Gewalterfahrungen in der politischen Laufbahn mit
denjenigen ohne solche Erfahrungen zeigt, dass die
betroffenen Politiker*innen statistisch signifikant
weniger Interesse oder Freude an ihren Tätigkeiten haben,
häufiger Gefühle von Niedergeschlagenheit, Schwermut oder
Hoffnungslosigkeit verspüren und sich häufiger nervös,
ängstlich oder angespannt fühlen.
Inwiefern hat
sich das politische Engagement nach Aggressions- und
Gewalterfahrungen verändert?
Bei der großen Mehrheit
von geschätzt 70 Prozent der Politiker*innen mit
Aggressions- oder Gewalterfahrung hat sich das politische
Engagement nach eigenen Aussagen dadurch nicht verändert.
Allerdings berichten auch jeweils um die 20 Prozent, dass
sie ihre Äußerungen zu kontroversen Themen, ihre
öffentliche Sichtbarkeit, ihre Aktivität im Wahlkampf
oder auch ihr Engagement insgesamt reduziert hätten.
Opfer von Aggressionen oder Gewalt haben zudem
häufiger als nicht Betroffene schon an einen Rückzug aus
der Politik gedacht. Ein (geringerer) Teil von jeweils
etwa einem Zehntel der Betroffenen reagiert hingegen
deutlich anders und erklärt, als Konsequenz das
politische Engagement intensiviert zu haben. Etwa jede*r
Fünfte gibt an, als Folge von Aggressions- oder
Gewalterfahrungen verstärkt Allianzen mit anderen
Politiker*innen eingegangen zu sein.

Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen

Erwerbstätigkeit im April 2025 saisonbereinigt
unverändert
Erwerbstätigenzahl um 0,1 % niedriger als
im Vorjahresmonat
Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland,
April 2025 0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)
+0,2 % zum
Vormonat (nicht saisonbereinigt) -0,1 % zum Vorjahresmonat
Im April 2025 waren rund 45,8 Millionen Menschen mit Wohnort in
Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) blieb die Zahl der
Erwerbstätigen damit saisonbereinigt unverändert gegenüber dem
Vormonat (0,0 %).
Letztlich blieb die Erwerbstätigenzahl seit
Dezember 2024 nahezu konstant, nach einem Rückgang um
14 000 Personen im Januar 2025 und geringen Anstiegen um 10 000 und
5 000 Personen im Februar und März 2025. Erwerbstätige mit Wohnort
in Deutschland.
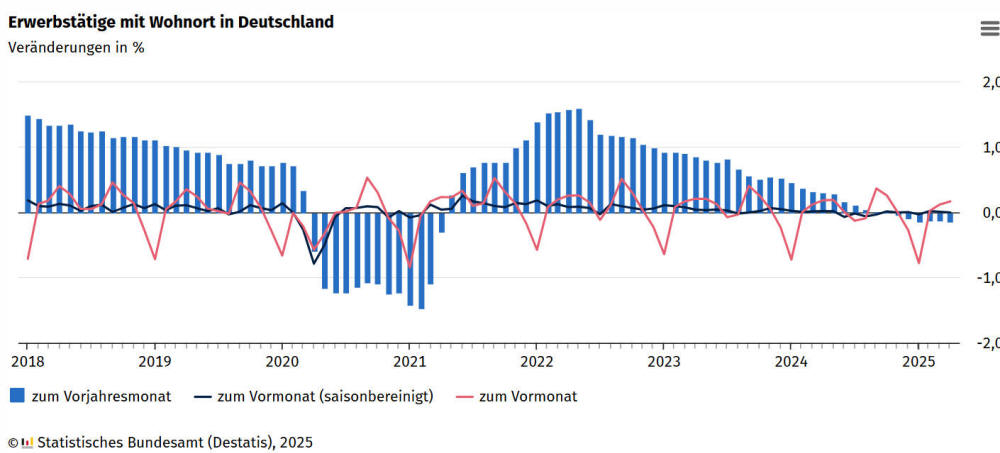
Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im April
2025 gegenüber März 2025 um 77 000 Personen (+0,2 %) zu. Der Anstieg
fiel damit weniger stark aus als im April-Durchschnitt der Jahre
2022 bis 2024 (+99 000 Personen).
Rückgang der
Erwerbstätigkeit im Vorjahresvergleich setzt sich fort
Gegenüber
April 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen im April 2025 um
61 000 Personen (-0,1 %). In den Monaten Dezember 2024 bis März 2025
hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr ebenfalls bei
-0,1 % gelegen.
Der seit November 2024 auf dem Arbeitsmarkt
erkennbare leichte Abwärtstrend im Vorjahresvergleich setzte sich
somit im April 2025 gleichbleibend fort. Bereinigte
Erwerbslosenquote im April 2025 bei 3,6 % Im April 2025 waren nach
Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,66 Millionen Personen
erwerbslos. Das waren 256 000 Personen oder 18,2 % mehr als im April
2024.
Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,8 % und zeigte damit
im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Anstieg in Höhe von
0,6 Prozentpunkten (April 2024: 3,2 %). Bereinigt um saisonale und
irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im April 2025 mit
1,58 Millionen Personen um 3 000 Personen niedriger als im Vormonat
März 2025 (-0,2 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im
Vergleich zum Vormonat unverändert bei 3,6 %.
Bezug des Treibhausgases Schwefelhexafluorid stieg Jahr
2024 um 14,9 %
Von Unternehmen bezogene Menge
entspricht 19,1 Millionen Tonnen CO2- Äquivalenten
Klimawirksame Stoffe beeinflussen die Erderwärmung und tragen zum
Klimawandel bei. Das stärkste bekannte Treibhausgas ist
Schwefelhexafluorid (SF6), dessen Treibhauspotenzial die
Klimawirksamkeit von Kohlenstoffdioxid (CO2) um das 23 500-Fache
übertrifft. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
haben deutsche Unternehmen im Jahr 2024 insgesamt 813,3 Tonnen
dieses Stoffs bezogen, das waren 105,8 Tonnen oder 14,9 % mehr als
im Jahr 2023.
Die im Jahr 2024 bezogene Menge SF6 entspricht
19,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten (Global Warming Potential,
GWP), wobei SF6 zum Großteil in geschlossenen Systemen verwendet und
nur in geringem Maß in die Atmosphäre freigesetzt wird.
NRW: Speisefischerzeugung auf
niedrigstem Stand der letzten zehn Jahre
*
2024 wurden rund 909.045 Kilogramm Speisefisch u.a.
Erzeugnisse erzeugt
* 82 % stammten aus der Zucht von
Regenbogenforellen
* Hochburg der Speisefischzucht
ist der Kreis Olpe
Im Jahr 2024 haben 63
Aquakulturbetriebe in Nordrhein-Westfalen 909.045
Kilogramm Speisefisch und andere Erzeugnisse wie
Rogen/Kaviar erzeugt. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt,
lag die erzeugte Menge mit einem leichten Rückgang von
0,6 % auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.
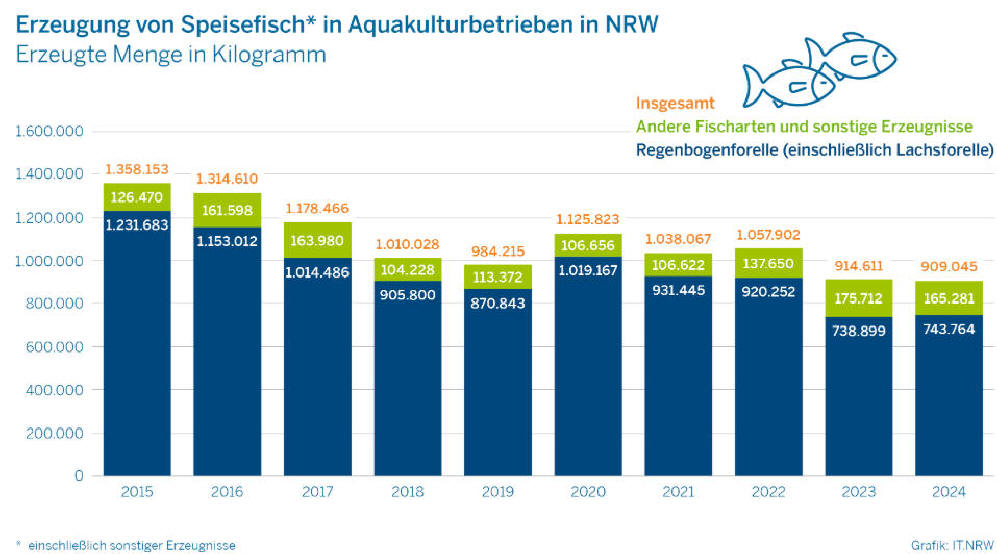
Die Erzeugung in Aquakulturbetrieben befand sich
damit auf dem niedrigsten Stand seit 2015 (damals:
1.358.153 Kilogramm). Über 80 % stammte aus der Zucht von
Regenbogenforellen Mit 743.764 Kilogramm stammten 2024
rund 82 % der Erzeugung aus der Zucht von
Regenbogenforellen; 184.965 Kilogramm davon waren
Lachsforellen. Zehn Jahre zuvor lag dieser Anteil noch
bei 91 %.
Weitere 39.596 Kilogramm gingen im
vergangenen Jahr auf Bachforellen und 5.000 Kilogramm auf
Bachsaibling zurück. Im Kreis Olpe wurden rund 15 % des
Speisefischs erzeugt Der höchste Anteil an der in NRW
erzeugten Fischmenge wurde mit 35,9 % im Regierungsbezirk
Köln produziert.
Auf den Plätzen zwei und drei
folgten die Regierungsbezirke Detmold (28,9 %) und
Arnsberg (21,0 %). In den weiteren Regierungsbezirken
spielte die Zucht von Speisefisch eine eher
untergeordnete Rolle. Hochburg der Speisefischzucht ist
weiterhin der Kreis Olpe, in dem vier Betriebe 14,8 % der
gesamten in NRW produzierten Fischmenge erbrachten.