






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 28. Kalenderwoche:
9. Juli
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 10. Juli 2025
Von der Leyen im Europäischen Parlament zu
Außenwirtschaftspolitik und Verhandlungen mit den USA
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nach dem
Europäischen Rat von vergangener Woche im Europäischen Parlament
über die Notwendigkeit einer „echten Außenwirtschaftspolitik“
gesprochen.
„Die drastische und disruptive Verschiebung der
globalen Wirtschaftsbeziehungen im letzten Jahr macht dieses
Ansinnen noch dringlicher. Aber jede Außenwirtschaftspolitik muss zu
Hause beginnen. Denn zuerst müssen wir unsere eigene wirtschaftliche
und industrielle Basis stärken und schockresistenter machen“,
erklärte die Kommissionspräsidentin.
Zollverhandlungen mit den USA
Sie sagte
weiter: „Wenden wir uns nun den USA zu. Seit Februar hat Washington
Zölle auf 70 Prozent unseres gesamten Handels mit den USA verhängt.
Umfang und Höhe dieser Zölle sind beispiellos. Unsere Linie war
klar. Wir werden standhaft bleiben. Aber wir bevorzugen eine
Verhandlungslösung. Deshalb arbeiten wir eng mit der US-Regierung
zusammen, um eine Einigung zu erzielen. Ich hatte Anfang dieser
Woche einen guten Austausch mit Präsident Trump, um die Dinge
voranzubringen. Wir suchen nach einem klaren Rahmen, auf dem wir
weiter aufbauen können. Die Botschaft ist klar. Wir halten uns an
unsere Prinzipien. Wir verteidigen unsere Interessen. Wir setzen die
Arbeit in gutem Glauben fort, bereiten uns aber gleichzeitig auf
alle Szenarien vor.“
Handelsverträge mit internationalen
Partnern
„Der Grund, warum wir Tag und Nacht an einer Lösung
arbeiten, ist, dass wir glauben, dass Zölle schlecht fürs Geschäft
sind“, erklärte von der Leyen. „Und wir sind nicht die einzigen.
Seit Beginn unseres neuen Mandats haben wir bereits neue Verträge
mit dem Mercosur, Mexiko und der Schweiz geschlossen. Wir arbeiten
daran, das Abkommen mit Indien bis Ende des Jahres abzuschließen.
Und es wird weiter in diese Richtung gehen. Weil die Welt nach
Partnern sucht, auf die sie sich verlassen kann. Europa ist dieser
Partner. Und das ist für uns ein wesentlicher Bestandteil unserer
Außenwirtschaftspolitik und unserer Wettbewerbsfähigkeit. Denn diese
Verträge können europäischen Unternehmen immense neue Chancen und
Märkte eröffnen. Also ja, dies ist eine risikoreiche Zeit für
Europa. Aber die Chancen sind da. Und es liegt an uns, sie zu
nutzen.“

Verteidigung
Die Kommissionspräsidentin erklärte mit Blick auf
den russischen Angriffskrieg in der Ukraine: „Der Krieg wütet
weiter. Die Bedrohung durch Russland bleibt bestehen. Das ist die
Realität, die wir immer vor Augen haben müssen, wenn wir über
Verteidigung sprechen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass
andere Europa schützen. Die Verteidigung Europas liegt in unserer
eigenen Verantwortung.“
Die Europäische Union habe seit dem
Europäischen Rat im März große Schritte nach vorne gemacht und das
Weißbuch „Bereitschaft 2030“ vorgelegt.
„Der
ReArm-Europe-Plan enthält die notwendigen Instrumente, um den
gestiegenen Investitionsbedarf zu bewältigen. Und wir haben
Investitionen von bis zu 800 Milliarden Euro bis 2030 ermöglicht.
Die notwendige Steigerung der europäischen Verteidigungsausgaben ist
jetzt möglich. 16 Mitgliedstaaten haben bereits die Aktivierung der
nationalen Ausweichklausel beantragt. Diese ermöglicht eine
erhebliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben, ohne dass ein
Defizitverfahren eingeleitet wird.
Hinzu kommt SAFE – mit
Darlehen in Höhe von 150 Milliarden Euro für die gemeinsame
Beschaffung. Zehn Mitgliedstaaten haben bereits ihre Absicht
bekundet, Darlehen aufzunehmen. Ich erwarte, dass sich noch mehr
anschließen. Und das ist entscheidend. Denn bei der
Verteidigungsbereitschaft geht es nicht nur darum, wie viel wir
ausgeben. Es geht auch darum, wie wir ausgeben.“
Bereitschaftsplan bis Oktober
Deshalb habe der Europäische Rat
die Kommission beauftragt, für seine Tagung im Oktober einen
Bereitschaftsplan auszuarbeiten. „Wir werden mit den Mitgliedstaaten
zusammenarbeiten, um ihre Kapazitätslücken zu ermitteln. Wir werden
gemeinsame europäische Beschaffungsvorhaben konzipieren. Damit die
Mitgliedstaaten mehr für Interoperabilität ausgeben und ihre
Haushaltsmittel europäischer einsetzen. Und wir wollen, dass mehr
Investitionen in Europa getätigt werden. Wir wollen unsere eigene
Verteidigungsindustrie ankurbeln und mehr Forschung und Entwicklung
in unseren Mitgliedstaaten halten. Dabei geht es nicht nur um
Sicherheit. Es geht auch darum, hier in Europa hochwertige
Arbeitsplätze zu schaffen“, sagte von der Leyen.
Neue Brücke an der Heerstraße: Namenswahl geht in
die zweite Runde
Das Stadtteilbüro Hochfeld lädt alle
Bürgerinnen und Bürger ein, sich an der Namenswahl für die neue Fuß-
und Radwegebrücke an der Heerstraße in Duisburg-Hochfeld zu
beteiligen.
In der zweiten Runde der Namenssuche kann man
unter der Internetadresse www.duisburg.de/brueckenname seinen
persönlichen Favoriten aus den verbliebenen sechs Vorschlägen
auswählen: „Hochfelder Tor“, „Brücke des Friedens“, „Hochfelder
Sonne“, „Brücke der Hoffnung“, „Brücke der Kulturen“ oder
„Hochfelder Bogen“.
Die Aktion läuft bis Donnerstag, 31.
Juli. Die Namenssuche hat im April 2025 mit einem öffentlichen
Aufruf gestartet. Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger war
groß, es wurden insgesamt rund 70 Vorschläge eingereicht. Daraus hat
der Verfügungsfonds-Beirat, ein Gremium aus verschiedenen Hochfelder
Akteuren, eine Vorauswahl von sechs Vorschlägen getroffen, die nun
zur Abstimmung stehen.
Die Abstimmungsergebnisse werden der
Bezirksvertretung Duisburg-Mitte übergeben, die den Namen der neuen
Brücke endgültig festlegt. Die neue rund 30 Meter lange
Stahl-Stabbogenbrücke zwischen dem Brückenplatz und dem Platanenhof
verbindet künftig den Grünen Ring mit der Bocksbarttrasse und
schafft eine durchgehende Verbindung zwischen Innenstadt und Rhein.
Leben retten will gelernt sein - Kooperationsvereinbarung
zur verpflichtenden Einführung von Reanimationsunterricht ab dem
Schuljahr 2026/27 unterzeichnet
Mit der Unterzeichnung
einer Kooperationsvereinbarung am 8. Juli 2025 setzt
Nordrhein-Westfalen ein klares Zeichen, um die Laienreanimation an
Schulen zu stärken. Schulministerin Dorothee Feller hat gemeinsam
mit Vertreterinnen und Vertretern von Stiftungen, Ärztekammern,
Hilfsorganisationen, ärztlichen Partnerinnen und Partnern und
medizinischen Fachgesellschaften eine Initiative zur Verankerung der
Laienreanimation im Schulalltag auf den Weg gebracht.
Ziel
der Kooperationsvereinbarung ist es, alle Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe I mit dem lebensrettenden Schema „Prüfen – Rufen –
Drücken“ vertraut zu machen.
Zu den Partnern gehören in
alphabetischer Reihenfolge:
· ADAC Stiftung,
· Aachener
Institut für Rettungsmedizin und zivile Sicherheit
· Ärztekammern
Nordrhein und Westfalen-Lippe
· Berufsverband Deutscher
Anästhesistinnen und Anästhesisten
· Björn-Steiger-Stiftung,
·
BKK-Landesverband NORDWEST
· Deutsche Herzstiftung
· Deutsche
Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin
· Deutscher
Rat für Wiederbelebung
· Deutsches Rotes Kreuz (Landesverbände
Nordrhein und Westfalen-Lippe)
· Deutsches Jugendrotkreuz
(Landesverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe)
·
Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf
· Franziskus Hospital
Bielefeld
· Stiftung Universitätsmedizin Münster
· Unfallkasse
NRW
· Universitätsklinikum Köln
· Universitätsklinikum Münster
Ministerpräsident Hendrik Wüst erklärt: „Ob im Straßenverkehr,
am Arbeitsplatz oder in den eigenen vier Wänden: Jeder kann zum
Lebensretter werden. Wie es richtig geht, muss man lernen – und zwar
schon in der Schule. Mit dem verpflichtenden
Wiederbelebungsunterricht ab dem Schuljahr 2026/27 vermitteln wir
Schülerinnen und Schülern das notwendige Wissen, um im medizinischen
Notfall richtig zu handeln und Leben zu retten. Solche Kompetenzen
weiterzugeben, ist Teil unseres Bildungs- und Erziehungsauftrags.“
Schulministerin Dorothee Feller hebt hervor: „Wer im Notfall
richtig handelt, kann Leben retten. Wir wollen, dass Prüfen – Rufen
- Drücken so selbstverständlich wird wie Fahrradfahren. Dafür
brauchen Schulen konkrete Unterstützung und genau die bringen wir
jetzt gemeinsam mit starken Partnerinnen und Partnern auf den Weg.“
Ab dem Schuljahr 2026/27 wird der Reanimationsunterricht an
Schulen im Bereich der Sekundarstufe I in NRW verpflichtend
eingeführt. Jede Schülerin und jeder Schüler soll mindestens einmal
in den Klassen 7, 8 oder 9 eine Schulung zur Laienreanimation im
Umfang von 90 Minuten erhalten. Förderschulen und private
Ersatzschulen werden ermutigt, Reanimationsunterricht durchzuführen.
Zum 1. August 2025 wird eine Geschäftsstelle bei der
Bezirksregierung Köln eingerichtet. Bereits im September beginnen
landesweit die ersten Schulungen von Lehrkräften.
Damit der
Reanimationsunterricht flächendeckend und zuverlässig umgesetzt
werden kann, sollen alle rund 2.100 Schulen mit Sekundarstufe I in
Nordrhein-Westfalen spätestens im Laufe des Schuljahres 2026/27 über
jeweils zehn Reanimationsphantome sowie zwei entsprechend geschulte
Lehrkräfte verfügen.
Der Mindeststandard für die Schulung der
Lehrkräfte wird durch Schulungsvideos der oben aufgeführten
Kooperationspartner gewährleistet. Alle Lehrkräfte können zudem auf
ein umfassendes Angebot an Lehrvideos und Unterrichtsmaterialien von
anderen Projektpartnern zurückgreifen. Ergänzend wird ein Angebot
für Präsenzfortbildungen unterbreitet.
Um die Maßnahme
umzusetzen, ist das Schulministerium auf die enge Zusammenarbeit mit
erfahrenen Partnern in diesem medizinischen Bereich angewiesen. In
Gesprächen konnten zahlreiche Unterstützungsangebote gewonnen
werden. Die Angebote umfassen etwa personelle Ressourcen für
Schulungen bis hin zu finanziellen Mitteln für die Anschaffung von
Übungsmaterial.
Christina Tillmann, Vorständin der
ADAC-Stiftung und eine der vielen Kooperationspartner unterstrich:
„Wenn wir junge Menschen schon in der Schule befähigen, im Notfall
richtig zu reanimieren, retten wir nicht nur mehr Leben, sondern
stärken auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die
flächendeckende Einführung des Reanimationsunterrichts in NRW hat
Vorbildcharakter und ist ein kraftvolles Signal für Bildung mit
echtem Lebensbezug.“
Dr. Pierre-Enric Steiger, Präsident der
Björn-Steiger-Stiftung, betonte: „Die Björn-Steiger-Stiftung ist
stolz, dieses lebensrettende Projekt zu unterstützen. Durch die
Schulung von Schülerinnen und Schülern in Laienreanimation schaffen
wir eine Generation, die im Notfall mutig handelt.“
Prof. Dr.
Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Herzstiftung, erklärte: „Das beherzte Eingreifen von uns allen in
einer Notsituation ist überlebensentscheidend. Dass die
Wiederbelebung jetzt ein fester Bestandteil des Schulunterrichts in
Nordrhein-Westfalen wird, ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung
der Laien-Reanimationsquote in der Bevölkerung.“
Die heute
unterzeichnete Kooperationsvereinbarung hatte einen engagierten
Vorlauf im Rahmen des Modellprojekts „Laienreanimation an Schulen in
Nordrhein-Westfalen“ von 2017 bis 2022. Dieser Vorlauf war
insbesondere geprägt durch das freiwillige Engagement der ärztlichen
Partner sowie zahlreiche Gespräche, in denen viele Akteure – auch in
privater und ehrenamtlicher Initiative – mitgewirkt haben.
Universitätsprofessor Bernd Böttiger, Vorstandsvorsitzender des
Deutschen Rates für Wiederbelebung, betont: „Seit vielen Jahren
setzen wir uns intensiv mit dem Thema Laienreanimation auseinander.
Dass der Reanimationsunterricht nun für alle Schülerinnen und
Schüler verpflichtend wird, ist ein bedeutender Schritt – und ein
großer Erfolg. Diese Entscheidung wird dazu beitragen, viele
Menschenleben zu retten.“
Universitätsprofessor Hugo Van
Aken, Vorsitzender der Stiftung Universitätsmedizin Münster erklärt:
„Ein lang gehegter Traum wird nach 20 Jahren endlich Wirklichkeit.
Es ist großartig, dass Nordrhein-Westfalen als größtes Bundesland
einen verpflichtenden Reanimationsunterricht einführt. So wird
deutlich – Wiederbelebung kann wirklich jeder lernen.“
Ministerin Feller dankt allen beteiligten Partnern für ihre
Mitwirkung: „Dieses Bündnis zeigt, was möglich ist, wenn
verschiedene Institutionen mit unterschiedlichen Beiträgen ein
gemeinsames Ziel verfolgen. Ich bin allen Partnern für ihre
fachliche und personelle Unterstützung sowie den Stiftungen ADAC-,
Björn-Steiger- und Deutsche Herzstiftung für ihre finanzielle
Unterstützung ausdrücklich dankbar.
Jeder einzelne Beitrag
eines jeden Partners ist ein großer Gewinn für die Laienreanimation
von Schülerinnen und Schüler. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass
unsere Schülerinnen und Schüler auf den Ernstfall gut vorbereitet
sind.“
ADAC-Stiftung: Reanimationsunterricht -
wichtig, um Leben zu retten
Zweijährige konzeptionelle
Zusammenarbeit / Unterstützung für die Qualifikation von Lehrkräften
und bei der Ausstattung mit Unterrichtsmaterialien / Tillmann:
„Gemeinsam stärken wir Kinder, im Notfall zu helfen.“

Reanimationsunterricht - wichtig, um Leben zu retten - Foto: Stefan
Hobmaier.
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat heute
bekannt gegeben, Reanimationsunterricht verpflichtend in den
Lehrplan aller weiterführenden Schulen aufzunehmen. Die ADAC
Stiftung ist eine von mehreren Organisationen, die das
bevölkerungsreichste Bundesland bei der Realisierung unterstützen.
Die ADAC Stiftung hat seit rund zwei Jahren daran mitgearbeitet, das
inhaltliche Konzept zu entwickeln. Für Schulungen der Lehrkräfte,
eine begleitende Evaluation und Unterrichtsmaterialien stellt die
ADAC Stiftung in den kommenden Jahren ihre inhaltliche Expertise und
finanzielle Ressourcen zur Verfügung.
Christina Tillmann,
Vorständin der ADAC Stiftung, sagte zur Ankündigung der
Landesregierung: „Wenn junge Menschen bereits in der Schule lernen,
im Notfall richtig zu reanimieren, können wir nicht nur mehr Leben
retten, sondern stärken auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Die flächendeckende Einführung des Reanimationsunterrichts in NRW
hat Vorbildcharakter und ist ein kraftvolles Signal für Bildung mit
echtem Lebensbezug.“
Die ADAC Stiftung hat in mehreren
regionalen Pilotprojekten Konzepte für Reanimationsunterricht in
Schulen erprobt und setzt sich für eine Aufnahme ins Curriculum auch
in anderen Bundesländern ein. Hessen und Saarland haben
entsprechende Erlasse bereits beschlossen, doch Nordrhein-Westfalen
ist das erste Bundesland, dass bereits vor Inkrafttreten landesweit
tragfähige Strukturen für eine dauerhafte Umsetzung schafft.
„Nordrhein-Westfalen geht einen strategisch klugen Weg, der auf
Langfristigkeit und echte Wirksamkeit ausgerichtet ist, und der
hoffentlich von weiteren Bundesländern übernommen wird.“, sagte
Christina Tillmann.
Über die ADAC Stiftung:
Die ADAC
Stiftung konzentriert sich in ihrer Arbeit auf zwei Themen:
Mobilität und Lebensrettung. Sie setzt sich dafür ein, dass alle
Menschen in Deutschland ihrem Bedürfnis nach Mobilität sicher und
nachhaltig nachkommen können. Und dass Menschen mit akuten
Verletzungen oder in lebensbedrohlichen Situationen im ganzen Land
schnelle und wirksame Hilfe erhalten.
Zudem fördert sie mit der
Einzelfallhilfe gezielt die soziale Teilhabe von Unfallopfern und
ihren Familien.
Die Stiftung ist seit ihrer Gründung 2016
alleinige Gesellschafterin der gemeinnützigen ADAC Luftrettung und
fördert interdisziplinäre Projekte im Rettungswesen.
Abbau dauert bis Mitte nächster Woche
• Krane auf
Bahnsteig 2 bleiben weiter aktiv • Arbeiten an Bahnsteigen 3 und 4
gehen auf die Zielgerade
• Freigabe der Gleise 5 bis 8 im
Oktober 2025 • Modernisierung des Hauptbahnhofs im Zeitplan
Duisburg, 9. Juli 2025 - Die Deutsche Bahn startet am kommenden
Wochenende mit dem Rückbau von zwei XXL-Kranen am Duisburger
Hauptbahnhof. Ab Samstag, 12. Juli, beginnt die Demontage der
Maschinen auf Bahnsteig 5 (Gleis 10/11). Hierfür benötigen die
Bauteams zwei Mobilkrane, die ab dem frühen Morgen auf der Ostseite
des Hauptbahnhofs aufgebaut werden. Mithilfe der Mobilkrane können
die beiden XXL-Krane auf Bahnsteig 5 Stück für Stück abgebaut
werden.
Zunächst entfernen die Baufachleute die jeweils 19
Tonnen schweren Gewichte an den Kranen. Anschließend werden die 56
Meter langen Ausleger abgebaut und mithilfe der Mobilkrane nahe des
Osteingangs zwischengelagert. Diese Arbeiten sind voraussichtlich
Sonntagabend abgeschlossen. Am Montag zerlegen die Bauteams die
Ausleger am Osteingang in ihre Einzelteile, so dass der Abtransport
per LKW erfolgen kann.
Sobald die Fläche wieder frei ist,
können die beiden 100 Meter hohen Krantürme, die Kabinen und die
Drehbühnen in den folgenden Nächten abgebaut werden. Die Bauteams
entfernen voraussichtlich bis Mittwochabend sämtliche Kranelemente,
so dass der Mobilkran direkt im Anschluss abgebaut werden kann.
Kraneinsatz während der gesamten Modernisierung

Archivbild von 2022:
Noch vor dem Rückbau von Bahnsteig 6 sind die beiden Krane
aufgestellt worden (Quelle: DB AG)
Die beiden XXL-Krane waren
seit Baubeginn im Sommer 2022 im Einsatz. Der Schwerpunkt lag dabei
auf den Bahnsteigen 4 bis 6 (Gleise 8-13). Die Krane waren elementar
wichtig, um Schutt und Stahl aus der Gleishalle zu befördern. Seit
Baubeginn haben beide Maschinen rund 600 Tonnen Altmaterial aus dem
Bahnhof gebracht. Im Gegenzug haben sie neue Gleishallenelemente
eingebaut, darunter u.a. rund 650 Tonnen Stahl.
Im Bahnhof
sind weiterhin zwei große Krane auf Bahnsteig 2 (Gleis 3/4) im
Einsatz. Diese bleiben bis zum Abschluss des Großprojekts bestehen,
um die Gleishalle über den Bahnsteigen 1 bis 3 und den Gleisen zu
errichten.
Geringe Auswirkungen rund um den Bahnhof
Während der Arbeiten kommt es zu geringfügigen Einschränkungen an
der Ostseite des Bahnhofs. Die Haltestellen für den
Schienenersatzverkehr müssen von Freitag, 11. Juli, bis
voraussichtlich Mittwoch, 16. Juli, verlegt werden. Reisende finden
die Haltestellen an der Neudorfer Straße.
Darüber hinaus
sind Teile der Kammerstraße und der Otto-Keller-Straße von Samstag,
12. Juli, bis voraussichtlich Mittwoch, 16. Juli, gesperrt. Hier
benötigen die Baufirmen Flächen für die Demontage der Kranteile. In
einem Teil der Otto-Keller-Straße gilt eine Halteverbotszone.
Das
Herausheben der Kranelemente findet überwiegend nachts statt und hat
daher nur geringfügige Auswirkungen auf den Zugbetrieb.

Foto sDeutsche Bahn AG - Axel Hartmann Fotografie - "Außen-Welle)

Die "innere Welle"

Erneuerung der Bahnsteigkante (Mai 2025) - Foto Bahn AG Stefan
Deffmer
Bauturbo: Nachbesserung beim § 246e BauGB
Durchbruch für selbstnutzende Wohneigentümer*innen
Der
gemeinnützige Verband Wohneigentum begrüßt die Nachbesserung beim §
246e BauGB als "Durchbruch für selbstnutzende Eigentümer und
Eigentümerinnen" und spricht sich für eine Zustimmungsfiktion aus.
Gesetzesentwurf überarbeitet
Im neuen Entwurf des Gesetzes
zur Beschleunigung des Wohnungsbaus hat das Bundesbauministerium
eine zentrale Forderung des Verbands Wohneigentum aufgegriffen: Die
sogenannte Experimentierklausel (§ 246e BauGB) soll künftig ohne
Mindestanzahl an Wohneinheiten gelten. Damit können künftig auch
kleinere bauliche Maßnahmen – etwa der Anbau einer Einliegerwohnung
oder die Umnutzung eines Nebengebäudes – rechtssicher zügiger
ermöglicht werden.
„Das ist ein echter Fortschritt –
insbesondere für Eigentümer*innen, die für Kinder, Eltern oder
Pflegekräfte auf dem eigenen Grundstück Wohnraum schaffen möchten“,
erklärt Verena Örenbas, Bundesgeschäftsführerin des Verbands
Wohneigentum e.V.. „Kleinteilige Nachverdichtung wird damit
rechtlich einfacher und unbürokratischer möglich.“
Diese
Flexibilität ermögliche sowohl die Schaffung neuen Wohnraums als
auch die Anpassung bestehender Gebäude an veränderte
Lebenssituationen – etwa im Alter oder bei Pflegebedarf.
Kommunen sind gefordert
Zeitlich befristet bis zum 31. Dezember
2030 erlaubt § 246e BauGB künftig Abweichungen vom bestehenden
Bauplanungsrecht – vorausgesetzt, die zuständige Gemeinde stimmt zu.
„Damit dieses Zeitfenster genutzt werden kann, ist jetzt das
Mitziehen der Kommunen gefordert“, so Örenbas. Der Verband warnt:
Ohne klare gesetzliche Fristen, ohne Rechtsanspruch und ohne
Begründungspflicht der Gemeinde bestehe das Risiko, dass sinnvolle
Vorhaben abgelehnt oder verzögert würden.
Für eine
Zustimmungsfiktion
Der Eigentümerverband fordert daher eine
Zustimmungsfiktion nach dem Vorbild des § 36 Abs. 2 BauGB: Wenn eine
Gemeinde nicht innerhalb einer bestimmten Frist entscheidet, gilt
die Zustimmung als erteilt. „Nur so entsteht die Planungs- und
Investitionssicherheit, die viele Eigentümer*innen dringend
brauchen“, betont Örenbas.
Eigentum als Teil der Lösung
Selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer leisten seit
Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur Wohnraumversorgung – durch
Pflege des Bestands, nachhaltige Nutzung von Flächen und
generationsübergreifendes Bauen. Der geänderte Gesetzentwurf erkennt
diesen Beitrag erstmals in einem zentralen Planungsinstrument an.
„Familiennah, nachhaltig, unkompliziert – so muss Wohnungsbau
auch funktionieren“, fasst Örenbas zusammen. „Jetzt kommt es darauf
an, dass diese neue Chance auf allen Ebenen genutzt wird.“
Stadtführung: „Stadtgeschichte draußen –
Industrialisierung und Deindustrialisierung in Bruckhausen“
Dr. Andreas Pilger und Annika Enßle vom Stadtarchiv führen am
Donnerstag, 10. Juli, durch Bruckhausen. Es geht auf Spurensuche in
einen Stadtteil, dessen Geschichte und Erscheinungsbild maßgeblich
von den wirtschaftlichen Bedingungen vor Ort bestimmt werden. Der
Rundgang führt von der Hauptverwaltung der August-Thyssen-Hütte zu
den Wohnquartieren der Arbeiter und leitenden Angestellten, zur
Liebfrauenkirche, über den 2016 angelegten Grüngürtel bis zur
Brotfabrik Overbeck, die heute als Atelier und Kulturraum genutzt
wird.
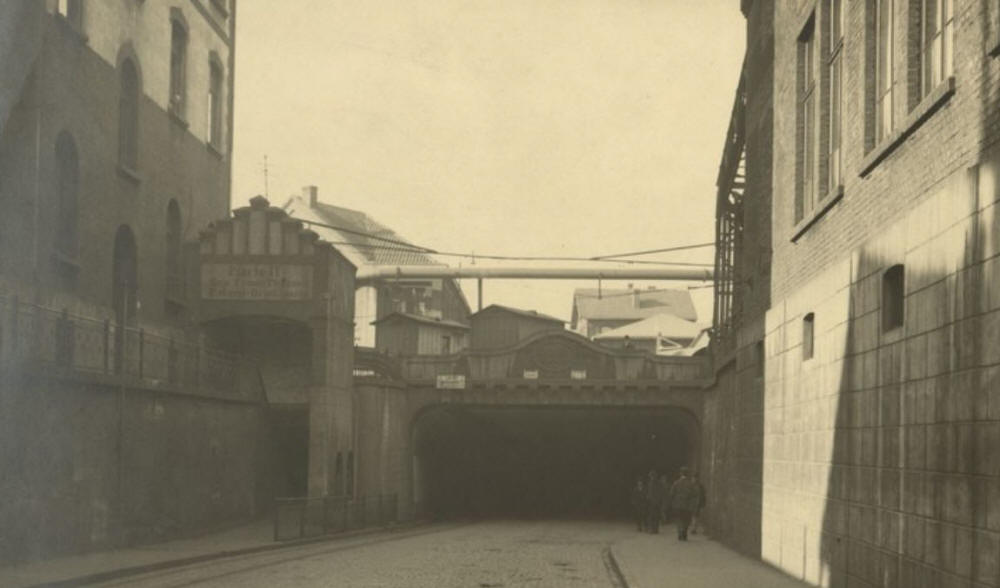
Kokerei Bruckhausen, ca. 1920 - Foto Stadtarchiv Duisburg
Anhand dieser Gebäude und der städtebaulichen Gestaltung wird die
Geschichte Bruckhausens nachvollziehbar und ein neugieriger Blick
auf den Zusammenhang von Stadtentwicklung, Architektur, Wirtschaft
und Gesellschaft geworfen. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der
Grünanlage vor dem Verwaltungshochhaus von thyssenkrupp an der
Kaiser-Wilhelm-Straße 100 in 47166 Duisburg. Der Rundgang ist
kostenfrei.
„Hinschauen! Führung zu übersehenen
Spuren des Kolonialismus in Duisburg“
Das „Zentrum für
Erinnerungskultur“ bietet am Sonntag, 13. Juli, um 15 Uhr im Kultur-
und Stadthistorischen Museum eine spannende Führung zu den lokalen
kolonialen Spuren an. Welche versteckten Spuren des Kolonialismus
sind heute noch sichtbar? Wo lagen früher Kolonialwarenläden?
Gab es Duisburgerinnen und Duisburger, die als Soldaten,
Missionare oder Siedler in die Kolonialgebiete reisten? Und welche
Auswirkungen hat dieses dunkle Kapitel der Geschichte bis heute auf
die Stadt?

Hinschauen! Führung zu übersehenen Spuren des Kolonialismus in
Duisburg - Foto Tanja Piclartz Stadt Duisburg
Christa Frins,
Kuratorin der Ausstellung „ÜBERSEeHEN. Auf (post)kolonialer
Spurensuche in Duisburg“, leitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
durch zwei Jahrhunderte Duisburger Kolonialgeschichte. Sie zeigt,
was Paradiesvögel aus Ozeanien mit Damenhüten in Duisburg zu tun
haben, beleuchtet die Bedeutung des Böninger-Parks und erklärt die
Rolle der Duisburger Häfen.
Dabei wird deutlich, wie
koloniale Ausbeutung und Handel bis in die Gegenwart nachwirken. Der
Eintritt ist im Museumseintritt enthalten. Eine Anmeldung unter
zfe@stadt-duisburg.de oder telefonisch unter 0203 2832640 ist jedoch
erforderlich.
Kultur- und Stadthistorisches Museum: Kreative
Postkarten aus Styrenedruck gestalten
Das Kultur- und
Stadthistorische Museum bietet Sonntag, 13. Juli, von 12 bis 17 Uhr,
am Johannes-Corputius-Platz 1 am Duisburger Innenhafen einen
Workshop an, bei dem sich kreative Postkarten gestalten lassen.
Künstlerin Katharina Nitz zeigt den Teilnehmenden, wie man mit dem
Styrenedruckverfahren schöne und individuelle Postkarten selber
machen kann.
Hierzu werden in Druckplatten, Motive
eingeritzt, die dann eingefärbt und anschließend auf Papier
übertragen werden. Eine originelle Postkartengestaltung, mit der
leicht variierende Drucke mit persönlichem Charakter entstehen. Zu
einer kleinen Auszeit lädt auch das Mercator-Café im Museum ein, wo
heiße und kalte Getränke sowie leckere Kuchen genossen werden
können.
Die Teilnahme am Workshop sowie der Besuch der
stadtgeschichtlichen Dauerausstellung sind kostenlos. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Weitere Informationen und das Programm des
Kultur- und Stadthistorischen Museums gibt es online unter
www.stadtmuseum-duisburg.de
Rheingemeinde trotzt dem Regen
Gemeindefest zum Thema
Gemeinschaft war gut besucht
Der Wetterbericht für den
vergangenen Sonntag, 6. Juli, machte nicht viel Hoffnung auf
Sonnenschein. Für die Verantwortlichen der Evangelischen
Rheingemeinde Duisburg war das kein Problem, denn es gab ja einen
Plan B. So wurde das lange geplante Gemeindefest, das eigentlich
rund um die Gnadenkirche in Wanheimerort stattfinden sollte,
kurzerhand in das Gotteshaus verlegt.
Pfarrerin Almuth
Seeger eröffnete zusammen mit ihrem Team das Fest mit einem
Gottesdienst an langen Tischreihen. Es ging um Gemeinschaft: Im
Mittelpunkt stand dabei der Regenbogen als zentrales Symbol für
Gemeinschaft und bunte Vielfalt. Die Kindergartenkinder der Gemeinde
hatten dazu ein kleines Anspiel vorbereitet, in dem sie sangen „Wir
sind die Kleinen in den Gemeinden - wir sind das Salz in der Suppe
der Gemeinde“. Überhaupt war der Gottesdienst musikalisch, gestaltet
vom Pop-Quartett der Gemeinde.
Anschließend gab es
Spielangebote, Kuchenbuffet, Gegrilltes, eine
Rheingemeinde-Ausstellung zu den Angeboten der Gemeinde, eine
Hüpfburg - die trotz Regen gerne genutzt wurde - und ein
vielfältiges Bühnenprogramm. So sangen der Chor „Soul, Heart &
Spirit“ und der Singkreis, und die Rheintanzgruppe tanzte und
forderte auch das Publikum zum Mitmachen auf.
Schließlich
lud Kantor Daniel Drückes zum gemeinsamen Singen ein und
Kneipenquiz-Macher Falko Stampa wiederum lud zum Abschluss zum
großen Mitraten beim Gemeindequiz. Von Schlechtwetterstimmung konnte
mit all dem keine Rede sein – und auch nicht bei den zahlreichen
Besuchern des Gemeindefestes. Bis zum frühen Abend wurde gefeiert,
geklönt, gegessen und getrunken. Ein lebendiges Zeichen der
Gemeinschaft.

Gemeindefest, aufgenommen beim Eröffnungsgottesdienst in der
Gnadenkirche Wanheimerort (Foto: Ev. Rheingemeinde Duisburg)
Sechs Sommerkonzerte in der Friedenskirche laden zur
musikalischen Ländertour ein - Akkordeonorchester und Orgel zum
Auftakt
Musikfans können sich auf die Ferienzeit freuen,
denn die Reihe der sommerlichen Orgelkonzerte in der Hamborner
Friedenskirche wird auch 2025 fortgesetzt: Musikerinnen und Musiker
aus anderen Städten sind an sechs Mittwoch-Abenden jeweils um 19.30
Uhr in dem Gotteshaus an der Duisburger Straße 174 zu Gast und
lassen feinste Orgelmusik erklingt, bei einigen Abenden geben auch
andere Instrumente den Ton mit an.
So spielt zum Auftakt am
16. Juli der Weseler Kirchenmusikdirektor Ansgar Schlei die Orgel,
das Akkordeonorchester 1980 Dinslaken/Oberhausen sorgt unter der
Leitung von Johannes Burgard für ein zweites Klangerlebnis an dem
Abend. Zu hören ist Musik von Bach, Mozart, Guilmant, Franck,
Piazolla und weitere Komponisten.
Am 23. Juli gibt das
Ensemble CONCERT ROYAL aus Köln unter dem Titel „Musik aus
Sächsischen Schlosskirchen“ ein Konzert mit Werken von Bach, Krebs,
Homilius, Hertel und weiteren Komponisten. Die Orgel spielt Willi
Kronenberg aus Bonn. Mit dem Konzert am 30. Juli geht es nach Irland
und in die schottischen Highlands: Elke Jensen, Mezzosopran &
Tin-Whistle und Hans-André Stamm an der Orgel werden mit Liedern aus
beiden Landschaften und von keltischer Folklore inspirierten
Orgelwerken das Publikum verzaubern.
Der Konzertabend am 6.
August nimmt das Publikum entführt das Publikum in das Nachbarland,
denn unter dem Titel „Dancing Pipes“ wird Lea Marie Lenart aus Lage
an der Lippe heitere Tänze aus England auf der Orgel spielen. Das
Konzert am 13. August hingegen führt in die französische Hauptstadt:
Larissa und Andreas Blechmann aus Ahlen spielen Werke französische
Komponisten, u.a. das Werk „Images de Paris“ von Julien Bret, das
musikalische Pont Neuf, Notre-Dame, den Jardin du Luxembourg und den
Eiffel-Turm musikalische nachzeichnet.
Das Abschlusskonzert
am 20. August lädt zum Besuch nach Skandinavien ein:
Kirchenmusikdirektor Ulrich Cyganek aus Mettmann spielt unter dem
Titel „Nordlichter“ u.a. Orgelwerke von Per Inge Almas, Oskar
Lindberg, Edvard Grieg und anderen Komponisten.
Für jedes
Konzert gilt: Wenn das Wetter mitspielt, kann das
kulturinteressierte Publikum nach den Konzerten im Kirchgarten mit
den Musikerinnen und Musikern bei einem Getränk ins Gespräch kommen.
Der Eintritt zu den Konzerten kostet jeweils zehn Euro. Schüler,
Studenten, Schwerbehinderte zahlen bei Vorlage des Ausweises nur
fünf Euro. Tiina Marjatta Henke beantwortet Rückfragen und hat mehr
Infos zu den Konzerten (tiinamarjatta@posteo.de).

Akkordeonorchester 1980 Dinslaken/Oberhausen (Foto:
https://www.akkdinob1980.de/)

Öffentliche Schulden im 1. Quartal 2025 um 0,6 % höher
als 2024 - Schuldenstand steigt um 14,3 Milliarden Euro auf 2 523,3
Milliarden Euro
Der Öffentliche Gesamthaushalt war beim
nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des 1. Quartals 2025 mit 2 523,3
Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, stieg die
öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem Jahresende 2024 um 0,6
% oder 14,3 Milliarden Euro.
Zum Öffentlichen Gesamthaushalt
zählen die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und
Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung einschließlich aller
Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören
Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische
Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.
Schulden des Bundes nahezu unverändert
Die Schulden des Bundes waren zum Ende des 1. Quartals 2025
lediglich 0,7 Milliarden Euro (0,0 %) höher als Ende 2024. Die
Verschuldung für das "Sondervermögen Bundeswehr“ ist dabei
überdimensional um 12,8 % oder 2,9 Milliarden Euro auf nunmehr 25,9
Milliarden Euro gestiegen.
Schulden der Länder erhöhen sich
um 1,4 %
Die Länder waren zum Ende des 1. Quartals 2025 mit
615,4 Milliarden Euro verschuldet, was einem Anstieg um
8,6 Milliarden Euro (+1,4 %) gegenüber dem Jahresende 2024
entspricht. Am stärksten stiegen die Schulden gegenüber dem
Jahresende 2024 prozentual in Sachsen (+16,5 %), Sachsen-Anhalt
(+11,2 %) und Niedersachsen (+6,8 %).
In Sachsen ist der
Anstieg auf einen erhöhten Aufnahmebedarf und anstehende
Refinanzierungen von Landesschatzanweisungen zurückzuführen. In
Niedersachsen ergibt sich aufgrund buchhalterischer Arbeiten im
Rahmen des Jahresabschlusses im 1. Quartal ein Anstieg der
Verschuldung, der im Laufe des Jahres durch planmäßige Tilgungen
wieder reduziert wird.
Der stärkste Schuldenrückgang
gegenüber dem Jahresende 2024 wurde für Rheinland-Pfalz mit -2,6 %
ermittelt. Hier waren übliche unterjährige Liquiditätsentwicklungen
für den Rückgang verantwortlich. Auch in Brandenburg (-0,8 %) und
Mecklenburg-Vorpommern (-0,8 %) sind die Schulden prozentual stärker
gesunken.
Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände
wachsen um 3,0 %
Auch bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden
nahm die Verschuldung zum Ende des 1. Quartals 2025 gegenüber dem
Jahresende 2024 zu. Sie stieg um 5,0 Milliarden Euro (+3,0 %) auf
174,4 Milliarden Euro. D
en höchsten prozentualen
Schuldenanstieg gegenüber dem Jahresende 2024 wiesen dabei die
Gemeinden und Gemeindeverbände in Schleswig-Holstein (+6,0 %) auf,
gefolgt von Bayern (+5,2 %) und Niedersachsen (+4,9 %). Einen
Rückgang der Verschuldung gab es lediglich in Thüringen (-0,1 %).
Die Verschuldung der Sozialversicherung sank im 1. Quartal 2025
gegenüber dem Jahresende 2024 um 0,5 Millionen Euro (-1,3 %) auf
38,2 Millionen Euro.
474 700 untergebrachte
wohnungslose Personen Ende Januar 2025 in Deutschland
•
41 % der untergebrachten wohnungslosen Personen jünger als 25 Jahre
• 29 % kommen aus der Ukraine • Nach Haushaltskonstellation
bilden Paare mit Kindern mit gut 34 % die größte Gruppe unter den
untergebrachten wohnungslosen Personen
Zum Stichtag 31.
Januar 2025 waren in Deutschland nach den Meldungen von Kommunen und
Einrichtungen rund 474 700 Personen wegen Wohnungslosigkeit
untergebracht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
hat sich damit die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 8 % erhöht (2024:
439 500). Der Anstieg ist vermutlich auf Verbesserungen der
Datenmeldungen im vierten Jahr seit der Einführung der Statistik
zurückzuführen.

Die Statistik erfasst wohnungslose Personen, die in der Nacht vom
31. Januar zum 1. Februar 2025 beispielsweise in überlassenem
Wohnraum, Sammelunterkünften oder Einrichtungen für Wohnungslose
untergebracht waren. Obdachlose Personen, die ohne jede Unterkunft
auf der Straße leben sowie Formen von verdeckter Wohnungslosigkeit
(zum Beispiel bei Bekannten oder Angehörigen untergekommene
Personen) werden nicht in der Statistik berücksichtigt, sind aber
Teil der begleitenden
Wohnungslosenberichterstattung, die alle zwei Jahre vom
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
durchgeführt wird.
137 800 untergebrachte Personen kommen
aus der Ukraine Schutzsuchende aus der Ukraine stellen zwar nach wie
vor die größte Gruppe (29 %) innerhalb der Statistik dar, jedoch
fiel der Anstieg nicht so stark aus wie in den vergangenen Jahren.
Zum Stichtag 31. Januar 2025 wurden 137 800 geflüchtete Ukrainerinnen
und Ukrainer in der Statistik erfasst (2024: 136 900).
Insgesamt wurden 409 000 Personen mit ausländischer
Staatsangehörigkeit gemeldet (2024: 377 900), ihr Anteil an allen
untergebrachten wohnungslosen Personen liegt wie im Vorjahr bei 86 %
(2024: 86 %). Der Anteil von Personen mit deutscher
Staatsangehörigkeit liegt mit 65 700 Personen (2024: 61 500)
weiterhin bei rund 14 %.
Untergebrachte Wohnungslose sind
zu 41 % unter 25 Jahre alt und mehrheitlich Männer
41 % der
gemeldeten Personen waren jünger als 25 Jahre (2024: 40 %). Der
Anteil der Personen im Alter ab 65 Jahren blieb mit rund 5 %
unverändert gegenüber dem Vorjahr. Im Durchschnitt waren die am
Stichtag 31. Januar 2025 untergebrachten Personen 31 Jahre alt. 56 %
der untergebrachten wohnungslosen Personen waren Männer und rund
42 % Frauen (2024: 55 % Männer und 43 % Frauen).
Für 2 % der
Fälle wurde das Geschlecht mit "unbekannt“ angegeben. Paare mit
Kindern und Alleinstehende am häufigsten untergebracht Die
wohnungslosen Personen sind in verschiedenen Haushalts-
beziehungsweise Familienkonstellationen untergebracht. Personen in
Paarhaushalten mit Kindern bildeten mit 163 400 Personen (gut 34 %)
die größte Gruppe.
Fast ebenso viele Personen (159 800 oder
knapp 34 %) waren alleinstehend, knapp 17 % oder 79 000 Personen
waren in Alleinerziehenden-Haushalten, 7 % oder 33 400 Personen in
sonstigen Mehrpersonenhaushalten und 4 % beziehungsweise 17 300
Personen in Paarhaushalten ohne Kinder untergebracht. Bei 21 800
Personen (4 %) war der Haushaltstyp unbekannt.
117 900
untergebrachte Wohnungslose in Nordrhein-Westfalen
Im
Bundesländervergleich waren im bevölkerungsreichsten Land
Nordrhein-Westfalen mit 117 900 Personen die meisten Personen wegen
Wohnungslosigkeit untergebracht, gefolgt von Baden-Württemberg mit
94 600 Personen und Berlin mit 53 600 Personen. Am wenigsten
untergebrachte Wohnungslose wurden in Thüringen (3 000),
Sachsen-Anhalt (1 200) und Mecklenburg-Vorpommern (700 Personen)
gemeldet.