






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 28. Kalenderwoche:
10. Juli
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Freitag, 11. Juli 2025
Stadt Duisburg schafft Elternbeiträge im Offenen Ganztag ab
– ein Schritt für mehr Bildungsgerechtigkeit
Die Stadt Duisburg geht einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung
Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit: Ab dem 1. August 2025
entfallen die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern im
Offenen Ganztag vollständig. Lediglich die Kosten für die
Mittagsverpflegung bleiben bestehen. Bereits in den vergangenen
Jahren wurden die Beiträge schrittweise gesenkt – nun folgt die
komplette Kappung.
„Jedes Kind verdient die gleichen Chancen
– unabhängig vom Einkommen der Eltern. Der vollständige Wegfall der
Beiträge ist ein starkes Signal für Familienfreundlichkeit und
gerechte Teilhabe in unserer Stadt“, betont Oberbürgermeister Sören
Link.
Mit dieser Entscheidung wird der Ratsbeschluss aus dem
Jahr 2022 abschließend umgesetzt. Ein zentrales Ziel der Duisburger
Bildungspolitik wird damit Realität. Die Stadt entlastet Familien
nicht nur finanziell, sondern bekräftigt zugleich ihr langfristiges
Engagement für faire Bildungschancen für alle Kinder.

Eröffnung des Erweiterungsneubaus der GGS Mevissenstraße. Der
zweigeschossige Anbau bietet moderne Funktionsräume sowie eine Mensa
mit neuer Küche und ist ein wichtiger Bestandteil des
Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Schüler zeigen OB Sören Link das
neue Klettergerüst auf dem Schulhof. Foto: Tanja Pickartz / Stadt
Duisburg
„Duisburg lernt Schwimmen“ -
Erfolgreicher Abschluss der ersten kostenlosen Schwimmkurse für
Grundschulkinder
Mit mehr als 50 durchgeführten
Schwimmkursen und zahlreichen Seepferdchen-Anwärterinnen und
-Anwärtern geht die erste Staffel des Projekts „Duisburg lernt
Schwimmen“ erfolgreich zu Ende. Seit März hatten Duisburger
Grundschulkinder an Wochenenden die Möglichkeit, in städtischen
Schwimmbädern unter professioneller Anleitung das Schwimmen zu
erlernen.
Die Kurse richteten sich an Dritt- und
Viertklässlerinnen und -klässler, die bislang nicht oder nur
unzureichend schwimmen konnten. Eine Gruppe umfasste bis zu zehn
Kinder. Qualifizierte Fachkräfte vermittelten die Grundlagen vom
Gleiten über das Tauchen bis hin zu den ersten sicheren
Schwimmzügen.
Zum Abschluss der ersten Reihe stehen zwei
Seepferdchen-Prüfungen im Hallenbad Neudorf an: die erste am
gestrigen Donnerstag, die zweite folgt am kommenden Samstag.

v.rechts: Marc Rüdesheim, stellvertretender Betriebsleiter von
DuisburgSport, Marcel Groß, Geschäftsführer der Sparkassenstiftung
und Johannes Michels, Bereichsleiter Schulsport bei DuisburgSport
geben die Seepferdchenurkunden an erfolgreiche Schwimmschüler aus.
Erfolgreicher Abschluss der ersten kostenlosen Schwimmkurse für
Grundschulkinder. „Duisburg lernt Schwimmen“ ist eine gemeinsame
Initiative von DuisburgSport und dem Stadtsportbund Duisburg,
gefördert von der Sportstiftung der Sparkasse Duisburg mit jährlich
100.000 Euro. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
Oberbürgermeister Sören Link betont die Bedeutung des Projekts:
„Jedes Kind sollte möglichst früh Schwimmen lernen – das schafft ein
sicheres und gutes Gefühl im Wasser. Daher freue ich mich sehr für
jedes Kind, das jetzt zu Recht stolz auf sich ist, weil es das
Seepferdchen geschafft hat.“ Neben den Familien und Trainern waren
gestern auch Projektverantwortliche dabei, um zu motivieren, zu
unterstützen und das Anliegen des Projekts nochmals sichtbar zu
machen.
„Wenn ein Kind zum ersten Mal vom Beckenrand springt
oder stolz sein Abzeichen in der Hand hält, dann zeigt das, worum es
hier geht“, sagt Marc Rüdesheim, stellvertretender Betriebsleiter
von DuisburgSport. „Schwimmenlernen schafft Selbstvertrauen,
eröffnet Teilhabe und ist eine Fähigkeit, die Sicherheit gibt.“
Ein starker Partner in dieser Zusammenarbeit ist die
Sportstiftung der Sparkasse Duisburg, die das Projekt jährlich mit
100.000 Euro fördert. Auch Geschäftsführer Marcel Groß war vor Ort:
„Das ist eines unserer Herzensprojekte. Wir unterstützen es, weil es
auf eine Lücke reagiert, die viele längst kennen: die abnehmende
Schwimmfähigkeit von Kindern – nicht nur in Duisburg, sondern
bundesweit. Hier zeigen wir, wie verschiedene Akteure gemeinsam
Verantwortung übernehmen und etwas bewegen.“
Nach den
Sommerferien startet die zweite Kursreihe. Insgesamt erreicht das
Projekt damit rund 1.000 Kinder. Das entspricht etwa 20 Prozent der
Kinder, die jedes Jahr in Duisburg die Grundschule verlassen und zur
weiterführenden Schule wechseln. Als ergänzendes Angebot erhalten
alle Duisburger Grundschulkinder in den Sommerferien fünf kostenlose
Eintrittsgutscheine für die städtischen Schwimmbäder. Parallel läuft
ein Malwettbewerb zu den Baderegeln.
Zu gewinnen gibt es zehn
„Goldene Schwimmbadtickets“ mit einem Jahr freiem Eintritt und
kostenfreie Abzeichenprüfungen.
Hintergrund zum Projekt:
„Duisburg lernt Schwimmen“ ist eine gemeinsame Initiative von
DuisburgSport und dem Stadtsportbund Duisburg, gefördert von der
Sportstiftung der Sparkasse Duisburg mit jährlich 100.000 Euro.
Im Zentrum stehen kostenlose Schwimmkurse für Grundschulkinder,
bei denen der Stadtsportbund Duisburg die Organisation und
Abwicklung übernimmt und dabei auf die Unterstützung durch
Übungsleiter aus Duisburger Schwimmvereinen zurückgreift. „In diesem
Projekt zeigt sich wieder das große Engagement der Duisburger
Sportvereine zur Stärkung des Kinder- und Jugendsports“, sagt
Christoph Gehrt-Butry, stellvertretender Geschäftsführer des
Stadtsportbundes Duisburg.

Erfolgreicher Abschluss der ersten kostenlosen Schwimmkurse für
Grundschulkinder. „Duisburg lernt Schwimmen“ ist eine gemeinsame
Initiative von DuisburgSport und dem Stadtsportbund Duisburg,
gefördert von der Sportstiftung der Sparkasse Duisburg mit jährlich
100.000 Euro. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
Für rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler beginnen
nach den Zeugnisvergaben die Sommerferien
Zeugnistelefone der Bezirksregierungen sind wie gewohnt erreichbar
Am Freitag, 11. Juli 2025, endet das Schuljahr in
Nordrhein-Westfalen, die Sommerferien beginnen. Rund 2,5 Millionen
Schülerinnen und Schüler zwischen Aachen und Bielefeld starten dann
hoffentlich mit einem guten Gefühl in diese Zeit zum Durchatmen. Die
Ferien finden am Mittwoch, 27. August 2025, ihr Ende, wenn das neue
Schuljahr eingeläutet wird.
„Ich danke den vielen Menschen,
die im nun endenden Schuljahr mit großem Engagement dazu beigetragen
haben, dass unsere Schulen nicht nur Orte des Lehrens und Lernens
sind, sondern vor allem auch Orte, an denen sich alle wohlfühlen
können und an denen Werte gelebt werden. Wir arbeiten kontinuierlich
daran, dass sich die Bedingungen an unseren nordrhein-westfälischen
Schulen weiter verbessern, dass die Personalzahlen weiter steigen
und noch mehr Wert auf die Förderung der Basiskompetenzen von
Schülerinnen und Schülern gelegt wird, dass die Demokratiekompetenz
von Kindern und Jugendlichen gefördert oder die datengestützte
Qualitätsentwicklung vorangetrieben wird. Jetzt aber ist erst einmal
unterrichtsfreie Zeit – und ich wünsche allen am Schulleben
Beteiligten und natürlich vor allem auch den Schülerinnen und
Schülern erholsame und entspannte Wochen!“, sagt Schulministerin
Dorothee Feller.
Bei Beratungsbedarf und Fragen zu den
Zeugnissen und der Notengebung, stehen wie jedes Jahr die
Zeugnistelefone der Bezirksregierungen vertrauensvoll zur Verfügung.
Zeugnistelefon der Bezirksregierung Düsseldorf:
Telefonnummer:
0211 4754002
Freitag, 11. Juli 2025, von 10.00 bis 12.00 Uhr und
von 13.00 bis 15.00 Uhr
Montag, 14. Juli 2025, von 10.00 bis
12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag, 15. Juli 2025,
von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr
A
59: Sperrungen im Bereich der Berliner Brücke während der
Sommerferien
In den letzten vier Wochen der
Sommerferien 2025 führt die Autobahn GmbH des Bundes (AdB)
umfangreiche Sanierungsarbeiten an der A-59-Brücke über die Ruhr und
den Hafenbereich durch („Berliner Brücke“). Aus diesem Grund wird
die A 59 zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Meiderich und dem
Autobahnkreuz Duisburg wechselseitig in beiden Fahrtrichtungen
vollständig gesperrt.
Zunächst wird die Autobahnbrücke in
südliche Fahrtrichtung vom Dienstag, 29. Juli (5 Uhr), bis zum
Dienstag,12. August (20 Uhr), gesperrt. Die Sperrung in Richtung
Düsseldorf beginnt bereits ab dem Autobahnkreuz DuisburgNord. Daran
anschließend sperrt die AdB die Gegenrichtung (Fahrtrichtung
Dinslaken) vom Dienstag, 12. August (20 Uhr), bis zum Dienstag, 26.
August (5 Uhr).
Die Stadt Duisburg bittet darum, den
ausgeschilderten Umleitungen zu folgen und den Bereich großräumig
über das umliegende Autobahnnetz mit den Autobahnen A 3, A 40, A 42
sowie A 57 zu umfahren. Innerstädtische Ausweichrouten sind nicht
vorgesehen. Um die Belastung des städtischen Straßennetzes so gering
wie möglich zu halten, sollten alle Verkehrsteilnehmer diese
Ausweichrouten befolgen.
Stauprognose 11.-13. Juli: Sommerreiseverkehr nimmt deutlich zu
ADAC erwartet lange Staus am Wochenende / NRW startet in die Ferien

©imago images/Steinsiek.ch
Der Sommerreiseverkehr wird am
kommenden Wochenende spürbar zunehmen. Insbesondere der Ferienbeginn
in Nordrhein-Westfalen sowie im Norden der Niederlande sorgt für
volle Straßen und teils kilometerlange Staus.
Zusätzlich
rollt eine zweite Reisewelle aus Bremen, Hessen, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie aus dem Süden der Niederlande
an. Auch viele Urlauberinnen und Urlauber aus Nordeuropa sind auf
dem Weg in den Süden. Tagesausflügler und Kurzentschlossene
verschärfen die Lage weiter, vor allem bei schönem Wetter.
Die größten Nadelöhre sind und bleiben Baustellen. Aktuell zählt der
ADAC 1.194 Baustellen auf deutschen Autobahnen, von denen viele auch
während der Ferienzeit bestehen bleiben. Hinzu kommen am Wochenende
Vollsperrungen auf der A6 und der A8, die den Verkehrsfluss
zusätzlich behindern.
Besonders staugefährdet sind folgende
Autobahnen in beiden Richtungen:
A1 Köln – Dortmund – Münster –
Osnabrück – Bremen – Hamburg
Kölner Ring (A1/A3/A4)
A2
Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg
A3 Köln –
Frankfurt – Nürnberg – Passau
A5 Frankfurt – Heidelberg –
Karlsruhe – Basel
A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
A7
Hamburg – Füssen/Reutte
A8 Karlsruhe – Stuttgart – München –
Salzburg
A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München
A24 Hamburg –
Berlin
A31 Bottrop – Leer
A45 Hagen – Gießen – Aschaffenburg
A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen
A93 Inntaldreieck –
Kufstein
A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
A99 Umfahrung
München
Die verkehrsreichsten Zeiten sind Freitagnachmittag,
Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Wer flexibel ist, sollte
besser auf die Wochentage Montag bis Donnerstag ausweichen,
idealerweise außerhalb der Berufsverkehrszeiten.
Zur
Entlastung des Ferienverkehrs gilt vom 1. Juli bis zum 31. August an
allen Samstagen ein Lkw-Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen
zwischen 7 und 20 Uhr auf besonders belasteten Strecken.
Auch
im benachbarten Ausland drohen teils erhebliche Verzögerungen. In
Österreich ist vor allem die Brennerautobahn betroffen. Dort sorgen
umfangreiche Bauarbeiten an der Luegbrücke trotz zweispurigem
Verkehr insbesondere am Wochenende für erhebliche Behinderungen.
Zudem gelten in Tirol Abfahrtssperren für den überregionalen
Durchgangsverkehr auf der Inntalautobahn (A12) sowie auf der
Fernpass-Route.
Zusätzliche Verzögerungen drohen durch
verschärfte Grenzkontrollen, vor allem an den Übergängen Suben (A3),
Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93). Auch bei der Ausreise aus
Deutschland werden teilweise Kontrollen durchgeführt, etwa in
Richtung Dänemark, Niederlande, Frankreich und Polen. Für Fahrten
nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sollten
Autofahrende ebenfalls längere Wartezeiten einkalkulieren.
Der ADAC empfiehlt allen Reisenden, sich vor Fahrtantritt über die
aktuelle Verkehrslage zu informieren und ausreichend Pausen
einzuplanen. Wer unterwegs auf dem Laufenden bleiben möchte, kann
die ADAC Drive App nutzen. Sie zeigt nicht nur aktuelle Spritpreise,
sondern auch Staus, Baustellen und freie Ladestationen in Echtzeit.
Sportveranstaltung: Busse müssen vom Linienweg abweichen
Von Freitag, 11. Juli, Betriebsbeginn, bis
voraussichtlich Mittwoch, 30. Juli, müssen die Busse der Linien 928
und 933 der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) in
Duisburg-Stadtmitte eine Umleitung fahren. Grund hierfür ist eine
Sportveranstaltung im Rahmen der FISU University Games 2025 auf dem
Opernplatz.
Linie 928 (Kurzläufer): In Fahrtrichtung
Bissingheim fahren die Busse ab der Haltestelle „Kuhtor“ eine
örtliche Umleitung über die Poststraße, Oberstraße, Stapeltor,
Kardinal-Galen-Straße, Oranienstraße und Saarstraße zur
Verknüpfungshalle. Ab da gilt der normale Linienweg. Die
Haltestellen „Schäferturm“ und „Stadttheater“ entfallen. Die DVG
bittet die Fahrgäste die Haltestellen „Schillerplatz“ auf der
Kardinal-Galen-Straße und „Lehmbruck Museum“ auf der
Friedrich-Wilhelm-Straße zu nutzen.
Linie 933: In
Fahrtrichtung Rheindeich fahren die Busse ab der Haltestelle
„Duisburg Hbf. Bussteig 6“ eine örtliche Umleitung über die
Königstraße, Mercatorstraße, Friedrich-Wilhelm-Straße,
Friedrich-Wilhelm-Platz, Steinsche Gasse und Schwanenstraße. Ab da
gilt der normale Linienweg. Die Haltestellen „Schäferturm“ und
„Stadttheater“ entfallen. Die DVG bittet die Fahrgäste die
Haltestellen „Friedrich-Wilhelm-Platz“ und „Lehmbruck Museum“ auf
der Friedrich-Wilhelm-Straße zu nutzen. In Gegenrichtung wird die
Umleitung sinngemäß gefahren.
Trotz leichtem Rückgang bleibt die Zahl der im
Straßenverkehr Getöteten hoch.
Der TÜV-Verband
mahnt sichere Infrastruktur, strengere Kontrollen und bessere
Prävention an.
Das Statistische Bundesamt hat heute die
Unfallstatistik für das Jahr 2024 veröffentlicht. Die endgültigen
Zahlen kommentiert Fani Zaneta, Referentin für Fahrerlaubnis,
Fahreignung und Verkehrssicherheit beim TÜV-Verband:
„Täglich
sterben acht Menschen im deutschen Straßenverkehr. Im Jahr 2024
waren es insgesamt 2.770. Das sind zwar rund 2,4 Prozent weniger als
im Vorjahr, aber noch immer deutlich zu viele, um von einer
Trendwende zu sprechen. Der Straßenverkehr in Deutschland ist für
viele Menschen noch immer zu gefährlich. Sicherheit im
Straßenverkehr darf kein Zufall sein, sondern braucht entschlossenes
politisches Handeln.“
Schutz für die Schwächsten im Verkehr
bleibt unzureichend
„Besonders groß ist der Handlungsbedarf bei
der Sicherheit schwächerer Verkehrsteilnehmer:innen. Fast zwei
Drittel der innerorts Getöteten waren 2024 zu Fuß oder mit dem
Fahrrad unterwegs. Im Schnitt wird alle 19 Minuten ein Kind bei
einem Verkehrsunfall verletzt. Diese Zahlen belegen, dass der
Verkehrsraum in vielen Städten noch nicht sicher genug ist.
Eine moderne und verantwortungsvolle Verkehrspolitik muss den Schutz
von Kindern, älteren Menschen, Radfahrenden und Fußgänger:innen in
den Mittelpunkt stellen. Sichere Rad- und Fußwege, übersichtliche
Kreuzungen und eine gerechtere Verteilung des Verkehrsraums sind
dafür die Grundlage. Städte und Kommunen brauchen die notwendigen
Spielräume, um Gefahrenstellen zu entschärfen und sichere
Verkehrswege zu schaffen.“
Verkehrssicherheit braucht sichere
Infrastruktur und konsequente Kontrollen
„Der Straßenverkehr muss
so gestaltet werden, dass Fehler nicht tödlich enden. Neben
baulichen Maßnahmen braucht es eine konsequente Überwachung von
Verkehrsregeln. Allein 2024 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt mehr
als 2,4 Millionen Tempoverstöße registriert.
Geschwindigkeitsverstöße waren im Jahr 2024 die Hauptursache für
Verkehrsunfälle. Trotzdem fehlt es an spürbaren Konsequenzen und
vielerorts an Kontrollen.
Mehr Polizeipräsenz im
Straßenverkehr, höhere Bußgelder und klare Regeln sind dringend
notwendig, um Geschwindigkeitsverstöße, Alkoholfahrten und anderes
Fehlverhalten wirksam einzudämmen. Insbesondere die Zahl der
Alkoholunfälle zeigt, dass bestehende Regelungen nicht ausreichen:
Fast 200 Menschen starben 2024 bei Alkoholunfällen. Wer
alkoholisiert ein Fahrzeug lenkt, gefährdet sich und andere. Die
Grenze für eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung sollte daher
unbedingt von derzeit 1,6 auf 1,1 Promille gesenkt werden.“
Altersgerechte Mobilität sicher gestalten
„Der demografische
Wandel stellt den Straßenverkehr vor neue Herausforderungen. Mit
zunehmendem Alter steigt das Unfallrisiko, oft aufgrund
nachlassender Reaktionsfähigkeit oder Fehleinschätzungen im
Straßenverkehr. 40 Prozent aller Getöteten waren im vergangenen Jahr
über 65 Jahre alt. Die meisten von ihnen kamen als Pkw-Insass:innen
ums Leben (434 Getötete). Um diese Opferzahlen zu senken, sind
Rückmeldefahrten ab 75 Jahren ein wichtiges Instrument. Sie
unterstützen ältere Autofahrer:innen bei der sicheren
Verkehrsteilnahme und helfen dabei die eigene Fahrkompetenz
realistisch einzuschätzen. So bleibt individuelle Mobilität
erhalten, ohne die Sicherheit im Straßenverkehr zu gefährden.“
Auch im Rad- und Fußverkehr ist die Zahl der Opfer über 65
Jahren dramatisch: 135 Senior:innen starben mit dem Pedelec, 150 mit
dem Fahrrad ohne Motor. Neben der persönlichen Verantwortung ist
nach Ansicht des TÜV-Verbands eine altersgerechte Infrastruktur
notwendig: gut erkennbare Fahrspuren, sichere Querungen und
geschützte Radwege helfen, Unfälle von vornherein zu vermeiden.
Methodik-Hinweis: Grundlage der Angaben sind endgültigen Daten
des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2024. Die Zahlen sind
abrufbar unter: www.destatis.de
Grundlage der Angaben zu
Verkehrsauffälligkeiten, wie Geschwindigkeitsverstößen sind Daten
des Kraftfahrt-Bundesamtes für das Jahr 2024. Sie sind abrufbar
unter: www.kba.de
Verleihung der Ehrennadel der Bezirksvertretung Walsum
Für ihr besonderes Engagement um den Stadtbezirk Walsum haben Alfred
Walzer und Thomas Paschke gestern die Ehrennadel der
Bezirksvertretung Walsum für ihr langjähriges Engagement und ihre
gesellschaftlichen Verdienste im Bezirk erhalten. Oberbürgermeister
Sören Link betonte die Wichtigkeit des Ehrenamts für die Stadt und
stellte heraus, dass die Geehrten lebendige Beispiele für die Stärke
der Gemeinschaft und das Potential des ehrenamtlichen Engagements im
Stadtbezirk Walsum sind.
„Mit der Verleihung der Walsumer
Ehrennadel möchte die Bezirksvertretung Walsum nicht nur die
persönlichen Verdienste der zu Ehrenden würdigen, sondern auch ein
Zeichen dafür setzen, dass unser Miteinander von Menschen lebt, die
bereit sind, mehr zu tun als das Notwendige“, sagte
Bezirksbürgermeister Georg Salomon.
Die Bezirksvertretung
Walsum verleiht jährlich Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich
durch ihr Engagement um den Stadtbezirk Walsum verdient gemacht
haben, ihre Ehrennadel: Alfred Walzer engagierte sich über viele
Jahre ehrenamtlich in der damaligen CityWerbegemeinschaft Walsum, wo
er zahlreiche Stadtteilaktivitäten mitorganisierte und begleitete.
Viele Bürgerinnen und Bürger werden sich noch an
Veranstaltungen wie Blumenmarkt, Maibaumaufstellung, Walsumer
Kaufmanns- und Handwerkertage, Walsumer City-Tage oder
Weihnachtsaktionen erinnern. Noch heute unterstützt er aktiv die
Walsumer Stadtteilfeste. Als Vorsitzender des Handelsverbands hat
Alfred Walzer die Interessen des lokalen Handels vertreten und zur
wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitragen.
Außerdem
war er als Mitglied der IHK bisher in verschiedenen Ausschüssen
tätig, wobei hierbei die Schwerpunkte auf Handel und Ausbildung
lagen. Mit seinem „ServiceCenter Walzer“ in Walsum wurden zahlreiche
qualifizierte und sichere Arbeitsplätze in Walsum geschaffen. Im
nächsten Jahr wird das 50-jährige Firmenjubiläum gefeiert.
Thomas Paschke ist in Walsum aufgewachsen. Der selbstständige
Tischlermeister und Bestatter führt gemeinsam mit seiner Familie ein
seit 1838 bestehendes Unternehmen. Er engagiert sich seit
Jahrzehnten ehrenamtlich bei Walsumer Vereinen sowie caritativer
Projekte. Neben der aktiven Unterstützung des Heimatvereins, der
Walsumer Stadtteilfeste und als Vorsitzender der
Leistungsgemeinschaft Walsum e. V. (LG Walsum) unterstützte er vor
allem Kinder- und Seniorenfreizeiten und war zehn Jahre Mitglied der
Bezirksvertretung. 
Alfred Walzer und Thomas Paschke werden mit der Ehrennadel der
Bezirksvertretung Walsum ausgezeichnet. Bezirksbürgermeister Georg
Salomon (links) und Oberbürgermeister Sören Link (3. v.l.)
gratulieren. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
Stadt Duisburg verleiht Mercatorplakette an Axel Kober
Die Stadt Duisburg ehrt in diesem Jahr den renommierten Dirigenten
Axel Kober mit der Mercatorplakette. Die Auszeichnung würdigt sein
langjähriges und herausragendes Engagement für das kulturelle Leben
der Stadt – insbesondere seine Verdienste als Generalmusikdirektor
der Deutschen Oper am Rhein und der Duisburger Philharmoniker.

Axel Kober und Oberbürgermeister Sören Link - Verleihung der
Mercatorplakette und Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Duisburg -
Foto Andre Symann
„Axel Kober war mit seinem unermüdlichen
Einsatz für die Duisburger Musikszene und seiner künstlerischen
Klasse ein Glücksfall für unsere Stadt. Ihm gebührt unser aller
Respekt für seine Verdienste und seine schöpferische Kraft. Die
Mercatorplakette ist Ausdruck unserer hohen Wertschätzung“, würdigt
Oberbürgermeister Sören Link den Preisträger.
Die feierliche
Übergabe der Mercatorplakette an Kober fand am Mittwoch, 9. Juli, im
Rahmen des 12. Philharmonischen Konzertes in der Duisburger
Mercatorhalle statt. Verbunden wurde die feierliche Übergabe mit
einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Duisburg.
Axel
Kober wirkte seit 2009 als Generalmusikdirektor der Deutschen Oper
am Rhein und übernahm 2019 zusätzlich das Amt des GMD der Duisburger
Philharmoniker. Unter seiner künstlerischen Leitung entwickelte sich
Duisburg zu einem kulturellen Anziehungspunkt mit internationaler
Strahlkraft.
Die Mercatorplakette ist eine der bedeutendsten
Ehrungen, die die Stadt Duisburg zu vergeben hat. Sie wird an
Persönlichkeiten verliehen, die in den Bereichen Kunst und Kultur,
Wissenschaft, Heimat- und Brauchtumspflege, aber auch in anderen
gesellschaftlichen Feldern Herausragendes für Duisburg geleistet und
damit Verdienste erworben haben, die weit über Duisburg
hinauswirken.
Zu den bisherigen Trägerinnen und Trägern
gehören unter anderem renommierte Persönlichkeiten wie
Generalmusikdirektor Giordano Bellincampi, Professor Dr. Ekkehard
Schulz (ehemaliger Vorstandvorsitzender Thyssenkrupp) und der
mittlerweile verstorbene Kulturdezernent Dr. Konrad Schilling.
Die Mercatorplakette hat die Form einer kreisrunden Silberplatte
mit einem Durchmesser von 14 Zentimetern. Die Vorderseite zeigt das
„Organum directorium“ aus Gerhard Mercators Weltkarte von 1569. Auf
dem Rande stehen in erhabener Schrift die Worte „Gerhardus Mercator
1512-1594“. Die Rückseite zeigt das stilisierte Wappen der Stadt
Duisburg, eingefasst mit den Worten: „Für besondere Verdienste. Die
Stadt Duisburg“.
Bürgerfest „Rund um das Bezirksamt Süd“
Im Süden wird gefeiert – und zwar am Freitag, 11. Juli, ab 18
Uhr auf dem Vorplatz der Bezirksverwaltungsstelle Süd,
Sittardsberger Allee 14, in Duisburg-Buchholz.
Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske lädt im Namen der gesamten
Bezirksvertretung Süd Bürgerinnen und Bürger zum Fest „Rund um das
Bezirksamt Süd“ ein. Los geht der gesellige Abend mit dem
„Fassbieranstich“ durch die Bezirksbürgermeisterin.
Für
musikalische Unterhaltung sorgen die „MelodyDancing-Band“ und die
„Ruhrpott-Guggis“, die um 19 Uhr ihren Gastauftritt haben. Für
ausreichend Verpflegung ist an Imbiss- und Getränkestände gesorgt.
Die Bezirksvertretung Süd wird auch in diesem Jahr wieder einen
Sektstand betreiben.
Der Erlös kommt einem wohltätigen Zweck
zugute. Für weitere Informationen steht als Ansprechpartnerin Julia
Kirschbaum von der Bezirksverwaltung Süd zur Verfügung: Tel.
0203-2837121 oder Kultur.sued@stadt-duisburg.de
Krimispiel in der Bibliothek fordert detektivisches
Gespür
Ein toter Häftling gibt Rätsel auf. Die
Mitinsassen schweigen, das Gefängnispersonal wirkt alles andere als
vertrauenswürdig – und die Wahrheit scheint tief vergraben zu sein.
Inmitten widersprüchlicher Aussagen und geheimnisvoller Hinweise
bittet der Kommissar um Unterstützung. Doch wer ist der oder die
Täter oder die Täterin? Und gelingt es rechtzeitig, das Verbrechen
aufzuklären?
Die Zentralbibliothek lädt Hobbydetektivinnen
und -detektive ab 14 Jahren am Freitag, 11. Juli, von 16 bis 18 Uhr
im Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in der Innenstadt zu dem
spannenden Krimispiel „Ein perfekter Plan“ ein, bei dem Teamgeist,
Kombinationsgabe und ein scharfer Blick für Details gefragt sind.
Ein toter Häftling gibt Rätsel auf. Die Mitinsassen schweigen, das
Gefängnispersonal wirkt alles andere als vertrauenswürdig – und die
Wahrheit scheint tief vergraben zu sein.
Inmitten
widersprüchlicher Aussagen und geheimnisvoller Hinweise bittet der
Kommissar um Unterstützung. Doch wer ist der oder die Täter oder die
Täterin? Und gelingt es rechtzeitig, das Verbrechen aufzuklären?
Zwei Ermittlerteams treten in einem Wettlauf gegen die Zeit
gegeneinander an.
Wer mitmachen möchte, meldet sich an und
wird dann einem Team zugeordnet. Das schnellste und cleverste
Ermittlerteam darf sich über eine kleine Überraschung freuen. Die
Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung ist online auf
www.stadtbibliothek-duisburg.de möglich.
EU-Methodik für CO2-armen Wasserstoff und
Kraftstoffe: Kommission legt delegierten Rechtsakt vor
Um die Entwicklung eines Wasserstoffmarktes in Europa zu
unterstützten, hat die Europäische Kommission einen delegierten
Rechtsakt zur Einführung einer umfassenden Methodik zu CO2-armen
Wasserstoff und Kraftstoffen veröffentlicht. EU-Energiekommissar Dan
Jørgensen erklärte: „Wasserstoff wird eine Schlüsselrolle bei der
Dekarbonisierung unserer Wirtschaft spielen. Mit einer pragmatischen
Definition von CO2-armem Wasserstoff, die den Energiemix aller
EU-Länder respektiert, bieten wir Investoren die notwendige
Sicherheit. Auf diese Weise unterstützen wir das Wachstum eines
Sektors, der sowohl für unsere Wettbewerbsfähigkeit als auch für
unsere Klimaziele von entscheidender Bedeutung ist.“
Wie im
Deal für eine saubere Industrie hervorgehoben, sind Rechtssicherheit
und Kohärenz von entscheidender Bedeutung, um Investitionen zu
fördern und es den Erzeugern zu ermöglichen, zu expandieren und
letztlich das Wachstum des Sektors zu beschleunigen. CO2-armer
Wasserstoff wird die Bemühungen um die Dekarbonisierung von Sektoren
unterstützen, in denen die Elektrifizierung derzeit keine
praktikable Option ist, wie der Luftverkehr, die Schifffahrt und
bestimmte industrielle Prozesse.
70 Prozent
Treibhausgaseinsparungen
Um als CO2-arm zu gelten, müssen
Wasserstoff und damit verbundene Kraftstoffe einen Schwellenwert von
70 Prozent für Treibhausgaseinsparungen im Vergleich zur Verwendung
fossiler Brennstoffe erreichen. Dies bedeutet, dass CO2-armer
Wasserstoff auf verschiedene Weise erzeugt werden kann,
beispielsweise mit Erdgas mit CO2-Abscheidung, -Nutzung und
-Speicherung (CCUS).
Die Methodik erkennt die Vielfalt des
Energiemixes in den Mitgliedstaaten an und bietet einen flexiblen
und pragmatischen Rahmen. In dem delegierten Rechtsakt wird nicht
der Anteil erneuerbarer Energien festgelegt, der für aus Strom
erzeugten Wasserstoff angerechnet werden kann. Die Kommission wird
diesen Aspekt bei der Überprüfung der der
Erneuerbare-Energien-Richtlinie anzugehen.
Konsultation zu
Kernenergie 2026
Mit Blick auf die Zukunft wird die Europäische
Kommission die Auswirkungen der Einführung alternativer Wege auf das
Energiesystem und die Emissionseinsparungen sowie die Notwendigkeit
der Aufrechterhaltung gleicher Wettbewerbsbedingungen bei der
Beschaffung von vollständig erneuerbarem Strom bewerten. Im Jahr
2026 wird sie eine öffentliche Konsultation zu einem Entwurf einer
Methodik für die Nutzung von Strombezugsverträgen für die
Kernenergie einleiten, um für mehr Klarheit bei der Erzeugung von
CO2-armem Wasserstoff aus direkten nuklearen Quellen zu sorgen.
Nächste Schritte
Der delegierte Rechtsakt wird nun dem
Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt, die zwei Monate Zeit
haben, um sie zu prüfen und die Vorschläge entweder anzunehmen oder
abzulehnen. Auf Antrag kann der Prüfungszeitraum um zwei Monate
verlängert werden. Das Parlament oder der Rat haben keine
Möglichkeit, die Vorschläge zu ändern.
Hintergrund
In der
Wasserstoff- und Gasmarktrichtlinie wird ein vollwertiger
Zertifizierungsrahmen für CO2-arme Kraftstoffe festgelegt, der die
in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie festgelegten Vorschriften für
erneuerbare Kraftstoffe ergänzt. Gemäß Artikel 9 der Richtlinie muss
die Kommission bis spätestens 5. August 2025 eine Methode zur
Bewertung der Emissionseinsparungen von CO2-armen Kraftstoffen
festlegen.
Die heutige Annahme folgt einem intensiven
Konsultationsprozess mit den wichtigsten Interessenträgern und den
Mitgliedstaaten. Ein erster Entwurf des delegierten Rechtsakts wurde
vom 27. September bis zum 25. Oktober 2024 zur Stellungnahme
veröffentlicht. Der delegierte Rechtsakt wurde anschließend in der
Sachverständigengruppe für erneuerbare und CO2-arme Kraftstoffe am
7. November 2024 und am 19. Mai 2025 zweimal mit Sachverständigen
der Mitgliedstaaten erörtert.
Beschäftigte sind in
Betrieben mit freiwilligen Frauenquoten egalitärer eingestellt
Freiwillige Frauenquoten verbessern nicht nur die Karrierechancen
von Frauen. Sie können auch ein Umdenken in der gesamten Belegschaft
bewirken, hin zu einem egalitäreren Verständnis von
Geschlechterrollen. Das zeigt eine aktuelle Studie von Forscherinnen
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der
Hans-Böckler-Stiftung und der Universität Bielefeld.*
Gleichstellung im Betrieb ist kein Selbstläufer. Zwar sind viele
Unternehmen bemüht, die Karrieremöglichkeiten für Frauen zu
verbessern – doch wie gut wirken solche Maßnahmen tatsächlich? Und
wie beeinflussen sie das Denken der Beschäftigten über
Geschlechterrollen? Dieser Frage sind die Sozialwissenschaftlerinnen
Dr. Eileen Peters vom WSI und Prof. Dr. Anja-Kristin Abendroth von
der Universität Bielefeld nachgegangen.
Ergebnis: In Betrieben
mit freiwilligen Frauenquoten sind die Beschäftigten egalitärer
eingestellt, was Vorstellungen über Geschlechterverhältnisse in der
Arbeitswelt betrifft. Für Mentoring-Programme lässt sich ein solcher
Zusammenhang nicht eindeutig nachweisen. Dies könnte auch daran
liegen, wie solche Programme in der Praxis umgesetzt werden.
Für ihre Analyse haben die Wissenschaftlerinnen einen Datensatz
ausgewertet, der im Rahmen eines Projekts an der Universität
Bielefeld in Kooperation mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) erhoben wurde. Ihre Analysen enthalten
Befragungsdaten von 2445 Arbeitnehmer*innen aus 82 Großbetrieben mit
mindestens 500 Beschäftigten.
Die Teilnehmenden wurden gefragt,
wie sie zu geschlechtsspezifischen Aspekten der Arbeitswelt stehen.
Konkret: Ob Männer und Frauen beide zum Haushaltseinkommen beitragen
sollten, ob ein Kind darunter leidet, wenn seine Mutter arbeitet,
oder ob es für alle besser ist, wenn nur die Männer arbeiten und die
Frauen zu Hause bleiben.
Laut der Studie vertreten
Beschäftigte in Betrieben mit freiwilligen Frauenquoten egalitärere
Ansichten als Beschäftigte an Arbeitsplätzen ohne eine solche
Maßnahme. Im Durchschnitt ist die Wahrscheinlichkeit, dass
Beschäftigte in Betrieben mit Frauenquoten traditionelle
geschlechtsspezifische Ideologien äußern, um 1,5 Prozentpunkte
geringer.
Sie stimmen mit einer um 3,8 Prozentpunkte höheren
Wahrscheinlichkeit der Aussage zu, dass sowohl Frauen als auch
Männer zum Haushaltseinkommen beitragen sollten. Außerdem
widersprachen sie mit einer um 9 Prozentpunkte höheren
Wahrscheinlichkeit der Aussage, dass nur die Männer im Erwerbsjob
arbeiten und die Frauen zu Hause bleiben sollten.
Zahlreiche
statistische Robustheitsanalysen sowie konsistente Befunde über
verschiedene Modellvarianten hinweg sprechen dafür, dass der
beobachtete Zusammenhang nicht zufällig ist, betont WSI-Expertin
Peters. Vieles deute darauf hin, dass die Quoten zur Herausbildung
egalitärer Einstellungen beitragen können – auch wenn sich ein
kausaler Effekt, also, dass Frauenquoten zu egalitären Einstellungen
führen und nicht umgekehrt, mit den vorliegenden Daten nicht
abschließend nachweisen lasse. Hierfür sei weitere Forschung nötig.
Eine mögliche Erklärung für den positiven Effekt ist, dass
Frauen durch die Quote neue Rollen und Karrieremöglichkeiten
kennenlernen, die sie zuvor für sich selbst ausgeschlossen hatten.
Wenn mehr Frauen in Führungspositionen gelangen, können sie als
Vorbilder dienen. Darüber hinaus signalisiert allein das
Vorhandensein einer Frauenquote, dass Gleichstellung ein
entscheidendes Ziel am Arbeitsplatz ist. So entsteht langfristig
eine Kultur, in der Frauen eher als gleichberechtigter Teil der
Belegschaft gesehen werden – sowohl von den Frauen selbst als auch
von den Männern.
„Mit freiwilligen Frauenquoten machen
Betriebe deutlich: Frauen sollen in Führung – und zwar jetzt. Das
verändert die Kultur im Unternehmen und setzt ein starkes Zeichen
für Gleichstellung“, so die Forscherinnen. Je alltäglicher weibliche
Führung wird, desto weniger wirken alte Klischees. So entsteht mit
der Zeit eine neue betriebliche Normalität.
Die Ergebnisse
für Mentoring-Programme sind weniger eindeutig. Dabei unterstützt
ein*e erfahrene*r Mentor*in bei der persönlichen und beruflichen
Entwicklung. Beschäftigte in Betrieben, die Mentoring einsetzen,
unterscheiden sich in ihren geschlechtsspezifischen Einstellungen
nicht von Beschäftigten in Betrieben ohne solche Programme. Ein
leichter Zusammenhang zeigt sich lediglich, wenn die Maßnahmen seit
mindestens fünf Jahren existieren. Dies könnte darauf hindeuten,
dass sie länger brauchen, bis sie wirken.
Darüber hinaus
könnte die geringe Wirkung auch an der konkreten Umsetzung von
Mentoring-Programmen liegen. Sie werden häufig dafür kritisiert,
dass Mentor*innen Karriereratschläge geben, die vor allem auf eine
Anpassung an „maskulinisierte Normen des idealen Arbeitnehmers“
abzielen – und dadurch bestehende Geschlechterbilder eher festigen,
statt sie zu hinterfragen. Schließlich, so Peters und Abendroth,
entfaltet Mentoring dann besonderes Potenzial, die
Unternehmenskultur zu verändern, wenn es nicht auf individuelle
Anpassung zielt, sondern in eine umfassende betriebliche
Gleichstellungsstrategie eingebettet ist.
Gerade in Zeiten,
in denen weltweit gegen Gleichstellungspolitik mobilisiert wird,
bewerten die Forscherinnen die Ergebnisse als starkes Argument:
Betriebliche Maßnahmen wie freiwillige Frauenquoten können mehr als
nur Strukturen verändern – sie setzen Impulse für ein neues Denken
und stärken egalitäre Rollenbilder im Alltag der Arbeitswelt.
HANDVERLESEN | Wim Alexander - Der große Abend der
Freundschaft (zwischen den Nationen, Generationen und Geschlechtern)
Das Programm der vielen Gesichter und Facetten Herr
Hunkenschroer sucht eine Frau. Frau Kalkenkötter einen neuen
Vornamen für ihre Tochter. Dad sucht bei der Hochzeit seines Sohnes
Haltung zu bewahren, die ihm immer wieder zu entgleiten droht. Der
einzige, der meint, er hat schon alles, was Mann braucht, ist
Edelproll Marcello, der Moderator dieses Abends. Doch auch Marcello
kommt an seine Grenzen, wenn’s um Frauen geht.
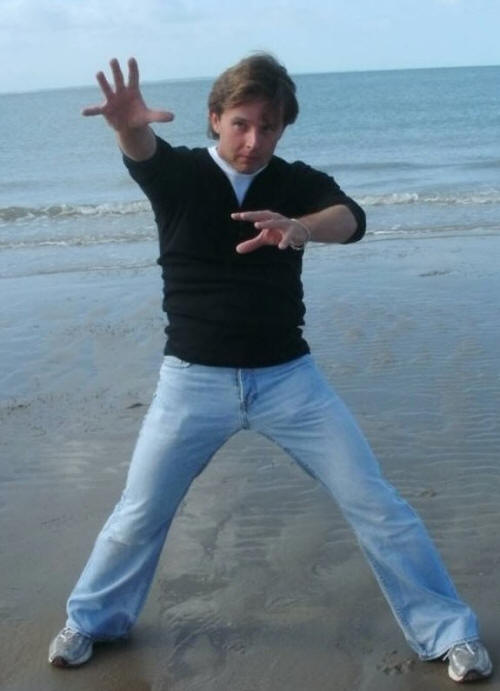
Foto-Freigabe von Wim Alexander
Der Schriftsteller und
Schauspieler Wim Alexander schlüpft in völlig unterschiedliche
Rollen, die er liebevoll pointiert und urkomisch ausgestaltet. Seine
Protagonisten sehen sich mit abstrusen gesellschaftlichen Fragen
unserer Zeit konfrontiert, die sie auf ihre eigene Art überraschend
zu bewältigen wissen oder auch nicht. Humor mit Leichtigkeit und
Tiefgang. Und mit so vielen überraschenden Momenten.
HANDVERLESEN | Wim Alexander - Der große Abend der Freundschaft
Samstag, 19. Juli 2025, 19:00 Uhr. Das PLUS am Neumarkt, Neumarkt
19, 47119 Duisburg-Ruhrort Eintritt frei(willig) - Hutveranstaltung.
Weitere Informationen:
https://wim-alexander.de
Kirche Obermeiderich lädt wieder zu Emils Pub
ein
Für Freitag, 11. Juli 2025 lädt die Evangelische
Kirchengemeinde Duisburg Obermeiderich in das Gemeindezentrum an der
Emilstraße 27 zu „Emils Pub“ ein. Bei dem beliebten
Gemeindetreffpunkt können Besucherinnen und Besucher ab 19 Uhr bei
Getränken aller Art und gutem Essen zum Wochenende hin ein wenig
abschalten und beim Klönen über Gott, die Welt, den Krieg und den
Frieden ins Gespräch kommen.
Diesmal gibt’s Gegrilltes,
verschiedene Salate und natürlich einen leckeren Nachtisch. Der
Durst kann wie immer mit verschiedenen Biersorten, Wein und
Softgetränken gelöscht werden. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz
unter www.obermeiderich.de.
Pfarrer Blank am nächsten Freitag in der Duisburger
Kircheneintrittsstelle
Immer freitags können Unsichere,
Kirchennahe oder solche, die es werden möchten, in der
Eintrittsstelle in der Salvatorkirche mit Pfarrerinnen, Pfarrern und
Prädikanten ins Gespräch kommen und über die Kirchenaufnahme reden.
Motive für den Kircheneintritt gibt es viele: Die Suche nach
Gemeinschaft, Ordnung ins Leben bringen oder der Wunsch, Taufen,
Hochzeiten, Bestattungen kirchlich zu gestalten. Aufnahmegespräche
führt das Präsenzteam in der Eintrittsstelle an der Salvatorkirche
immer freitags von 14 bis 17 Uhr. Am Freitag, 11. Juli 2025 heißt
Pfarrer Stephan Blank Menschen in der Südkapelle des Gotteshauses
neben dem Rathaus herzlich willkommen. Infos zur Citykirche gibt es
unter www.salvatorkirche.de.

NRW: Krankenhausbehandlungen wegen Krankheiten der
Wirbelsäule und des Rückens 2023 um 4,6 % gestiegen
*
Zahl der behandelten Personen bleibt nach Corona auf niedrigem
Niveau.
* Behandlungsquote in Herne mit 1.966 je 100.000
Einwohnern am höchsten.
* Anstieg von 5,3 % bei den
vollstationären Reha-Behandlungen.
Im Jahr 2023 wurden
129.505 Menschen aus Nordrhein-Westfalen wegen Krankheiten der
Wirbelsäule und des Rückens vollstationär im Krankenhaus behandelt.
Darunter fallen Deformitäten oder Verschleißerscheinungen der
Wirbelsäule, Bandscheibenschäden und Rückenschmerzen, die nicht auf
die zuvor genannten Erkrankungen zurückzuführen und auch nicht
psychogen sind.
Wie das Statistische Landesamt mitteilt,
waren das 4,6 % mehr als ein Jahr zuvor, aber 18,3 % weniger als im
Jahr 2013. Nach einem starken Rückgang der Behandlungsfälle um
20,1 % im ersten Jahr der Corona-Pandemie blieben die
Behandlungsfälle in den Jahren 2021 mit +0,8 % und 2022 mit −0,7 %
auf diesem niedrigeren Niveau. Ob dies ggf. mit einer Zunahme
ambulanter Behandlungen begründet ist, kann die Statistik nicht
belegen.

Durchschnittsalter lag bei 61,6 Jahren, mehr als die Hälfte
waren Frauen
Mit 45,4 % der Patientinnen und Patienten waren
etwa ähnlich viele Patientinnen und Patienten im Alter von 40 bis
unter 65 Jahren wie in der Altersgruppe 65 Jahre und älter mit
43,4 % vertreten. Das Durchschnittsalter der behandelten Personen
lag bei 61,6 Jahren. Mit 55,0 % der 2023 behandelten Personen waren
etwas mehr als die Hälfte Frauen.
Im Durchschnitt verblieben
die Patientinnen und Patienten 6,3 Tage im Krankenhaus. Höchste
Behandlungsquote in Herne – niedrigste Quote in Münster Die höchste
Quote der Behandlungsfälle in Krankenhäusern wegen Krankheiten der
Wirbelsäule und des Rückens gab es 2023 in Herne mit 1.966 je
100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, gefolgt von Gelsenkirchen mit
1.299 und dem Kreis Recklinghausen mit 1.271.
Am geringsten war
die Quote in Münster mit 312 Behandlungsfällen je 100.000
Einwohnerinnen und Einwohner, in Bielefeld mit 330 und im Kreis
Gütersloh mit 367.
Anstieg auch bei vollstationären
Reha-Behandlungen von Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens
Die Zahl der im Jahr 2023 wegen Krankheiten der Wirbelsäule und
des Rückens in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr
als 100 Betten vollstationär behandelten Menschen aus NRW lag bei
36.074. Das war ein Anstieg von 5,3 % im Vergleich zum Vorjahr.
Gegenüber 2013 ging die Anzahl der Behandlungen um 14,0 % zurück.
Wie bei den Krankenhausbehandlungen gab es bei den
vollstationären Reha-Behandlungen mit 56,5 % etwas mehr Patientinnen
als Patienten. Im Gegensatz zur Altersverteilung bei den
Krankenhausbehandlungen waren 68,0 % der Behandelten im Reha-Bereich
im Alter von 40 bis unter 65-Jahren. Somit lag das
Durchschnittsalter mit 58,3 Jahren bei den Rehas etwas niedriger.
Die durchschnittliche Verweildauer betrug 23,4 Tage.
NRW-Industrie: Energieintensive
Produktion im Mai 2025 um 1,5 % gesunken
*
Produktionsrückgang in der übrigen Industrie um 0,9 %.
* Chemie
sowie Metallerzeugung und -bearbeitung mit Produktionseinbußen.
* Rückläufige Werte im Vergleich zu Februar 2022 sowohl in der
energieintensiven als auch in der übrigen Industrie.
Die Produktion der NRW-Industrie ist im Mai 2025 nach vorläufigen
Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt um 1,0 % gegenüber April
2025 gesunken. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, sank die
Produktion in den energieintensiven Wirtschaftszweigen um 1,5 %. Die
Produktion in der übrigen Industrie war gegenüber dem entsprechenden
Vormonat um 0,9 % niedriger.

Verglichen mit dem Vorjahresmonat sank die Produktion um 4,0 %;
die der energieintensiven Industrie sank um 10,0 %. Die Produktion
in der übrigen Industrie ging um 0,5 % zurück. Chemie mit
Produktionseinbußen von 2,9 % – Kokerei und Mineralölverarbeitung
mit einem Plus von 7,6 % .
Im Vergleich zu April 2025 waren
in NRW für die energieintensiven Branchen im Mai 2025
unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten: Innerhalb der
energieintensiven Branchen wurde für die chemischen Industrie ein
Produktionsrückgang von 2,9 % (−11,5 % ggü. dem Vorjahresmonat)
ermittelt.
In der Metallerzeugung und -bearbeitung sank die
Produktion um 2,3 % (−10,5 % ggü. dem Vorjahresmonat). Die Kokerei
und Mineralölverarbeitung vermeldete hingegen ein Produktionsplus
von 7,6 % (−12,6 % ggü. dem Vorjahresmonat).
Unterschiedliche Entwicklungen auch in den Branchen der übrigen
Industrie
In den Branchen der übrigen Industrie waren ebenfalls
unterschiedliche Entwicklungen zu erkennen: Die Produktionsleistung
in der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen stieg um
4,6 % (+2,7 % ggü. dem Vorjahresmonat). Im Sonstigen Fahrzeugbau
wurde ein Produktionsplus von 3,1 % verzeichnet (−2,2 % ggü. dem
Vorjahresmonat).
Die Getränkeherstellung vermeldete dagegen
einen Produktionsrückgang von 8,4 % (−10,9 % ggü. dem
Vorjahresmonat). Die Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln
verzeichnete ein Produktionsminus von 2,7 % (−1,9 % ggü. dem
Vorjahresmonat). Auch der Maschinenbau konstatierte
Produktionseinbußen von 1,8 % (+3,1 % ggü. dem Vorjahresmonat).
Im Vergleich zu Februar 2022, zu Beginn des Krieges in der
Ukraine, sank die Produktion im Mai 2025 insgesamt um 11,4 %
(−15,8 % in der energieintensiven Industrie; −8,8 % in der übrigen
Industrie). Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, lag der
revidierte kalender- und saisonbereinigte Wert für den Berichtsmonat
April 2025 um 3,7 % unter dem Vormonats- und 3,2 % unter dem
Vorjahreswert.