






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 36. Kalenderwoche:
4. September
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Freitag, 5. September 2025
Band-Contest DU ON STAGE: Abstimmung startet am 5. September
Drei Newcomer haben in diesem Sommer auf der großen Bühne der
beliebten JAZZ AUFM PLAZZ-Reihe auf dem Duisburger
König-Heinrich-Platz vor großem Publikum gespielt. Die zweite
Auflage des Band Contest DU ON STAGE geht ins Finale. Das Publikum
kann ab sofort online abstimmen und den Gewinner des Wettbewerbs
küren. Der Sieger der Abstimmung wird bei der SPÄTSCHICHT XXL am 2.
Oktober im Oktober als Top Act auf der Bühne stehen.
Gäste
und neu gewonnene Fans können sich dann auf einen ganzen Abend mit
ihrem Lieblings-Act aus dem BandWettbewerb freuen. Um für die
eigenen Favoriten voten zu können, können die Gäste ab sofort und
bis zum 21. September auf der Website www.duisburgkontor.de für die
jeweiligen Bands abstimmen. Der Sieger wird kurz darauf
bekanntgegeben und kann sich auf den Auftritt im Oktober
vorbereiten.
Die
Auftritte in der zeitlichen Reihenfolge:
Am 5. Juni stand die
Rheinberger Punkrock-Combo KÄNK auf der Bühne, am 3. Juli waren die
Mönchengladbacher Indie-Rocker MISS MADISON auf dem
König-Heinrich-Platz zu Gast, am 31. Juli hat die
Crossover-Formation STEVIE HONDA bei der Weinfest-Eröffnung
gespielt. Der Auftritt der Band SANDRA WONDER, der für den 4.
September geplant war, musste aus Krankheitsgründen kurzfristig
abgesagt werden. Damit sind insgesamt drei Formationen im Wettbewerb
um das Konzert bei der SPÄTSCHICHT XXL am 2. Oktober.
Kaum
Regen im August – außer am letzten Tag des Monats
Niederschlagsbilanz von Emschergenossenschaft und Lippeverband
Emscher-Lippe-Region. Der August 2025 war deutlich trockener als das
langjährige Mittel und setzt somit die Serie an zu trockenen Monaten
fort. Das ist das Ergebnis der monatlichen Niederschlagsbilanz der
beiden Wasserwirtschaftsverbände Emschergenossenschaft und
Lippeverband (EGLV).
Seit Mai lagen die Niederschlagsummen
aller Monate deutlich unter den langjährigen Mittelwerten. Im
Emscher-Gebiet wurden im August im Gebietsmittel 43,8 mm erreicht
(130-jähriges Mittel: 78 mm – ein Millimeter entspricht einem Liter
pro Quadratmeter). Das bedeutet Rang 17 der trockensten Augustmonate
seit 1931. Im Lippe-Gebiet war es noch etwas trockener.
Dort
liegt das Gebietsmittel bei 37,2 mm (130-jähriges Mittel: 76 mm).
Damit landet der August im Lippeverbandsgebiet auf Rang 13.
Ausschlaggebend für die niedrigen Niederschlagssummen war eine
annähernd drei Wochen andauernde niederschlagsfreie Phase ab dem 6.
August.
Die Monatssummen liegen in den Verbandsgebieten im
August 2025 zwischen 20,2 mm an der Station Kläranlage
Kamen-Körnebach und 63,5 mm an der Station Stauraumkanal
Bochum-Darpestraße. Starker Regen, wie man ihn kennt. Die größten
Tagessummen im August fielen am letzten Tag des Monats. An diesem
Tag kam gut ein Drittel des Monatsniederschlages zusammen.
Die größte Tagessumme in den Verbandsgebieten wurde mit 38,5 mm an
der Station Kläranlage Dinslaken-Eppinghofen erreicht. An vier Tagen
im August haben EGLV Starkregenereignisse registriert. Maximal wurde
eine Starkregenindex-Stufe von 2 mit einer Jährlichkeit von 3 bis 5
Jahren erreicht. Das Monatsmittel der Lufttemperatur lag im August
fast ein Grad Celsius über dem langjährigen Mittel von 18,3 Grad
Celsius. Es wurde ein Monatsmittel von 19,2 Grad Celsius erreicht.
Der meteorologische Sommer war ebenfalls deutlich trockener
als das langjährige Mittel. Im Emscher-Gebiet liegt die
Niederschlagsmenge für den Sommer bei 158 mm (130-jähriges Mittel:
235 mm). Damit landet der Sommer 2025 auf Rang 14 der trockensten
Sommer seit 1931. Im Lippe-Gebiet liegt das Gebietsmittel für den
Sommer 2025 bei 142 mm (130-jähriges Mittel: 228 mm). Damit erreicht
der Sommer 2025 im Lippeverbandsgebiet den 10. Platz unter den
trockensten Sommern ab 1931.
Emschergenossenschaft und
Lippeverband Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) sind
öffentlich-rechtliche Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee
des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip leben. Die Aufgaben
der 1899 gegründeten Emschergenossenschaft sind unter anderem die
Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung und -reinigung
sowie der Hochwasserschutz.
Der 1926 gegründete Lippeverband
bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe im nördlichen
Ruhrgebiet und baute unter anderem den Lippe-Zufluss Seseke naturnah
um. Gemeinsam haben Emschergenossenschaft und Lippeverband rund
1.800 Beschäftigte und sind Deutschlands größter Abwasserentsorger
und Betreiber von Kläranlagen und Pumpwerken (rund 782 Kilometer
Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle, 544 Pumpwerke und
59 Kläranlagen). www.eglv.de
Digitales Tool unterstützt Städte bei der Anpassung an den
Klimawandel
Mit Hilfe welcher digitalen Werkzeuge
können sich Städte wie Duisburg besser auf die Folgen des
Klimawandels vorbereiten? In dem Duisburger Workshop zum
Forschungsprojekt „R2K-Klim+“ haben sich jetzt Teilnehmende über die
digitalen Möglichkeiten ausgetauscht.
Das Projekt wird vom
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
gefördert. Beim Workshop wurden aktuelle Ergebnisse vorgestellt und
gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums, des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und weiteren
Partnern besprochen, wie diese in der Praxis genutzt werden können.
Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig digitale,
geodatenbasierte Systeme für Städte sind, um gezielt auf
Herausforderungen wie mehr Hitzetage, Starkregen oder
wirtschaftliche und verkehrliche Folgen des Klimawandels reagieren
zu können. Für Duisburg ist es ein Ziel, diese Ergebnisse dauerhaft
in die städtische Arbeit zu integrieren und auch in andere Städte
der Region zu übertragen.
Unter Leitung des
Forschungsinstituts für Wasserwirtschaft und Klimazukunft an der
RWTH Aachen arbeiten daran neben der Stadt Duisburg auch Hochschulen
und andere Forschungseinrichtungen mit. Thomas Griebe, Leiter des
städtischen Umweltamts, betonte: „Die Ergebnisse des Workshops sind
eine starke Grundlage für die nächste Projektphase. Damit kann sich
Duisburg weiterhin gezielt auf die Folgen des Klimawandels
vorbereiten und ist Beispiel gebend für die Gestaltung der
Herausforderungen des Klimawandels.“ Weitere Infos: www.r2k-klim.net
Fotos für neuen Stadtteilkalender: „Hochfeld verbindet!“
gesucht
Auch in diesem Jahr ruft das Team vom
Stadtteilbüro Hochfeld wieder zum Fotowettbewerb für den
Stadtteilkalender 2026 auf. Wer tolle Bilder aus Hochfeld hat,
sollte mitmachen. Einsendeschluss ist der 30. September. Das Motto
für den Stadtteilkalender lautet: „Hochfeld verbindet!“

In Anlehnung an das neue Stadtteillogo sucht das Stadtteilbüro
Bilder, die den Zusammenhalt und das Miteinander im Stadtteil
sichtbar machen. Ob das Logo an Hochfelder Orten entdeckt wurde, auf
einer Tasche oder ob Motive entstehen, die Menschen, Vereine und
Einrichtungen im Stadtteilleben zeigen – alles ist erwünscht.
Nach den erfolgreichen Stadtteilkalendern der vergangenen zwei
Jahre wird der Kalender 2026 wieder kostenlos zur Verfügung
gestellt. Wichtig für eine erfolgreiche Wettbewerbsteilnahme: Die
Motive sollen erkennen lassen, dass es sich um Aufnahmen aus
Hochfeld handelt.
Die 13 schönsten Fotos werden im kommenden
Kalender veröffentlicht. Teilnahmebedingungen: - Es können nur Fotos
im Querformat eingereicht werden mit mindestens 300 dpi - Jedem Bild
sollten ein Titel und der Ort, an dem es aufgenommen wurde,
beigefügt werden - Abgabeschluss ist der 30.09.2025 - Die Fotos
bitte einreichen beim Stadtteilbüro Hochfeld per E-Mail an
info@stadtteilbuero-hochfeld.de
Duisburg wird
wieder Schauplatz des Ironman
Sportliche
Höchsteleistungen in Duisburg: Zum fünften Mal wird die
Ruhrgebietsstadt am Sonntag, 7. September, Austragungsort des
Ironman 70.3 sein. Die internationale Triathlon-Serie lockt mehr als
2.000 Sportlerinnen und Sportler aus mehr als 40 Ländern sowie
zahlreiche Gäste in die Stadt.
Der Wettbewerb umfasst
insgesamt 70,3 Meilen – das sind rund 113 Kilometer. Die Highlights
des Rennens - wie Schwimmen an der Regattabahn, Radfahren vom
Sportpark bis in den Stadtteil Baerl oder der Zieleinlauf in der
Schauinsland-Reisen-Arena - können Zuschauerinnen und Zuschauer
entlang der Strecke verfolgen. Duisburg gehört als einzige Stadt in
NRW zu den Austragungsorten der weltweiten Ironman-Serie. idr -
Informationen:
https://www.ironman.com/races/im703-duisburg
Bundesweiter Warntag – Probealarm des Sirenensystems
Die Stadt Duisburg überprüft erneut das Konzept zur Warnung und
Information der Bevölkerung im Gefahrenfall. Dies erfolgt mit einem
stadtweiten Probealarm des Sirenensystems am Donnerstag, 11.
September, um 11 Uhr.
Der Probealarm findet wieder innerhalb
eines bundesweiten Warntags statt, der vom Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) koordiniert wird.
Dabei werden im gesamten Bundesgebiet sämtliche Warnmittel erprobt
und damit zeitgleich die in den Kommunen vorhandenen Warnkonzepte
getestet.
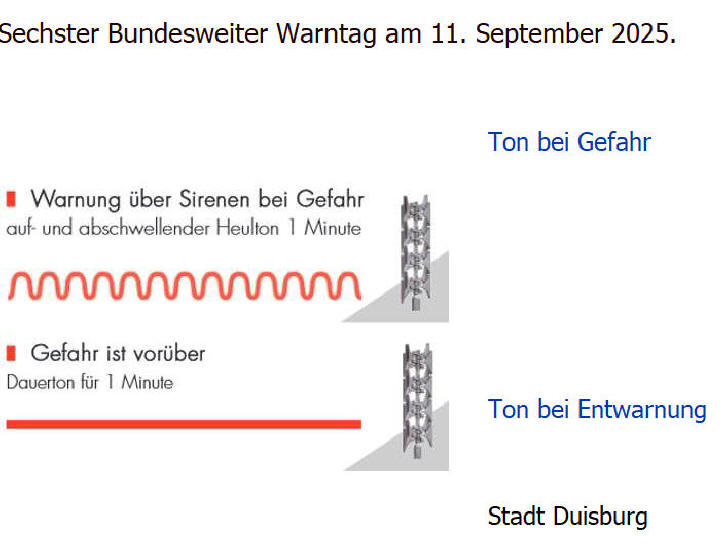
Ziel ist es, die Bevölkerung für das Themenfeld „Warnung“ zu
sensibilisieren sowie Informationen und Tipps zu geben, damit sie im
Ernstfall richtig reagieren und sich selbst helfen können. Der
Beginn des Alarms wird mit einem einminütige Dauerton für die
Entwarnung ausgelöst. Es folgt der einminütige auf- und
abschwellende Heulton für die Warnung. Zum Abschluss erfolgt wieder
das Entwarnungssignal.
Über den Sirenentest informiert am
Tag des Probealarms auch die städtische Internetseite
(www.duisburg.de), das kostenlose Gefahrentelefon der Stadt Duisburg
(0800/1121313) sowie die Warn-App „NINA“. An diesem Tag wird auch
erneut Cell Broadcast über das Modulare Warnsystem (MoWaS) ausgelöst
und eine entsprechende Mitteilung auf Mobilfunkgeräte gesendet.
Weitere Informationen zu Cell Broadcast finden sich auf den
Internetseiten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe unter
www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warnung-in-Deutschland/Sowerden-Sie-gewarnt/Cell-Broadcast/cell-broadcast_node.html
Zur Auswertung des aktuellen Probealarms stützt sich die Feuerwehr
Duisburg auf die eigene technische Analyse des Sirenensystems.
Rückmeldung zu den Sirenen können auch per E-Mail
(kub@feuerwehr.duisburg.de, Betreff „Probealarm“) an die Stabsstelle
Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz erfolgen. Weitere
Informationen zum bundesweiten Warntag sind online unter
https://www.bbk.bund.de/ bereitgestellt.
Bahn setzt umfangreiche Sanierung auf der Hauptstrecke durch
das Ruhrgebiet fort
Bahnreisende im Ruhrgebiet müssen
sich ab dem 5. September in Geduld üben: Dann wird für zwei Monate
die Hauptverbindung zwischen Essen und Dortmund gesperrt. Grund für
die bis zum 31. Oktober geltende Sperrung sind Arbeiten für den
RRX-Ausbau in Bochum, gleichzeitig werden auf der Strecke Schienen
ausgetauscht, Weichen instand gesetzt und Schallschutzarbeiten
durchgeführt.
Das Umleitungskonzept, das bereits im Frühjahr
dieses Jahres galt, wird erneut umgesetzt. So werden die Züge im
Nahverkehr zwischen Dortmund und Essen umgeleitet. Die S-Bahn-Gleise
bleiben in dem Streckenabschnitt unter der Woche befahrbar, an den
Wochenenden kommt es zu Sperrungen. Im gesamten Bauzeitraum fahren
Ersatzbusse.
Die Züge im Fernverkehr werden hauptsächlich
zwischen Dortmund und Essen sowie zwischen Dortmund und Köln bzw.
Düsseldorf umgeleitet. Am Bochumer Hauptbahnhof entfallen sämtliche
Fernverkehrshalte. Die Fahrplananpassungen sind bereits in den
Auskunftsmedien und Apps hinterlegt und werden über Aushänge an den
Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter
https://www.bahn.de/service/fahrplaene abrufbar. idr
DVG erhält Fördermittel für Infrastrukturausbau
Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) arbeitet gemeinsam
mit der Stadt Duisburg an der Modernisierung der Infrastruktur für
einen zukunftsfähigen ÖPNV. Die DVG erhält nun für die Erneuerung
der kommunalen Schieneninfrastruktur Fördermittel vom
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR).
Dr. Susanne Haupt,
Hauptabteilungsleiterin des Bereichs Infrastrukturmanagement der
DVG, nahm den Fördermittelbescheid von Oliver Krischer, Minister für
Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen im
Rahmen einer Feierstunde am 3. September in Krefeld entgegen.
„Der öffentliche Personennahverkehr ist ein zentraler
Bestandteil für eine umweltfreundliche Mobilität in unserer Stadt.
Daher wird er stetig verbessert und weiter ausgebaut. Daran arbeiten
wir gemeinsam mit der Stadt Duisburg und freuen uns über die
Förderung der umfassenden Erneuerung unserer Schieneninfrastruktur“,
sagt Susanne Haupt.

Die Übergabe des Fördermittelbescheids an die DVG (v.l.): Oliver
Krischer, Minister für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr.
Susanne Haupt, Hauptabteilungsleiterin des Bereichs
Infrastrukturmanagement der DVG und Marc Nüßen, Abteilungsleiter
Fördermanagement und Infrastrukturentwicklung Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr. Foto: MUNV NRW / Andrea Bowinkelmann
Verkehrsminister Oliver Krischer betont: „Wir unterstützen die DVG
jetzt mit 24 Millionen Euro für den Bau neuer Gleise und die
Modernisierung von Fahrleitungen und Haltestellen. Besonders wichtig
ist, dass wir durch neue Haltestellen mehr Barrierefreiheit
schaffen. So machen wir den Nahverkehr attraktiver.“
Über
39 Millionen Euro Gesamtkosten
Das mit knapp 24,8 Millionen
Euro geförderte 3. Paket der sogenannten Grunderneuerung beinhaltet
29 Einzelmaßnahmen aus dem Bereich Fahrwegtechnik. Die bewilligten
Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 39.096.445 Euro. Die
Maßnahmen werden in der Regel mit 60 Prozent gefördert, für
Barrierefreiheit gibt es eine 90-Prozent-Förderung.
Unter
anderem ist dort die Erneuerung von Haltestellen sowie Gleis- und
Fahrleitungsanlagen der Straßenbahnlinien 901 und 903 sowie der
Stadtbahnlinie U79 enthalten. Eingereicht wurde der Rahmenantrag
bereits im Juni 2023. Die Durchführung der Maßnahmen ist von 2024
bis einschließlich 2028 geplant. Einige Maßnahmen befinden sich
daher auf Basis eines genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginns
bereits in der Umsetzung.
Vorstellung der
Duisburger IGA-Planungen in der VHS
Claudia Schoch,
Projektleiterin für den Duisburger Teil der Internationalen
Gartenausstellung 2027, stellt am Montag, 15. September, um 20 Uhr
in der Volkshochschule im Stadtfenster (Raum 005), Steinsche Gasse
26, den aktuellen Planungs- und Umsetzungsstand vor.
Im
April 2027 eröffnet die IGA im RheinPark Duisburg. Warum dies eine
große Chance für die Stadt und die Stadtentwicklung darstellt,
erklärt Claudia Schoch. Die IGA 2027 erstreckt sich zwar über das
gesamte Ruhrgebiet, Duisburg ist dabei aber einer der
Hauptspielorte. Die Besucherinnen und Besucher bekommen
Informationen zu den Ausstellungsinhalten, über investive Maßnahmen,
die auch nach der IGA Bestand haben werden und was sich hinter der
Beteiligungsebene „Mein Garten“ verbirgt.
Der Eintritt zu
der Veranstaltung aus der Reihe „res publica – Stadtverwaltung im
Gespräch“ ist frei. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten. Für
weitere Informationen zu der Veranstaltung steht Josip Sosic unter
Tel. 0203/283-984617 und per E-Mail j.sosic@stadt-duisburg.de zur
Verfügung.
Der Transistor wird 100 – VHS-Vortrag würdigt den
Geburtstag
Ohne Transistoren wäre unsere
computergesteuerte Welt heute kaum vorstellbar. Vor
100 Jahren wurde dieses elektronische
HalbleiterBauelement patentiert. Der Duisburger
Physik-Professor Dr. Axel Lorke stellt den
Transistor und seine Funktionsweise in einem
populärwissenschaftlichen Vortrag am Dienstag, 16.
September, um 20 Uhr in der Volkshochschule im
Stadtfenster vor.
Das Teilnahmeentgelt beträgt fünf Euro, eine
vorherige Anmeldung unter
https://www.vhs-duisburg.de/kurssuche/kurs/100-JahreTransistoren/252MZ5884
ist erforderlich. Weiterführende Informationen
erteilt Josip Sosic unter 0203 283 984617
VHS: Analyse der Duisburger
Kommunalwahlergebnisse
Am 14. September finden die Kommunalwahlen in
Nordrhein-Westfalen statt. Die Duisburger Wahlergebnisse wird der
Politikwissenschaftler Dr. Ralf Kleinfeld im Nachgang am Mittwoch,
17. September, um 20 Uhr in der VHS im Stadtfenster an der
Steinschen Gasse 26 in Duisburg-Mitte, genauer betrachten und
analysieren.
Die Teilnahme beträgt fünf Euro. Eine vorherige
Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen und die
Möglichkeit sich anzumelden, gibt es bei der VHS, Josip Sosic,
telefonisch (0203/283-984617) oder per E-Mail
(j.sosic@stadt-duisburg.de).
NGG: „Gastro-Betriebe sollen auf
Profis setzen – mehr Stammpersonal, mehr Azubis“ - Im ersten
Halbjahr 280.700 Gäste-Übernachtungen
Jede Menge
Rollkoffer auf dem Pflaster in Duisburg unterwegs: Im ersten
Halbjahr gab es in Duisburg rund 280.700 Übernachtungen von Gästen
aus dem In- und Ausland. Das hat die Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten mitgeteilt. Die NGG Nordrhein beruft sich
dabei auf aktuelle Tourismus-Zahlen vom Statistischen Landesamt
Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Damit hat es in Duisburg in den ersten
sechs Monaten dieses Jahres 1,3 Prozent mehr Übernachtungen gegeben
als im ersten Halbjahr 2024, so die Gastro-Gewerkschaft NGG.

Der beste „Botschafter“ für den Tourismus: der Rollkoffer. „Egal, ob
privat oder geschäftlich: Wer nach Duisburg kommt und in Hotels und
Restaurants geht, belebt das Geschäft“, sagt Adnan Kandemir von der
Gastro-Gewerkschaft NGG Nordrhein. Wichtig sei allerdings, dass
Hotellerie und Gastronomie „nicht am falschen Ende“ sparten: Mehr
Fach- statt immer mehr Aushilfskräfte – darauf müssten Gastronomen
achten. „Profi-Küche und Profi-Service sind wichtig. Stammpersonal
und Nachwuchs sind daher das A und O. Sie müssen aber auch
ordentlich bezahlt werden“, so Kandemir.
Anlässe, nach
Duisburg zu kommen, gebe es viele: „Urlaub, Tagesausflug,
Geschäftsreise, Verwandtschaftsbesuch, medizinische Behandlung,
Fortbildung ... – jeder Besuch und jede Übernachtung ist gut für das
Hotel- und Gaststättengewerbe in Duisburg“, sagt Adnan Kandemir. Für
den Geschäftsführer der NGG Nordrhein bedeutet das allerdings auch:
„Hotels, Pensionen, Restaurants, Gaststätten, Cafés & Co. in
Duisburg sollten gezielt auf Stammpersonal setzen. Vor allem auch
auf den Nachwuchs: Die Branche braucht Auszubildende“, so Kandemir.
In der Gastronomie werde heute deutlich besser verdient als noch
vor fünf Jahren. Dafür habe sich die NGG stark gemacht. Vor allem
auch das Azubi-Portemonnaie sei deutlich dicker geworden: Wer eine
Gastro-Ausbildung starte, bekomme ab August bereits im ersten
Ausbildungsjahr 1.150 Euro pro Monat. Und nach drei Jahren – also am
Ende der Ausbildung – monatlich sogar 1.350 Euro. Das seien „fixe
Ausbildungsvergütungen“. Sie müssten in der gesamten Hotellerie und
Gastronomie in ganz Nordrhein-Westfalen gezahlt werden.
Die
Gastro-Gewerkschaft NGG Nordrhein warnt Gastronomen in Duisburg vor
einem „gefährlichen Trend“ in der Branche: „Immer mehr Aushilfs- und
immer weniger Fachkräfte. Das geht zu Lasten der Qualität – in der
Küche genauso wie im Service. Die Hotellerie und Gastronomie in
Duisburg sollte alles daransetzen, als Profi- und nicht als
Laien-Branche rüberzukommen“, sagt Adnan Kandemir.
Es sei
daher wichtig, junge Menschen davon zu überzeugen, dass sich eine
Gastro-Ausbildung lohne. „Wer im Tourismus arbeitet, steht mitten im
Leben: Von der Küche über die Bar bis zur Rezeption – in Hotels ist
immer etwas los. Allerdings schrecken die wenig attraktiven
Arbeitszeiten viele – gerade auch Jugendliche – enorm ab“, so
Kandemir.
Deshalb müsse die Gastro-Branche dringend etwas
gegen „Frust-Dienstpläne“ unternehmen: „Nämlich genug Personal
einstellen, um superlange Schichten und zu viele Wochenendeinsätze
zu vermeiden. Aber auch das Geld muss natürlich stimmen: Nur wer den
Tariflohn bekommt, wird fair bezahlt. Und ganz wichtig: Trinkgeld
ist kein Ersatzlohn. Auch wenn viele Wirte das nach wie vor anders
sehen“, sagt Adnan Kandemir von der Gastro-Gewerkschaft.
Wie erkenne ich „Fakes“ im Internet? Digitaler Dienstag zum
Thema Desinformation im Stadtfenster
Ist das Fake oder
echt? Diese Frage lässt sich im Digitalen zunehmend schwerer
beantworten. Am Dienstag, 9. September um 17 Uhr, geht es beim
Digitalen Dienstag von Stadtbibliothek und Volkshochschule um die
Frage, wie man Desinformationen im digitalen Zeitalter erkennen
kann. Praxisnah, verständlich und ohne Fachchinesisch wird gezeigt,
wie sich Desinformation verbreitet und was man dagegen tun kann.
Nach einem kurzen thematischen Einstieg bleibt viel Raum für
Fragen und Austausch. Die Reihe „Digitaler Dienstag“ richtet sich
vor allem an Erwachsene mit wenig digitalen Vorkenntnissen. Alle,
die neugierig sind und Neues ausprobieren möchten, sind herzlich
willkommen.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung
erfolgt online und ist auf www.stadtbibliothek-duisburg.de unter dem
Stichpunkt „Veranstaltungen“ möglich. Fragen beantwortet das Team
der Bibliothek gerne persönlich oder telefonisch unter 0203 2834218.
Die Servicezeiten sind montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis
freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr .
Portrait-Zeichenworkshop in Rumeln-Kaldenhausen
Jugendliche von 10 bis 14 Jahren, die sich für das
Portraitzeichnen interessieren, sind am Freitag, 12. September, von
15 bis 18 Uhr zu einem Workshop in die Schul- und
Stadtteilbibliothek auf der Schulallee 11 in Rumeln-Kaldenhausen
eingeladen. Riswane Rowinski erklärt, wie man schnelle und
realistische Portraits zeichnet – von der Konstruktion bis zum
Entstehen eines eigenen Kunstwerks.
Wer selbst schon
gezeichnet hat, kann seine Sachen gerne mitbringen und sich weitere
Tipps und Anregungen holen. Die Teilnahme kostet 2 Euro zugunsten
der Duisburger Bibliotheksstiftung. Alle Materialien werden
gestellt. Die Kurse gehören zum Programm des Kulturrucksack NRW.
Die Anmeldung ist online auf der Internetseite
www.stadtbibliothekduisburg.de unter „Veranstaltungen“ möglich.
Fragen beantwortet das Team der Bibliothek gerne persönlich oder
telefonisch unter 02151 41908158. Die Öffnungszeiten sind dienstags
bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie samstags
von 10 bis 13 Uhr.
Volle Power – die „UmweltKids“
kommen nach HombergHochheide
Die Bezirksbibliothek
Homberg-Hochheide an der Ehrenstraße 20 lädt Kinder der zweiten bis
vierten Klasse am Samstag, 13. September, zu einer Veranstaltung der
Reihe „UmweltKids“ ein. Unter dem Motto „Volle Power“ finden die
jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 11 bis 12.30 Uhr heraus,
was Energie eigentlich ist und wo elektrischer Strom herkommt.
Außerdem können die Kinder spielerisch entdecken, wie man auf
verschiedenen Wegen Strom herstellen kann.
Die Teilnahme ist
kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich. Weitere
Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf
www.stadtbibliothek-duisburg.de. Auskünfte erteilt auch Matthias
Friedrich unter Tel. 0151 20564912 oder per E-Mail
netzwerker@werkstadtduisburg.de
Duisburger
Bücherzirkel: Queer & Fantasy
Interessierte, die gerne
Bücher aus den Bereichen Queer und Fantasy lesen, sind herzlich zum
Bücherzirkel am Freitag, 12. September, um 17.30 Uhr in die
Zentralbibliothek auf der Steinschen Gasse 26 in der Innenstadt
eingeladen. In gemütlicher Runde können Interessierte ihre eigenen
Lieblingsbücher vorstellen oder aber einfach nur zuhören.
Dabei kann es um ältere Titel genauso gehen wie um aktuelle.
Moderiert wird der Bücherzirkel von Kathi Fehlberg, die selbst bei
der Stadtbibliothek arbeitet und sich gerne in andere Welten träumt.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung ist online auf
www.stadtbibliothek-duisburg.de möglich.
Der „kluge“ Gartenmonat September - Tipps zum Gärtnern
im Herbst
Der September ist der „kluge“ Gartenmonat: Bei
spätsommerlichem Licht und erster Herbstluft ist der perfekte
Zeitpunkt, den Garten für das kommende Frühjahr vorzubereiten. Dr.
Lutz Popp, Gartenbauexperte des Bayerischen Landesverbandes für
Gartenbau und Landespflege e. V. (BLGL), erklärt, welche
Gartenarbeiten in den Herbstmonaten anstehen.

Verblühte Stauden und Gräser stehen lassen und erst im Frühjahr
zurückschneiden. (Quelle: BLGL)
„Der September ist ein
idealer Monat für Neupflanzungen: Der Boden ist noch warm, die
Verdunstung nimmt ab und das feuchte Klima sorgt für gute
Bedingungen. So können neue Pflanzen leichter Wurzeln schlagen“,
erläutert Dr. Lutz Popp, Gartenbauexperte des BLGL. Für Hobbygärtner
ist der Herbst daher die optimale Zeit, um Blumenzwiebeln zu setzen,
Staudenbestände zu erneuern und Gehölze zu pflanzen.
Frühstart fürs Frühjahr: Blumenzwiebeln richtig setzen
Besonders
lohnend ist im September der Griff zur Blumenzwiebel: Jetzt ist die
beste Zeit, um Frühblüher wie Krokusse, Narzissen und Tulpen zu
setzen. „Beim Pflanzen hilft eine einfache Merkregel: Die Zwiebeln
etwa doppelt so tief setzen, wie sie hoch sind – kleine Arten in
dichten Gruppen, größere in lockeren Tuffs“, rät Dr. Popp.
„Ideal ist es, die Blumenzwiebeln zwischen Stauden zu setzen, denn
sie können sich sehr gut ergänzen.“ Auch an Herbstblüher sollten
Hobbygärtner dabei denken: Wer Herbstkrokus und Co. bis spätestens
Mitte September einsetzt, kann unter günstigen Bedingungen schon
einige Wochen später Blüten erwarten.
Hecken, Sträucher und
Bäume jetzt pflanzen
Auch für Hecken, Sträucher und Bäume ist der
Herbst ein klassischer Pflanzzeitpunkt. Vor dem Setzen lohnt eine
durchdachte Planung. Denn freiwachsende, artenreiche Hecken
benötigen ausreichenden Platz. Je nach Gehölzgröße gilt es also,
genug Abstand einzuhalten und in leichter Zickzacklinie zu pflanzen.
Aber Achtung: Formschnitthecken mögen es enger.
„Hecken aus
heimischen Blüten- und Wildgehölzen verbinden Schutz, Struktur und
Nahrung und sie bleiben über das Jahr hinweg lebendig“, sagt der
Gartenbauexperte. „Mit kluger Auswahl lassen sich Blütezeiten und
Fruchtreife so staffeln, dass Insekten und Vögel lange davon
profitieren.“
Richtig gießen, klug mulchen
Damit alle
Pflanzungen – ob Stauden, Blumenzwiebeln oder Gehölze – gut
anwachsen, kommt es vor allem auf die richtige Pflege und
ausreichende Wasserversorgung an. Damit Wasser nicht unnötig
verdunstet, hilft eine dünne Mulchdecke aus geeignetem organischem
Material. Sie hält den Boden feucht, schützt vor Erosion und fördert
das Bodenleben. „Zusätzlich lohnt es sich, die Oberfläche flach zu
lockern und langfristig Humus aufzubauen – so bleibt der Boden
aufnahmefähig, und die Gießintervalle strecken sich“, so ein
weiterer Tipp des Gartenbauexperten.
Europäische
Klimaneutralität bis 2050 rechnet sich auch ökonomisch –
EU-Investitionsfonds sorgt für Effizienz
Es rechnet sich
ökonomisch, wenn die EU ihr Ziel der CO₂-Neutralität bis 2050
konsequent verfolgt und erreicht. Denn die dabei entstehenden Kosten
sind niedriger als die wirtschaftlichen Schäden, die anderenfalls
durch einen verschärften Klimawandel entstehen.
Dabei sollte
aber nicht nur die CO₂-Bepreisung als zentrales Instrument
eingesetzt werden, sondern auch ein zusätzlicher Investitionsfonds
auf EU-Ebene, weil er die notwendige Transformation
gesamtwirtschaftlich effizienter macht – trotz zusätzlicher Kredite,
die zur Finanzierung nötig wären. Das ergibt eine neue Studie des
Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der
Hans-Böckler-Stiftung, die die wirtschaftlichen Wirkungen einer
Kombination aus konsequenter CO₂-Bepreisung und einer mit einem
solchen Fonds finanzierten Investitionsoffensive auf EU-Ebene
vergleicht mit dem aktuellen klimapolitischen Status Quo.*

Pixabay
Die Studie arbeitet dabei mit verschiedenen
Szenarien. In einem Positiv-Szenario, in dem weltweit eine ähnlich
ambitionierte Klimapolitik verfolgt wird wie in der EU, würde laut
Studie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums bei
konservativer Abschätzung vermiedener Schäden bereits im Zeitraum
von 2036 bis 2040 um ein Prozent höher ausfallen, wenn komplementär
zur CO₂-Bepreisung ein Investitionsfonds zwischen 2027 und 2034
EU-weit jährlich 170 Milliarden Euro vor allem in ein nicht-fossiles
Energiesystem und eine klimafreundliche Produktion investiert.
Dieser Gewinn an Wirtschaftskraft würde die Verluste
ausgleichen, die im Zeitraum von 2025 bis 2035 durch die
Aufwendungen für CO₂-Neutralität bis 2050 entstehen. Im Zeitraum von
2041 bis 2045 betrüge der Vorsprung beim BIP schon knapp drei
Prozent, zwischen 2046 und 2051 knapp fünf Prozent.
In einem
zweiten Szenario, in dem andere Länder eine deutlich weniger
ambitionierte Klimapolitik verfolgen als die EU, wäre die
Entwicklung der Wirtschaftsleistung im Euroraum spürbar schwächer.
Auch in diesem Szenario würde sich ein EU-Investitionsfonds aber
positiv auswirken. Denn er würde wesentlich dazu beitragen, dass es
sich auch in diesem Szenario über die kommenden 25 Jahre trotz
höherer Einbußen in der ersten Zeit mit Blick auf die
Wirtschaftskraft rechnet, wenn die EU bis 2050 die CO₂-Emissionen
auf Null reduziert (siehe für beide Szenarien auch die Abbildung in
der pdf-Version dieser PM; Link unten).
„Unsere Ergebnisse
zeigen, dass durch die CO₂-Besteuerung zunächst negative
Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sowie inflationäre
Effekte entstehen. Berücksichtigt man jedoch den Klimawandel und die
damit verbundenen langfristigen Schäden für das Wirtschaftswachstum,
zeigt sich, dass Untätigkeit weitaus schwerwiegendere Folgen in der
Zukunft haben wird“, schreiben die Studienautoren PD Dr. Sebastian
Watzka, Dr. Christoph Paetz und Yannick Rinne. Ein EU-weiter
Investitionsfonds würde die Dekarbonisierung der europäischen
Volkswirtschaften beschleunigen und gleichzeitig die vorübergehend
negativen wirtschaftlichen Auswirkungen abfedern.
In ihren
Berechnungen mit dem international anerkannten makroökonomischen
Modell NiGEM gehen die Wissenschaftler davon aus, dass zusätzlich
zur CO₂-Bepreisung zwischen 2027 und 2034 jährlich rund ein Prozent
des EU-weiten BIP, was etwa 170 Milliarden Euro entspricht, in einen
europäischen Investitionsfonds fließen. Je nachdem, wie konsequent
die Dekarbonisierung vorangetrieben wird, entstehen durch den
Klimawandel mehr oder weniger zusätzliche Kosten, etwa durch
Verluste an fruchtbaren Böden, steigenden Meeresspiegel oder mehr
Extremwetterereignisse.
Um diese Schäden – und den wirtschaftlichen Wert ihrer Vermeidung –
zu quantifizieren, stützen sich die Forscher unter anderem auf Daten
des „Network for Greening the Financial System” (NGFS) und des
Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, die entsprechende
Berechnungen bereits durchgeführt haben.
An der globalen
Zusammenarbeit hängt viel, aber Übergangskosten lassen sich auch auf
europäischer Ebene erheblich beeinflussen
Die deutlichen
Unterschiede, die sich in den beiden Szenarien zeigen,
unterstreichen die Bedeutung der globalen Zusammenarbeit für eine
wirksamere Eindämmung des Temperaturanstiegs, betonen die Forscher
des IMK. Wichtig sei jedoch auch das Ergebnis, dass in beiden
Szenarien die Übergangskosten durch die Einrichtung eines
EU-Investitionsfonds erheblich gesenkt werden könnten. Das
gesamtwirtschaftliche Verhältnis von Aufwand und Ertrag einer
ambitionierten Klimapolitik in Europa lasse sich also zu einem
wichtigen Teil auf europäischer Ebene beeinflussen.
Über den
EU-Investitionsfonds ließen sich öffentliche Investitionen
effizienter finanzieren, als dies den einzelnen Mitgliedstaaten
angesichts ihres begrenzten nationalen finanzpolitischen Spielraums
möglich wäre. Als Vorbilder könnten bereits existierende
EU-Programme wie die Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) dienen,
die maßgeblich zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der
Coronakrise beigetragen hat, sowie der europäische Aufbauplan
NextGenerationEU.
Laut den Wissenschaftlern ist die
Ausweitung dieser Modelle auf die sozial-ökologische Transformation
wirtschaftlich sinnvoll und notwendig, um weitaus kostspieligere
Zukunftsszenarien zu vermeiden. Durch gezielte grüne Investitionen
sinken die CO₂-Preise für Haushalte und Unternehmen. Der Fonds
federt damit nicht nur kurzfristige BIP-Verluste ab, sondern
steigert auch das langfristige Wachstumspotenzial Europas.
Die häufig vorgetragene Kritik, kreditfinanzierte Investitionen
seien nicht tragfähig, stützt sich nach Ansicht der IMK-Forscher auf
Analysen, die klimabedingte Schäden und Übergangskosten ignorieren.
Dadurch würden falsche Schlüsse gezogen und sowohl der verfügbare
finanzpolitische Spielraum als auch die Auswirkungen auf das
Wirtschaftswachstum falsch eingeschätzt.
„Die Entscheidungsträger müssen erkennen, dass Nicht-Handeln im
Klimabereich keine haushaltsneutrale Option ist – es führt zu
höherer Verschuldung und geringerem Wachstum“, schreiben Paetz,
Rinne und Watzka.
Late-Night-Shopping für den guten
Zweck beim Kindersachenflohmarkt in Wanheim
Die
Evangelische Rheingemeinde Duisburg lädt gerne wieder zum beliebten
abendlichen Kindersachenflohmarkt ein. Getrödelt wird am Freitag,
12. September 2025 im Wanheimer Gemeindehaus, Beim Knevelshof 47.
Damit auch Berufstätige Zeit zum Stöbern haben, beginnt der
Flohmarkt erst um 18 Uhr.
Bis 21 Uhr ist dann Gelegenheit
Schnäppchen von Kinderkleidung, Spielzeug, Babysachen bis hin zu
Umstandsmode zu machen. So findet gut Erhaltenes neue Verwendung bei
anderen und landet nicht auf dem Müll. Wer verkaufen möchte, kann
jetzt noch einen Verkaufsplatz zu sieben Euro unter Mobil: 0172 /
7698513 buchen: tagsüber zwischen 10 und 19 Uhr, gerne auch per
WhatsApp. Der Erlös kommt der gemeindeeigenen Kneipp-Kita zugute.
Kirche Obermeiderich lädt wieder zu
Emils Pub ein
Für Freitag, 12. September 2025 lädt die
Evangelische Kirchengemeinde Duisburg Obermeiderich in das
Gemeindezentrum an der Emilstraße 27 zu „Emils Pub“ ein. Bei dem
beliebten Gemeindetreffpunkt können Besucherinnen und Besucher ab 19
Uhr bei Getränken aller Art und gutem Essen zum Wochenende hin ein
wenig abschalten und beim Klönen über Gott, die Welt, den Krieg und
den Frieden ins Gespräch kommen.
Diesmal gibt’s Kässpätzle,
Krautspätzle mit Speck, Krautsalat und natürlich einen leckeren
Nachtisch. Der Durst kann wie immer mit verschiedenen Biersorten,
Wein und Softgetränken gelöscht werden. Infos zur Gemeinde gibt es
im Netz unter www.obermeiderich.de.
Pfarrerin Lahann am nächsten Freitag in der
Kircheneintrittsstelle
Immer freitags können Unsichere,
Kirchennahe oder solche, die es werden möchten, in der
Eintrittsstelle in der Salvatorkirche mit Pfarrerinnen, Pfarrern und
Prädikanten ins Gespräch kommen. Motive für den Kircheneintritt gibt
es viele: Die Suche nach Gemeinschaft, Ordnung ins Leben bringen
oder der Wunsch, Taufen, Hochzeiten, Bestattungen kirchlich zu
gestalten.
Aufnahmegespräche führt das Präsenzteam in der
Eintrittsstelle an der Salvatorkirche immer freitags von 14 bis 17
Uhr. Am Freitag, 5. September 2025 heißt Krankenhauspfarrerin Dörthe
Lahann Menschen in der Südkapelle des Gotteshauses neben dem Rathaus
herzlich willkommen. Infos zur Citykirche gibt es unter
www.salvatorkirche.de.

13,4 Millionen Erwerbspersonen erreichen in den nächsten
15 Jahren das gesetzliche Rentenalter
• Mit dem
Ausscheiden der Babyboomer geht dem Arbeitsmarkt knapp ein Drittel
der heutigen Erwerbspersonen verloren
• Jüngere Altersgruppen
werden ältere zahlenmäßig nicht ersetzen
• Erwerbstätigenquote
älterer Menschen steigt stärker als in anderen Altersgruppen
Die Generation der Babyboomer spielt im Zusammenhang mit der
Entwicklung des Arbeitskräfteangebots in Deutschland eine wichtige
Rolle. Innerhalb von 15 Jahren werden die zahlenmäßig stärksten
Jahrgänge in den Ruhestand gegangen sein. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) auf Basis des Mikrozensus 2024 mitteilt, werden
bis 2039 rund 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche
Renteneintrittsalter von 67 Jahren überschritten haben. Das
entspricht knapp einem Drittel (31 %) aller Erwerbspersonen, die dem
Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr zur Verfügung standen.
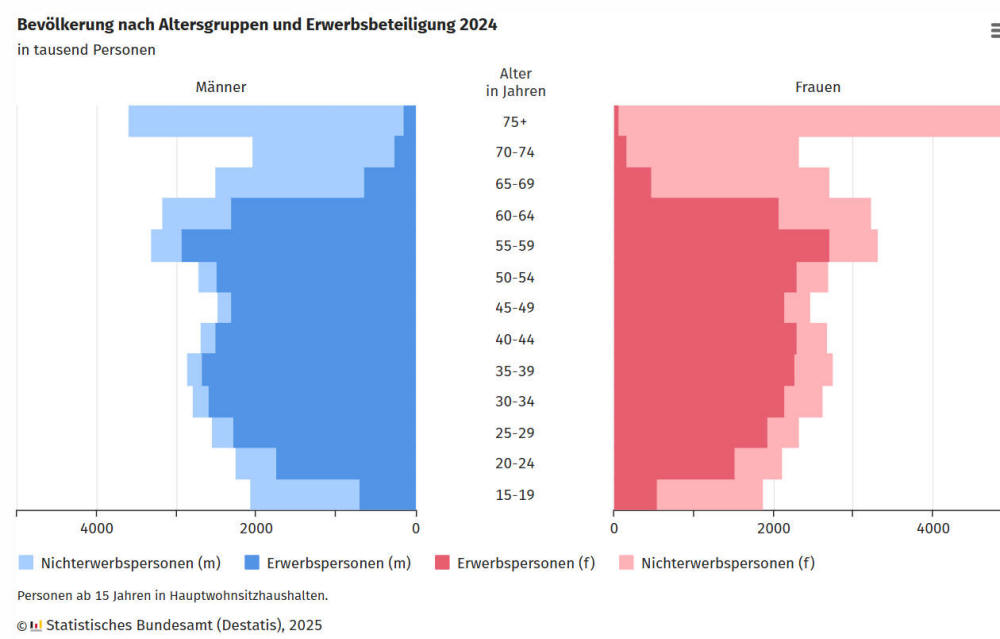
Jüngere Altersgruppen werden die Babyboomer zahlenmäßig nicht
ersetzen können. Obwohl die 60- bis 64-Jährigen bereits im Übergang
zum Ruhestand waren, stellten sie im Jahr 2024 noch
4,4 Millionen Erwerbspersonen. Das entsprach einer Erwerbsquote von
68 % in dieser Altersgruppe. Von den jüngeren Babyboomern im Alter
von 55 bis 59 Jahren war ein deutlich höherer Anteil (85 %) noch am
Arbeitsmarkt aktiv.
Mit 5,6 Millionen stellten sie über alle
Altersgruppen hinweg die meisten Erwerbspersonen. Beide
Altersgruppen umfassten zusammen 10,0 Millionen Erwerbspersonen und
damit mehr als die jüngeren Altersgruppen bis 54 Jahre. Zwar hatten
sowohl die 45- bis 54-Jährigen als auch die 35- bis 44-Jährigen mit
90 % beziehungsweise 89 % die höchsten Erwerbsquoten, allerdings
reichte die Zahl der Erwerbspersonen mit 9,3 beziehungsweise
9,8 Millionen nicht ganz an die der Babyboomer heran.
Auch
die 25- bis 34-Jährigen lagen mit 9,0 Millionen Erwerbspersonen
deutlich unter der Zahl der Babyboomer. Gleiches galt für die beiden
jüngsten Altersgruppen unter 25 Jahren, die sich teilweise noch in
ihrer Ausbildungsphase befanden und erst nach Abschluss ihrer
Ausbildung vollumfänglich für den Arbeitsmarkt aktiviert werden
könnten.
Erwerbstätigenquote älterer Menschen seit 2014 um
10 Prozentpunkte gestiegen
Um dem künftigen Arbeitskräftemangel
zumindest kurzfristig entgegenzuwirken, wird diskutiert, die
geburtenstarken Jahrgänge umfassender im Berufsleben zu halten oder
dafür zu reaktivieren. Die Erwerbstätigenquote von älteren Menschen
ist in den vergangenen zehn Jahren bereits gestiegen: Während 2014
knapp zwei Drittel (65 %) der 55- bis 64-Jährigen einer
Erwerbstätigkeit nachging, waren es 2024 bereits drei Viertel
(75 %). Das entspricht einer Steigerung von 10 Prozentpunkten.
Damit ist die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen
deutlich stärker gestiegen als in jüngeren Altersgruppen. Bei den
15- bis 24-Jährigen nahm sie im selben Zeitraum um 5 Prozentpunkte
auf zuletzt 51 % zu. Am geringsten fiel die Steigerung bei den 25-
bis 54-Jährigen aus: Hier stieg die Erwerbstätigenquote von 83 % im
Jahr 2014 auf 85 % im Jahr 2024.
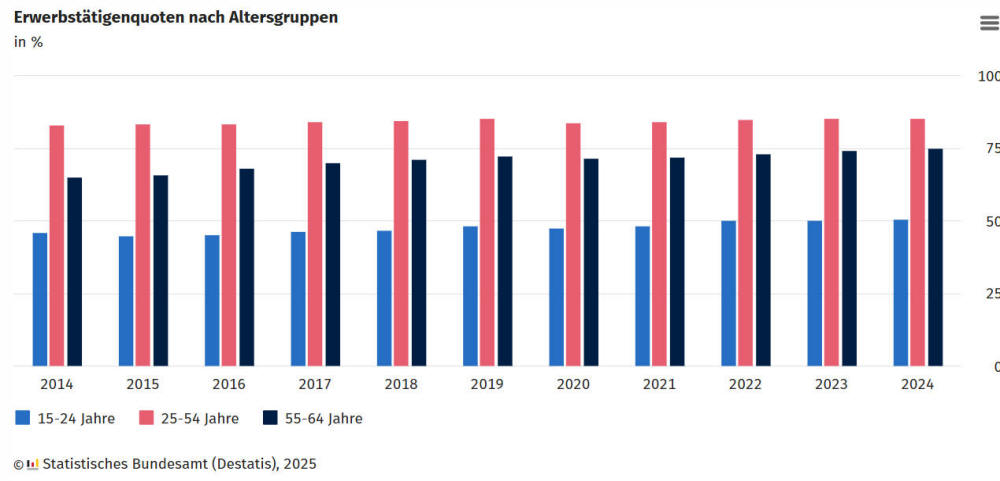
Großteil der Erwerbstätigen geht weiterhin vorzeitig in
Ruhestand
Trotz der zunehmenden Erwerbstätigkeit älterer
Menschen, gehen nach wie vor viele von ihnen vorzeitig in den
Ruhestand. Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen von
gesundheitlichen Einschränkungen über versicherungsrechtliche
Besonderheiten wie langjährige Beitragszahlungen oder
Frühverrentungsangeboten von Unternehmen bis hin zum Wunsch nach
mehr Freizeit.
Waren mit 58 Jahren im vergangenen Jahr noch
82 % (2014: 74 %) erwerbstätig, lag die Quote bei den 60-Jährigen
bereits bei 79 % (2014: 69 %). Ab 62 Jahren nimmt die
Erwerbstätigkeit deutlicher ab: 70 % (2014: 56 %) gingen in diesem
Alter einer Erwerbstätigkeit nach, mit 64 Jahren waren es noch 46 %
(2014: 33 %). Mit 66 beziehungsweise 68 Jahren war ein Großteil der
Erwerbstätigen aus dem Berufsleben ausgeschieden: Die entsprechenden
Erwerbstätigenquoten lagen im vergangenen Jahr bei 22 % (2014: 15 %)
und 16 % (2014: 11 %).
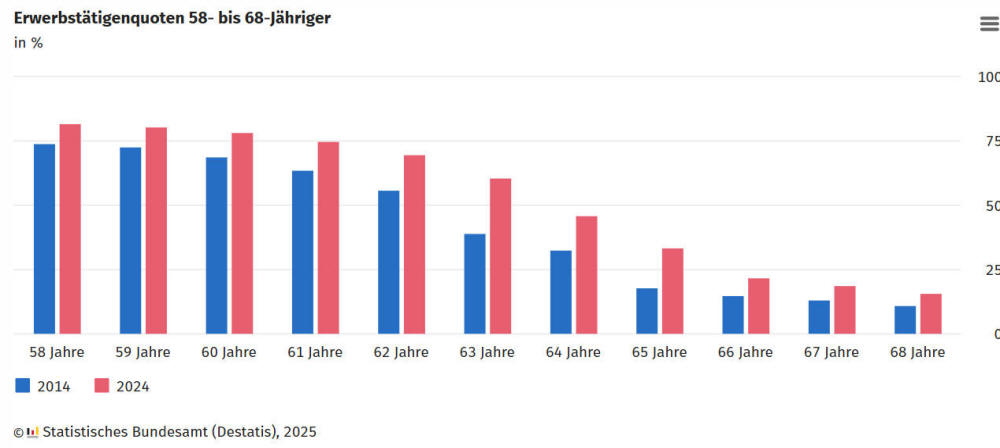
Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer 2024 um 12,3
% auf 13,3 Milliarden Euro gestiegen
• Festgesetzte
Erbschaft- und Schenkungsteuer erreicht neuen Höchstwert
• 27,9
% weniger Betriebsvermögen übertragen
• Vermögensübertragungen
durch Erbschaften um 4,8 % gestiegen, durch Schenkungen um 18,6 %
gesunken
Im Jahr 2024 haben die Finanzverwaltungen in
Deutschland Erbschaft- und Schenkungsteuer in Höhe von 13,3
Milliarden Euro festgesetzt. Die festgesetzte Erbschaft- und
Schenkungsteuer stieg damit 2024 gegenüber dem Vorjahr um 12,3 % auf
einen neuen Höchstwert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, entfielen dabei auf die festgesetzte Erbschaftsteuer 8,5
Milliarden Euro und damit 9,5 % mehr als im Vorjahr. Nachdem die
Erbschaftsteuer im Jahr 2021 einen Spitzenwert von 9,0 Milliarden
erreicht hatte, sank sie in den folgenden Jahren und stieg 2024
erstmals wieder an.
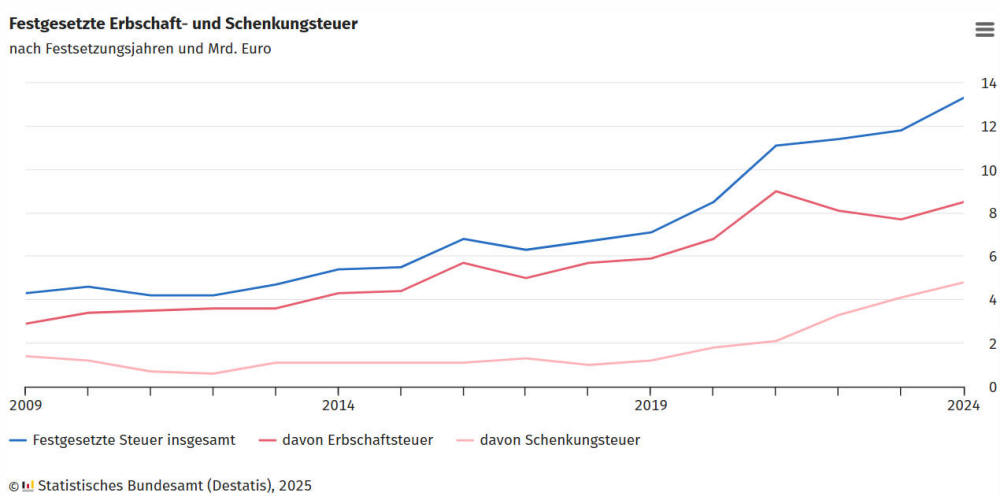
Die festgesetzte Schenkungsteuer erreichte 2024 mit
4,8 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert und stieg gegenüber dem
Vorjahr um 17,8 % an. Sie steigt somit seit 2019 kontinuierlich an
und hat sich seit 2021 mehr als verdoppelt.
Übertragenes
Betriebsvermögen sinkt im Vorjahresvergleich deutlich
Im Jahr
2024 wurden Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen
in Höhe von 113,2 Milliarden Euro veranlagt. Das steuerlich
berücksichtigte geerbte und geschenkte Vermögen sank damit 2024
gegenüber dem Höchstwert im Vorjahr um 6,8 %.
Die im
Vorjahresvergleich niedrigeren Veranlagungen der Erbschaften und
Schenkungen beruhen unter anderem auf geringeren
Vermögensübertragungen von Betriebsvermögen mit 21,5 Milliarden
(-27,9 %). Darunter halbierte sich das übertragene Betriebsvermögen
im Wert von über 26 Millionen Euro (sogenannte Großerwerbe) auf
8,6 Milliarden Euro (-49,7 %) im Jahr 2024.
Des Weiteren
wurden mit 7,4 Milliarden Euro 28,7 % weniger Anteile an
Kapitalgesellschaften veranlagt als im Vorjahr. Hingegen erhöhten
sich im Vergleich zum Vorjahr das übertragene Grundvermögen
(unbebaute und bebaute Grundstücke) auf 46,4 Milliarden Euro
(+1,7 %), das restliche übrige Vermögen (zum Beispiel Bankguthaben,
Wertpapiere, Anteile und Genussscheine) auf 37,8 Milliarden Euro
(+1,8 %) sowie das land- und forstwirtschaftliche Vermögen auf
1,6 Milliarden Euro (+6,7 %).
Aus der Gesamtsumme des
übertragenen Vermögens von 114,7 Milliarden Euro ergibt sich nach
Berücksichtigung von Nachlassverbindlichkeiten und sonstigem Erwerb
(Erwerb durch Vermächtnisse, Verträge zugunsten Dritter, geltend
gemachte Pflichtteilansprüche etc.) das steuerlich berücksichtigte
Vermögen von 113,2 Milliarden Euro.
4,8 % mehr übertragenes
Vermögen durch Erbschaften und 18,6 % weniger durch Schenkungen
Im Jahr 2024 nahm das steuerlich berücksichtigte Vermögen durch
Erbschaften und Vermächtnisse im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 % auf
64,1 Milliarden Euro zu. Hier wurden unter anderem
33,1 Milliarden Euro übriges Vermögen (+3,1 %), 27,4 Milliarden Euro
Grundvermögen (+4,0 %) und 0,6 Milliarden Euro land- und
forstwirtschaftliches Vermögen (+7,0 %) übertragen.
Das
veranlagte geerbte Betriebsvermögen sank im Vergleich zum Vorjahr um
3,0 % auf 4,8 Milliarden Euro. Darunter sank das übertragene geerbte
Betriebsvermögen über 26 Millionen Euro (Großerwerbe) auf
1,2 Milliarden Euro (-13,9 %). Die Vermögensübertragungen durch
Schenkungen sind hingegen um 18,6 % auf 49,1 Milliarden Euro im Jahr
2024 gesunken.
Insbesondere Anteile an Kapitalgesellschaften
mit 5,5 Milliarden Euro (-34,1 %) und geschenktes Betriebsvermögen
mit 16,7 Milliarden Euro (-32,9 %) wurden im Vergleich zum Vorjahr
weniger veranlagt. Darunter hat sich das übertragene geschenkte
Betriebsvermögen über 26 Millionen Euro (Großerwerbe) 2024 im
Vergleich zum Vorjahr auf 7,4 Milliarden Euro (-53,0 %) halbiert.
Darüber hinaus wurden im Jahr 2024 Grundvermögen von
19 Milliarden Euro (-1,4 %) und restliches übriges Vermögen in Höhe
von 6,6 Milliarden Euro (-6,6 %) festgesetzt. Lediglich das
geschenkte land- und forstwirtschaftliche Vermögen stieg im
Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2024 auf 1,0 Milliarden Euro (+6,5 %)
an. Steuerbegünstigungen nach § 13a ErbStG im Vorjahresvergleich
gesunken Steuerbegünstigungen nach § 13a Erbschaftsteuer- und
Schenkungssteuergesetz (ErbStG) gehören neben den Freibeträgen zu
den wertmäßig größten Abzugspositionen bei der Berechnung der
Erbschaft- und Schenkungsteuer.
Neben übertragenem
Betriebsvermögen werden die Steuerbegünstigungen nach § 13a ErbStG
auch auf Anteile an Kapitalgesellschaften sowie auf land- und
forstwirtschaftliches Vermögen gewährt. Die Steuerbegünstigungen
nach § 13a ErbStG wurden im Jahr 2024 bei den Erbschaften mit
4,0 Milliarden Euro (-1,5 % zum Vorjahr) und bei den Schenkungen mit
13,1 Milliarden Euro (-47,1 % zum Vorjahr) berücksichtigt. Nachdem
die Steuerbegünstigungen nach § 13a ErbStG bei Schenkungen im Jahr
2023 deutlich gestiegen waren, erreichten sie 2024 fast wieder das
Niveau des Jahres 2022.