






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 42. Kalenderwoche:
17. Oktober
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Samstag, 18., Sonntag, 19. Oktober 2025
Grünen-Bundesvorsitzender Felix Banaszak:
Rückenwind für unsere Stahlstandorte
Die Stahlindustrie
steht mit dem Rücken zur Wand. Die globale Konkurrenz ist brutal:
China flutet die Märkte mit Dumping-Stahl, die USA schotten sich ab,
und in Deutschland herrscht energie- und industriepolitische
Unsicherheit. Die EU-Kommission hat nun endlich höhere Schutzzölle
und Buy-European-Regeln für grünen Stahl auf den Weg gebracht.

Felix Banaszak
Die Bundesregierung hatte daran aber keinen substanziellen
Anteil und bleibt weiterhin nur passiver Zuschauer. Offenbar stehen
Friedrich Merz und seine Wirtschaftsministerin Katherina Reiche der
Branche mit großer Skepsis und Distanz gegenüber. Im
Bundestagswahlkampf hat Friedrich Merz noch die Transformation zu
grünem Stahl in Frage gestellt.
Die Klimaschutzverträge
mussten wir gegen Katherina Reiche verteidigen. Die Bundesregierung
muss endlich klare Rahmenbedingungen für den Umbau zur
klimafreundlichen Produktion schaffen. Es steht viel auf dem Spiel:
80.000 gut bezahlte Arbeitsplätze, Klimaschutz, unsere
wirtschaftliche Souveränität und letztlich auch unser
gesellschaftlicher Zusammenhalt. Damit der grüne Stahl „made in
Duisburg“ eine Zukunft hat, lege ich als Duisburger Abgeordneter mit
meiner Fraktion einen Plan für die Stärkung der Stahlindustrie vor.
Die Debatte im Deutschen Bundestag können Sie/kannst Du
heute Abend um 20:15 Uhr live auf
bundestag.de verfolgen. Konkret geht es darum: Faire
Wettbewerbsbedingungen schaffen: Wir brauchen dringend Schutzzölle
gegen Dumping-Stahl aus China und eine klare Umsetzung der
„Buy-European“-Regeln für grünen Stahl Stahlstandort Deutschland
klimafest machen: Der Wasserstoff-Hochlauf muss schneller
vorangehen.
Gleichzeitig brauchen wir mehr erneuerbare
Energien und einen Brückenstrompreis, damit Unternehmen
Planungssicherheit haben. Grüne Leitmärkte schaffen: Mit einer
Mindesquote für grünen Stahl in der öffentlichen Beschaffung
schaffen wir Nachfrage und beschleunigen den Übergang zur
klimaneutralen Produktion.
Arbeitsplätze sichern: Wir wollen
die öffentliche Förderung an Kriterien wie Tarifbindung,
Standortgarantien und starke Mitbestimmung knüpfen. Beschäftigte
wollen wir mit einem umfassenden Qualifizierungsprogramm zur Aus-
und Weiterbildung unterstützen, um Arbeitsplätze zu sichern.
Bürgergespräch mit Oberbürgermeister Sören Link
Oberbürgermeister Sören Link möchte am Dienstag, 4. November,
mit Duisburgerinnen und Duisburgern ins Gespräch kommen. Termine
können am Mittwoch, 22. Oktober, angefragt werden. Interessierten
Bürgerinnen und Bürgern steht hierfür das an diesem Tag
freigeschaltete Kontaktformular unter www.duisburg.de/dialog zur
Verfügung.
Eine telefonische Kontaktaufnahme ist von 8.30
bis 16 Uhr unter (0203) 283- 6111 ebenfalls möglich.
Neue Staffel "Feuer & Flamme" kommt aus Duisburg
Staffel elf der erfolgreichen WDR-Dokutainmentreihe "Feuer &
Flamme" kehrt zurück nach Duisburg: Zehn neue Folgen rund um die
Brandbekämpfer aus der Ruhrgebietsstadt flimmern ab dem 4. März 2026
jeweils donnerstags um 20.15 Uhr über den Bildschirm. Zahlreiche
Brandeinsätze fordern die Duisburger Feuerwehr – vom Kaminbrand über
Küchenbrände bis hin zu einem Wohnungsvollbrand mit Menschenleben in
Gefahr.
Auch die Luftrettung spielt wieder eine zentrale
Rolle: Die Crew des Christoph 9 nimmt das Publikum mit zu
emotionalen und dramatischen Einsätzen. Daneben gibt es aber auch
Eindrücke aus der Duisburger Wache, in der beim Plätzchenbacken
Weihnachtsstimmung aufkommt. Im dazugehörigen Podcast in der
ARD-Audiothek berichten die Duisburger Feuerwehrleute authentisch
über ihre Einsätze. idr
Inbetriebnahme barrierefrei
ausgebauter Haltestelle „Stockumer Straße“ verzögert
Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) arbeitet gemeinsam mit
der Stadt Duisburg an der Modernisierung der Infrastruktur für einen
zukunftsfähigen ÖPNV. In den vergangenen Jahren haben DVG und Stadt
durch den Ausbau barrierefreier Haltestellen, die Modernisierung von
Gleisen, Fahrtreppen und Fahrleitungen sowie den Neubau von
Haltestellen bereits viel erreicht.
Seit Anfang September
baut die DVG die Straßenbahnhaltestelle „Stockumer Straße“ der Linie
901 barrierefrei aus. Das Ende der Bauarbeiten war bis zum 19.
Oktober geplant. Aufgrund einer Verzögerung ist die Inbetriebnahme
der barrierefrei ausgebauten Haltestelle nun für den 29. Oktober im
Tagesverlauf vorgesehen. Die DVG wird deshalb ab dem 21. Oktober im
Laufe des Vormittags bis zur Inbetriebnahme der Haltestelle
„Stockumer Straße“ zwei Ersatzhaltestellen einrichten.
In
Fahrtrichtung Laar wird die Ersatzhaltestelle “Stockumer Straße“ auf
der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 245 eingerichtet.
In Fahrtrichtung Beeck erfolgt die Einrichtung der Ersatzhaltestelle
„Stockumer Straße“ auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der
Hausnummer 268.
Neue Werte für die kommenden drei Monate IMK
Konjunkturindikator: Rezessionsrisiko kaum gestiegen – Aussichten
auf Erholung bleiben intakt
Trotz starker Belastungen,
insbesondere durch die amerikanische und die chinesische
Wirtschaftspolitik, sind die Chancen relativ hoch, dass die deutsche
Wirtschaft im Schlussquartal 2025 leicht wächst. Das signalisiert
der monatliche Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie
und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.
Für
den Zeitraum von Oktober bis Ende Dezember weist der Indikator, der
die neuesten verfügbaren Daten zu den wichtigsten wirtschaftlichen
Kenngrößen bündelt, eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 34,8
Prozent aus. Das ist zwar etwas mehr als Anfang September, damals
betrug sie für die folgenden drei Monate 33,7 Prozent. Leicht erhöht
hat sich auch die statistische Streuung im Indikator, die eine
Verunsicherung von Wirtschaftsakteuren widerspiegelt.
Die
Anstiege sind aber nicht so stark, dass der nach dem Ampelsystem
arbeitende Indikator von „gelb-rot“ auf „rot“ schalten würde. Der
Indikator signalisiert damit wie im Vormonat „konjunkturelle
Unsicherheit“, aber keine akute Rezessionsgefahr für die kommenden
drei Monate. „Wir haben in den letzten Wochen einige schlechte
Konjunkturnachrichten gesehen, vor allem beim schwachen Export nach
Übersee. Die sind natürlich relevant, aber zum Glück ist der
Außenhandel nicht alles.
Die Aussichten auf eine
schrittweise wirtschaftliche Erholung bleiben trotz einiger
Eintrübungen erhalten“, sagt Prof. Dr. Sebastian Dullien, der
wissenschaftliche Direktor des IMK. „Klar ist zwar: Auch in den
kommenden Monaten kann die deutsche Wirtschaft nicht darauf hoffen,
wie früher vom Export aus der Krise gezogen zu werden. Dazu dämpfen
die US-Zölle sowie die aggressive Industriepolitik Chinas den
Außenhandel zu stark. Aber es besteht Hoffnung auf einen
binnenwirtschaftlich getriebenen Aufschwung.
Mit dem
Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz sorgt die
Bundesregierung für mehr Dynamik bei den Investitionen, die vor
allem 2026 wirken wird. Extrem wichtig ist jetzt, dass die Politik
ihre Impulse nicht wieder konterkariert, indem sie das langsam
wachsende Konsumvertrauen der Verbraucher*innen ausbremst.

Zugespitzte Debatten über Kürzungen, etwa bei der sozialen
Sicherung, schädigen dieses Vertrauen, und sie sind unnötig. Denn
die Sozialstaatsfinanzierung ist weitaus stabiler als etwa
Äußerungen des Bundeskanzlers Glauben machen“, sagt Dullien.
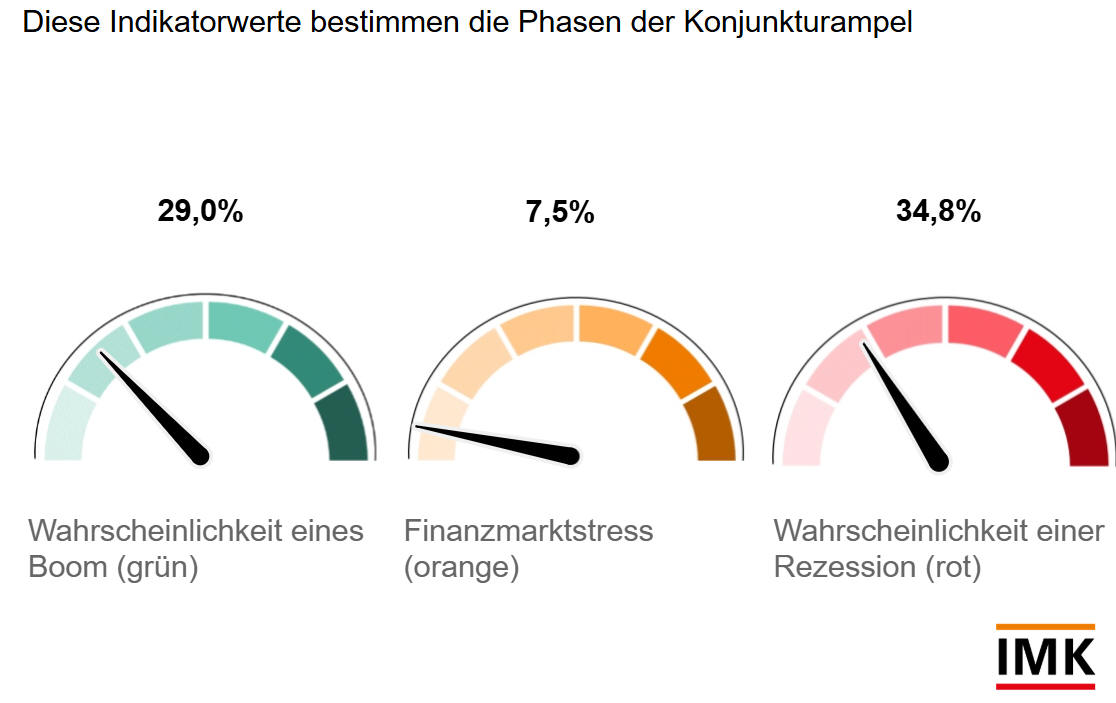
Die aktuelle leichte Zunahme des Rezessionsrisikos beruht in
erster Linie auf realwirtschaftlichen Indikatoren, vor allem auf den
Rückgängen bei Industrieproduktion und Auftragseingängen aus dem
außereuropäischen Ausland, hinzu kommt, dass der ifo-Index zuletzt
leicht gesunken ist.
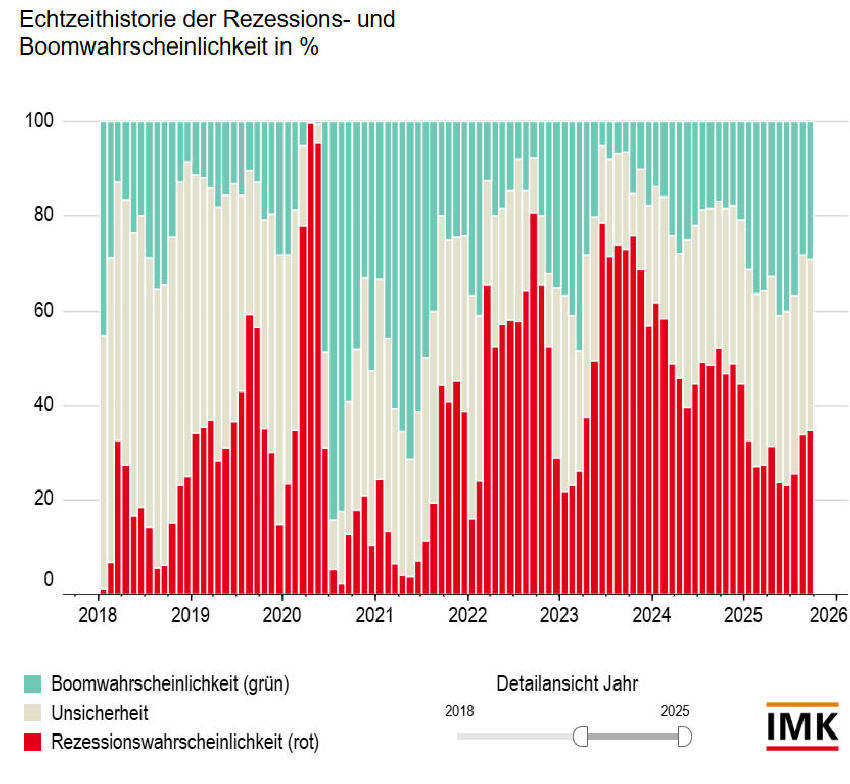
Positiver ist der Trend bei Finanzmarktindikatoren – er verhindert,
dass die Rezessionswahrscheinlichkeit stärker zugenommen hat. Auch
der Index für die LKW-Fahrleistung, der als Frühindikator für die
Produktion gilt, wies zuletzt leicht nach oben. In der Gesamtschau
prognostiziert das IMK weiterhin ein Mini-Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2 Prozent in diesem Jahr. Für 2026
erwarten die Konjunkturforscher*innen in ihrer aktuellen
Konjunkturprognose eine spürbare Erholung und eine BIP-Zunahme um
1,4 Prozent.**
Führerscheinreform:
Verkehrssicherheit und Führerscheinkosten dürfen nicht gegeneinander
ausgespielt werden
Zu der am 16. OKtober 2025 von
Bundesverkehrsminister Schnieder angekündigten Reform des
Führerscheinrechts erklärt Deutscher
Verkehrssicherheitsrat-Präsident Manfred Wirsch: „Wir haben konkrete
Vorschläge, die den Aufwand und damit auch die Kosten der
Führerscheinausbildung abmildern. Aber an die Adresse der Politik
sage ich ganz klar: Der Spielraum ist begrenzt. Die Diskussion zur
Bezahlbarkeit des Führerscheinerwerbs darf nicht auf Kosten der
Sicherheit geführt werden.“
Konkret empfiehlt der DVR, in
einzelnen Ausbildungsabschnitten Simulatoren zuzulassen.
Fahrschülerinnen und Fahrschüler können damit das manuelle Schalten
eines Fahrzeuges erlernen. Auch maximal zwei der fünf
vorgeschriebenen besonderen Ausbildungsfahrten à 45 Minuten
außerhalb geschlossener Ortschaften auf Bundes- oder Landstraßen
könnten im Simulator erfolgen.
Voraussetzung dafür ist, dass
dies nach einem anerkannten pädagogischen Ausbildungskonzept für die
Schulung von sicheren Überholmanövern auf einem technisch geeigneten
Fahrsimulator durchgeführt wird. Elemente des Theorieunterrichts
auch digital zu ermöglichen, bietet ebenfalls Potentiale, wenn auch
nur in einem begrenzten Umfang.
„Wir brauchen eine
abwechslungsreiche, an die Schüler individuell angepasste
Unterrichtsgestaltung mit klaren Schwerpunkten“, fordert Wirsch,
„dies verringert die Wahrscheinlichkeit einer Überforderung der
Fahrschülerinnen und Fahrschüler während des Ausbildungszeitraums.“
Der DVR fordert hierfür ein transparentes
Ausbildungscurriculum. Dazu gehören Lernstandserfassungen und
-kontrollen. Der DVR sieht zudem einen Prüfbedarf, ob die Anzahl zu
absolvierender Grundfahraufgaben durch geeignete Alternativübungen
reduziert werden könnte.
„Was keine Unterstützung durch uns
findet, sind Abstriche bei der professionellen Fahrausbildung –
Möglichkeiten einer Laienausbildung wurden aus gutem Grund bereits
1986 abgeschafft“, so Manfred Wirsch. Weiterführende Informationen
DVR-Beschluss „Einsatz von Simulationen in der Fahrausbildung“
Über den DVR Der DVR ist Deutschlands unabhängiger Vorreiter und
Kompetenzträger in allen Belangen der Straßenverkehrssicherheit.
Mit dem Ziel der Vision Zero („Niemand kommt um, alle kommen
an.“) setzt er sich für die gemeinsame Verantwortung aller
Gesellschaftsgruppen ein, um den Straßenverkehr sicher zu machen.
Durch die hohe Sachkenntnis und die Erfahrung seiner Mitglieder
bildet der DVR ein effizientes Netzwerk für Verkehrssicherheit.
Billig-Kaffeeketten gefährden deutschen Kaffeemarkt
Eine absurde Situation: Die Rohkaffeepreise befinden sich auf einem
historischen Höchststand – was grundsätzlich zu begrüßen ist, da
dies auch zu höheren Einkommen der Kaffeebauern in den Anbauländern
führt. Gleichzeitig schießen Billig-Coffeeshops nach dem Vorbild der
chinesischen Kette „Luckin Coffee“ wie Pilze aus dem Boden. Die
Deutsche Röstergilde, Bundesverband der mittelständischen
Kaffeeröstereien, warnt daher vor einem gefährlichen
Verdrängungswettbewerb und dem Verlust von Arbeitsplätzen.
„Finanziert über Venture-Capital und getrieben durch eine starke
Internetpräsenz, machen die vielen neuen Billig-Coffeeshops den
inhabergeführten Cafés sowie Röstereien mit Gastronomiebetrieb
zunehmend das Leben schwer“, sagt Christian Haase, Vorstandsmitglied
der Deutschen Röstergilde. „Ob sich im Zeitalter von Temu diese Art
der Vollautomaten-Shops auf Dauer als wirtschaftlich tragfähig
erweist, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall werden sie bis dahin
einen nicht unerheblichen Schaden bei kleineren Cafés und beim
Qualitätsverständnis der Konsumenten anrichten.“
Billig-Trend
begann in Metropolen
Der Trend zum Billig-Coffee-to-go für 2,50
Euro begann in den Metropolen und weitet sich immer mehr aus. In den
Metropolen immerhin ist es im Laufe des Jahres gelungen, durch
Aufklärungsarbeit das Bewusstsein der Konsumenten wieder in Richtung
hochwertiger Spezialitätenkaffees zu höheren und fairen Preisen zu
drehen. Dass der Trend zum Billig-Coffee-to-go wirtschaftlichen
Überlegungen der Verbraucher geschuldet sein könnte, liegt zwar
nahe, bleibt aber Spekulation.
„Nur der eigene Anspruch einer
fairen Bezahlung wird hochwertige Kaffeeprodukte sowie das
Fortbestehen der vielen mittelständischen Röstereien und Cafés
langfristig sichern“, so Haase.
Die Deutsche Röstergilde ist
der Bundesverband der mittelständischen Kaffeeröstereien in
Deutschland. Sie setzt sich für nachhaltigen und fairen
Kaffeehandel, die handwerkliche Röstung und höchste Qualität im
Bereich Spezialitätenkaffee ein.
Weniger Menschen im
Ruhrgebiet erhielten 2024 Mindestsicherungsleistungen
Zum Jahresende 2024 haben 725.905 Menschen im Ruhrgebiet Leistungen
der sozialen Mindestsicherung erhalten - knapp 7.000 weniger als im
vorangegangenen Jahr. Das zeigen aktuelle Zahlen des Landesamtes
IT.NRW. Im Vergleich zu 2016 - dem Jahr des Höchststandes in NRW -
sank die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger um mehr als 49.000.
NRW-weit erhielten Ende 2024 insgesamt 1.997.154 Millionen Menschen
Soziale Mindestsicherung.
Das waren rund 9.600
Empfängerinnen und Empfänger weniger als ein Jahr zuvor. Die
Mindestsicherungsquote liegt landesweit konstant bei 11,1 Prozent.
Darunter weist das Ruhrgebiet aber nach wie vor die höchsten
Mindestsicherungsquoten auf. An der Spitze liegt Gelsenkirchen mit
21,7 Prozent Mindestsicherungsquote , so dass dort jede fünfte
Person auf diese Leistungen angewiesen ist. Danach folgen Essen,
Dortmund und Gladbeck mit über 17 Prozent.
Zu den
Mindestsicherungsleistungen zählen: Grundsicherung für
Arbeitsuchende (Bürgergeld nach dem SGB II), Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung (SGB XII) und Hilfe zum Lebensunterhalt
außerhalb von Einrichtungen (SGB XII) sowie Regelleistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). idr
DVG baut die Haltestelle „Brauerei“ barrierefrei aus
Die DVG arbeitet gemeinsam mit der Stadt Duisburg an
der Modernisierung der Infrastruktur für einen zukunftsfähigen ÖPNV.
In den vergangenen Jahren haben DVG und Stadt durch den Ausbau
barrierefreier Haltestellen, die Modernisierung von Gleisen,
Fahrtreppen und Fahrleitungen sowie den Neubau von Haltestellen
bereits viel erreicht. Zudem wird das ÖPNV-Angebot für die Fahrgäste
stetig verbessert.
DVG und Stadt setzen den Weg fort, Bus
und Bahn attraktiver zu machen, um möglichst vielen Menschen mit
einem komfortablen, klimafreundlichen und zuverlässigen ÖPNV eine
echte Alternative zum Auto zu bieten. Deshalb baut die DVG die
Straßenbahnhaltestelle „Brauerei“ der Linie 901 von Dienstag, 21.
Oktober, bis voraussichtlich Mitte November, in Fahrtrichtung
Mülheim barrierefrei aus.
Für die Dauer der Baumaßnahme
entfällt die Haltestelle „Brauerei“ in beide Fahrtrichtungen. Die
DVG bittet die Fahrgäste alternativ die Haltestellen „Stockumer
Straße“ oder „Beeck Denkmal“ zu nutzen. Im Anschluss wird die
Haltestelle in Fahrtrichtung Obermarxloh barrierefrei ausgebaut.
Stadtführung: Historische Spuren im Kantpark
„Mercators Nachbarn“ und das Stadtarchiv Duisburg laden
am Samstag, 18. Oktober, um 15 Uhr zum nächsten Rundgang der
Veranstaltungsreihe „Stadtgeschichte draußen“. Treffpunkt ist vor
dem Eingang des Lehmbruckmuseums. Dieses Mal geht es auf
historischen Spuren durch den Kantpark.
Mit leichtem Ton und
einem Schuss Stadtgeschichte lädt die Führung von Harald Küst von
der Initiative Mercators Nachbarn dazu ein, den Park einmal mit
anderen Augen zu sehen: „Warum trägt er den Namen eines Philosophen,
der nie hier war? Was hat ein Statiker mit dem Lehmbruckmuseum zu
tun? Welche berühmten Schüler hat das Steinbart hervorgebracht. Und
wo ist eigentlich die Dampflok geblieben, auf der ganze Generationen
Duisburger Kinder gespielt haben?“
An acht Stationen
entfalten sich Episoden über Bildung, Kultur und Erinnerung – eine
lebendige Zeitreise durch den Park. Ein Spaziergang für alle, die
den Kantpark lieben – oder ihn neu entdecken möchten. Die Teilnahme
ist kostenfrei.
Mercator Matinée: Piraten. Von der
Antike bis heute
Das Kultur- und Stadthistorische
Museum lädt am Sonntag, 19. Oktober, um 11.15 Uhr zur nächsten
„Mercator Matinée“ ein, welches sich dem Thema „Piraten“ widmet. Der
Historiker Dr. Jann Markus Witt nimmt die Teilnehmenden mit auf eine
spannende Reise durch die Ära der Piraterie: von den Freibeutern des
17. Jahrhunderts bis hin zu den modernen Piraten von heute.
Dabei wird nicht nur das abenteuerliche Leben an Bord, sondern
werden auch die sozialen Strukturen und der politische Hintergrund
beleuchtet. Die Seeräuberei ist fast so alt wie die Seefahrt selbst.
Bis heute entzünden Namen wie Klaus Störtebeker, Francis Drake oder
Henry Morgan die Fantasie vieler Menschen.
In den
Auseinandersetzungen um Kolonien, Märkte und Seeherrschaft nutzten
die beteiligten Mächte jahrhundertelang dieses Mittel, um ihre
Konkurrenten zu schädigen. Um 1700 wurde die Seeräuberei zum ersten
Mal zu einem globalen Problem. Dieses „Goldene Zeitalter der
Piraterie“ dauerte rund 30 Jahre, doch überstieg das Ausmaß der
Verheerungen alles bisher Dagewesene.
Erst als die
europäischen Seemächte, allen voran Großbritannien, die Seeräuber
konsequent verfolgten, bekamen Sie allmählich das Problem in den
Griff. Aber auch heute noch gibt es in zahlreichen Seegebieten
Piraten, die Jagd auf Handelsschiffe machen.
Die Teilnahme
am Matinée beträgt für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.
Reservierungen sind telefonisch (0203/283-2640) oder per E-Mail
(ksm-service@stadt-duisburg.de) möglich. Weitere Informationen gibt
es online unter www.stadtmuseumduisburg.de.
Trauercafé am 19. Oktober im Malteser Hospizzentrum
St. Raphael Duisburg.
Der Verlust eines geliebten
Menschen schmerzt und reißt eine große Lücke in das Leben von
Verwandten und Freunden. Die geschulten und erfahrenen
Mitarbeitenden des Malteser Hospizzentrum St. Raphael bieten
unterschiedliche Beratungsangebote für Hinterbliebene. Die
Trauerberatung ist eine Hilfestellung, den schwierigen Übergang in
ein anderes „Weiter-Leben“ während der Trauerphase zu begleiten und
neue Wege zu finden.
Das Trauercafé findet einmal im Monat
im Malteser Hospizzentrum St. Raphael, Remberger Straße 36, 47259
Duisburg, statt. Der nächste Termin ist am 19. Oktober von 15.00 bis
16.30 Uhr. Menschen, die nahe stehende Angehörige oder Freunde
verloren haben, können sich hier für die bevorstehenden Wochen
stärken und ihre Erfahrungen mit anderen Betroffenen austauschen.
Begleitet wird das Trauercafé von den geschulten und erfahrenen
Mitarbeitenden des Malteser Hospizzentrum St. Raphael. Eine
Anmeldung für das Trauercafé ist nicht notwendig.
PLACE TO BE: Fotografien Sven Kierst am
18.10.25 im Kolumbarium Rheinkirche in Duisburg

Ausstellungseröffnung mit Künstler-Gespräch und
Begleitprogramm
Die Fotoarbeiten von Sven Kierst
beschäftigen sich mit der zu entdeckenden Eigenästhetik des
scheinbar Unauffälligen und Belanglosen. So ergeben sich Motive, die
zwischen figurativer und abstrakter Bildkomposition wechseln. Sie
entfernen sich dadurch vom ursprünglichen Zustand und sind davon
befreit. 
Kierst
liefert Suggestion als Anregung - nicht als Behauptung. Um 15.30 Uhr
beginnt unser Künstlergespräch mit Sven Kierst. Danach wird der
kanadische Fingerpicking-Gitarrist Don Alder ein Kurzkonzert geben,
um uns danach dezent im Hintergrund zu begleiten, während wir und
Sven Kierst miteinander reden und jeder die Fotos für sich entdecken
kann.

Fingerpicking-Gitarrist Don Alder
ANMELDUNG
Wollen Sie am Künstlergespräch teilnehmen, so bitten wir um eine
Anmeldung, damit wir besser planen können. Bitte nennen Sie uns auch
die Anzahl der Personen (MAX 4) Telefon: 02066 - 4690 179 (Di-So
11-16 Uhr - montags geschlossen) E-Mail:
veranstaltung@kolumbarium-rheinkirche.de Nach einer Anmeldung
per Mail erhalten Sie eine Bestätigung.
OHNE ANMELDUNG sind Sie
selbstverständlich auch als Spontanbesucher der Ausstellung
willkommen.
Foto-Spenden-Aktion der Gemeinde
Meiderich zugunsten der Kindernothilfe
Hoffnung zeigen, Hoffnung schenken Die Fotoaktion
„Hoffnung zeigen – Hoffnung schenken!“ der Evangelischen
Kirchengemeinde Meiderich hat viele Menschen bewegt und begeistert.
Sie war ein voller Erfolg, findet Gemeindesekretärin Katja Hüther,
die sich mit dem Team der Gemeinde über die vielen kreativen
Einsendungen freute: Fotos voller Farbe, Symbolkraft und
persönlicher Geschichten.
Von Regenbögen über Lichter im
Dunkel bis hin zu Friedenszeichen – jedes einzelne Bild erzählte auf
seine Weise von Zuversicht, Vertrauen und der Kraft der Hoffnung.
Bis zum Einsendeschluss am 15. September sind zahlreiche
Hoffnungszeichen eingegangen, die inzwischen die Fenster des
Gemeindezentrums schmücken. Entstanden ist eine eindrucksvolle
Ausstellung, die zeigt, wie vielfältig und lebendig Hoffnung
aussehen kann.
Doch nicht nur die Bilder bringen Licht in
die Welt: Dank vieler großzügiger Spenden konnte die Kirchengemeinde
am 16. Oktober 300 Euro an Petra Kalkowski von der Kindernothilfe
übergeben. Damit wird die wertvolle Arbeit für benachteiligte Kinder
weltweit unterstützt. Seit 2020 setzt sich die Gemeinde immer wieder
mit Projekten und Aktionen für die Kindernothilfe ein – und auch
diese Fotoaktion reiht sich in diese schöne Tradition ein.
Die Bilder sind noch bis Dezember im Gemeindezentrum Meiderich zu
sehen. „Ein Spaziergang vorbei an den Fotos der Hoffnung lohnt
sich!“ sagt Katja Hüther. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.kirche-meiderich.de.

Das Meidericher Team, das die Fotoaktion organisiert hat. Rechts
neben Pfarrer Frank Hufschmid mit dem Scheck in der Hand ist Petra
Kalkowski von der Kindernothilfe zu sehen, die den Scheck gerne
entgegen nahm (Foto: www.kirche-meiderich.de).
Singkreis feiert Geburtstag in der
Gnadenkirche Wanheimerort
Wenn ein Singkreis Geburtstag
hat, kann das nur mit viel Musik gefeiert werden. Genau so passiert
das am Sonntag, 19. Oktober in der Gnadenkirche Wanheimerort um
10.30 Uhr, denn der Singkreis der Evangelischen Rheingemeinde
Duisburg ist 10 Jahre alt geworden, zeigt unter Leitung von Beate
Hölzl im kleinen Jubiläumsgottesdienst sein Können und lädt mit
Pfarrer Almuth Seeger alle zum Mitsingen ein. Dass beim
anschließenden Kirchencafé das ein oder andere Lied angestimmt wird,
ist nicht ausgeschlossen.
Schwofen im Gemeinde-Café Dreivierteltakt in Wanheimerort
Die Evangelische Rheingemeinde Duisburg öffnet zum
Monatsausklang das „Café Dreivierteltakt“, bei dem Seniorinnen und
Senioren zu Kaffee, Tee und Kuchen zusammenkommen, die Begleit-Musik
genießen und dazu tanzen. Für den guten Ton sorgt Frank Rohde -
Foto: Maria
Hönes - , der zu seinem Spiel an der elektronischen Orgel
auch singt. 
Es
gibt dabei nicht nur Klänge im Dreivierteltakt, doch alle Lieder
haben Rhythmus und sind vielen bekannt. Das nächste
gesellig-musikalische Treffen im Beratungs- und Begegnungszentrum
(BBZ) Wanheimerort, Paul-Gerhardt-Straße 1, ist am Samstag, 18.
Oktober 2025 um 15 Uhr. Bei sieben Euro Eintritt sind Kaffee und
Kuchen inbegriffen; Anmeldungen sind bei Maria Hönes telefonisch
möglich (Tel.: 0203 770134).

NRW: Etwa jeder Neunte bezog 2024 Leistungen der
sozialen Mindestsicherung
* Fast 2 Millionen Menschen
erhielten zum Jahresende 2024 soziale Mindestsicherung. *
Mindestsicherungsquote der letzten 10 Jahre zwischen 11 und 12 %.
* Erneuter Anstieg bei Leistungen zur Grundsicherung im Alter.
Zum Jahresende 2024 haben 1.997.154 Millionen Menschen in
Nordrhein-Westfalen Leistungen der sozialen Mindestsicherung
erhalten; das sind etwa jeder Neunte oder 11,1 % der Bevölkerung.
Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches
Landesamt mitteilt, waren es rund 9.600 bzw. 0,5 % Empfängerinnen
und Empfänger weniger als ein Jahr zuvor.
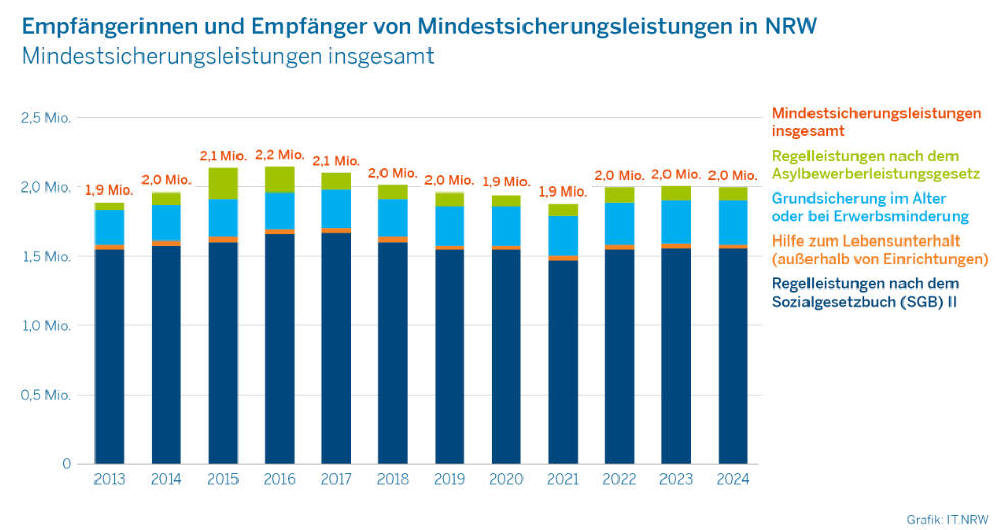
Die Mindestsicherungsquote lag in den letzten 10 Jahren zwischen
11 und 12 % Gegenüber dem Vorjahr blieb die Mindestsicherungsquote
2024 konstant bei 11,1 %. In den letzten 10 Jahren schwankte die
Quote zwischen 11,0 und 12,0 %. Im Jahr 2016 gab es einen
Höchststand mit einer Mindestsicherungsquote von 12,0 % bzw.
2,15 Millionen betroffenen Menschen.
Erneuter Anstieg bei
der Grundsicherung im Alter und stärkster Rückgang bei
Asylbewerberleistungen und Bürgergeld Betrachtet man die einzelnen
Leistungsarten, so ist die Inanspruchnahme der Grundsicherung im
Alter mit +6,4 % bzw. +11.760 das vierte Jahr in Folge auf 321.050
Empfängerinnen und Empfänger gestiegen. Der stärkste Rückgang war
mit −14,6 % bzw. −15.100 bei den Regelleistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz sowie den Empfängerinnen und Empfängern
von Bürgergeld mit −0,4 % bzw. −6.000 zu verzeichnen.
Regionale Unterschiede bei Mindestsicherungsquoten Die höchsten
Mindestsicherungsquoten sind im Ruhrgebiet festzustellen. An der
Spitze liegt Gelsenkirchen mit 21,7 %, so dass dort jede fünfte
Person auf diese Leistungen angewiesen ist. Danach folgen Essen,
Dortmund und Gladbeck mit über 17 %. Zum Jahresende 2024 gab es die
niedrigsten Mindestsicherungsquoten im Kreis Borken in den Gemeinden
Raesfeld (3,7 %) und Südlohn (3,9 %).
Weitere Ergebnisse zum
Thema finden Sie in der Landesdatenbank NRW unter
http://url.nrw/SBE für alle Städte
und Gemeinden. Weitere Ergebnisse finden Sie auf unserer Themenseite
Armut unter
https://statistik.nrw/service/veroeffentlichungen/themenschwerpunkte/armut.
6,3 % der Bevölkerung konnten 2024
aus Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen warm halten
• Anteil gegenüber 2023 gesunken und unter EU-Schnitt von 9,2 %
• Preise für Erdgas im September 2025 um 0,7 % gegenüber
Vorjahresmonat gestiegen
Für einige Menschen in Deutschland
ist ein warmes Zuhause nicht selbstverständlich. Im Jahr 2024 lebten
5,3 Millionen Menschen hierzulande in Haushalten, die nach eigener
Einschätzung ihr Haus oder ihre Wohnung aus finanziellen Gründen
nicht angemessen warm halten konnten. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) auf Basis der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen
(EU-SILC) mitteilt, betraf dies rund 6,3 % der Bevölkerung. Der
Anteil ist gegenüber dem Jahr 2023 zurückgegangen. Damals hatte er
bei 8,2 % gelegen.
EU-weit knapp jede zehnte Person betroffen Mit einem
Bevölkerungsanteil von 6,3 % liegt Deutschland unter dem
EU-Durchschnitt: In der Europäischen Union (EU) waren im vergangenen
Jahr 9,2 % der Bevölkerung nach eigener Einschätzung finanziell
nicht in der Lage, ihre Wohnung angemessen warm zu halten.
Der Anteil ging damit auch EU-weit gegenüber 2023 zurück, als er bei
10,6 % gelegen hatte. Am häufigsten gaben 2024 Menschen in Bulgarien
und Griechenland an, ihren Wohnraum nicht angemessen heizen zu
können: Dort war knapp jede oder jeder Fünfte (19,0 %) betroffen. Es
folgte Litauen mit 18,0 %. Am niedrigsten war der Anteil in Finnland
(2,7 %) sowie in Slowenien und Polen (je 3,3 %).
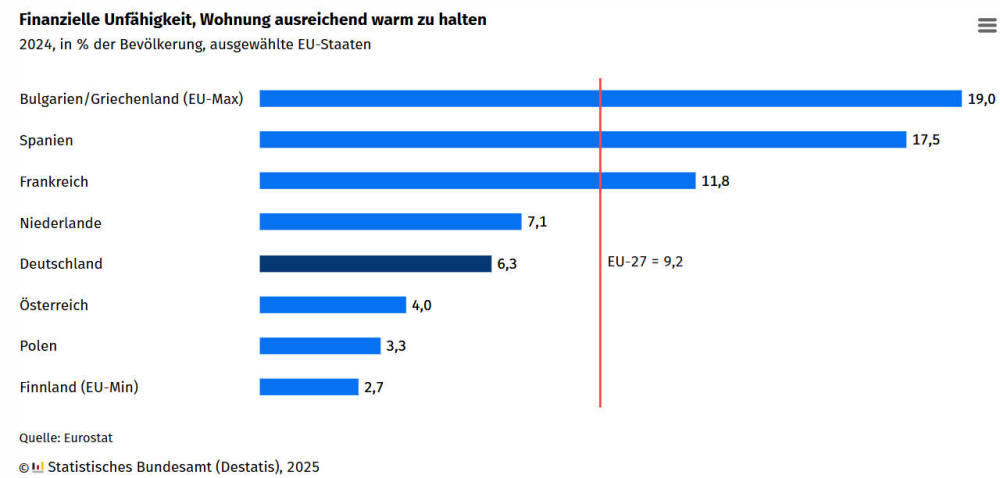
Preise für Haushaltsenergie zuletzt gesunken
Die Preise
für Haushaltsenergie sind zu Beginn der aktuellen Heizsaison
niedriger als ein Jahr zuvor. Im September 2025 mussten
Verbraucherinnen und Verbraucher dafür 1,9 % weniger zahlen als im
Vorjahresmonat.
Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt
nahmen im selben Zeitraum um 2,4 % zu. Im Zuge der Energiekrise
waren die Preise für Haushaltsenergie jedoch stark angestiegen. Von
2020 bis 2024 legten sie um 50,3 % zu und damit deutlich stärker als
die Verbraucherpreise insgesamt (+19,3 %).
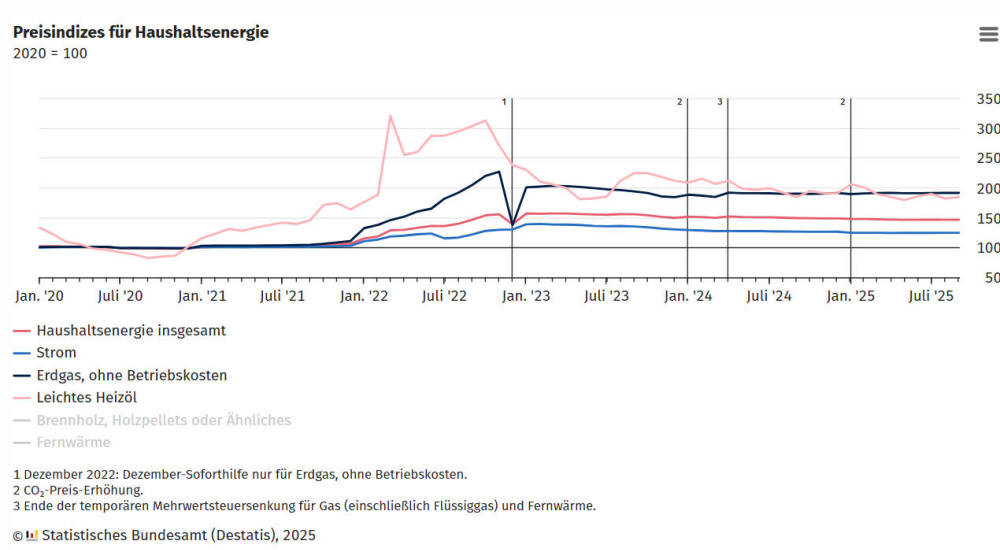
Erdgas und leichtes Heizöl mit Preissteigerungen gegenüber dem
Vorjahresmonat
Je nach Art der Heizung sind die privaten
Haushalte unterschiedlich stark von den Preisentwicklungen
betroffen. Erdgas als am weitesten verbreiteter Heizenergieträger
verteuerte sich im September 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um
0,7 %. Auch leichtes Heizöl verzeichnete erstmals seit Juli 2024
einen leichten Preisanstieg (+0,1 %). Profitieren konnten
Verbraucherinnen und Verbraucher von günstigeren Preisen für
Fernwärme (-2,2 %).
Auch Brennholz, Holzpellets oder andere
feste Brennstoffe (-1,8 %) und Strom (-1,6 %) verbilligten sich
gegenüber September 2024. Preise für leichtes Heizöl von 2020 bis
2024 fast verdoppelt Im langfristigen Vergleich sind die Preise für
leichtes Heizöl besonders stark gestiegen: Von 2020 bis 2024 haben
sich diese beinahe verdoppelt (+99,3 %).
Auch für Erdgas
mussten Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich tiefer in die
Tasche greifen (+89,9 %). Fernwärme verteuerte sich im selben
Zeitraum um 76,0 %, Brennholz, Holzpellets oder andere feste
Brennstoffe um knapp die Hälfte (49,1 %). Die Preise für Strom
wiesen mit einem Plus von gut einem Viertel (27,4 %) die geringste
Preissteigerung unter den Heizenergieträgern auf.