






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 47. Kalenderwoche:
17. November
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Dienstag, 18. November 2025
Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen:
Brötchentütenaktion 2025 -Respekt, Vertrauen und
Liebe: Aller guten Dinge sind drei!
Die
Frauenberatungsstelle Duisburg macht sich mit neuen Kolleginnen
stark gegen Gewalt an Frauen. „Gewalt an Frauen ist keine
Privatsache – sie betrifft uns alle und gehört in die Mitte der
Gesellschaft“, sagt Pia Petermann, neue Mitarbeiterin der
Frauenberatungsstelle Duisburg.
„Und was ist näher an der
Mitte der Gesellschaft, als beim Brötchenkauf darüber zu sprechen?“,
ergänzt ihre neue Kollegin Lea Dietrich. Seit Oktober 2025
verstärken Petermann und Dietrich das nun fünfköpfige Team mit viel
Herz und Engagement in der Frauenberatungsstelle in Duisburg.
Am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen, startet erneut die Brötchentütenaktion:
In den
Bäckereien von Bolten und Agethen werden Tüten mit der Aufschrift
„Aller guten Dinge sind drei: Respekt, Vertrauen, Liebe“ ausgegeben.
Auf der Rückseite finden sich Kontaktadressen regionaler und
überregionaler Hilfsangebote, an die sich betroffene Frauen wenden
können.
Mit dieser Aktion setzt die Frauenberatungsstelle ein
deutliches Zeichen: Für ein Miteinander und gegen Isolation und
Gewalt.
Am 25. November sind die Mitarbeiterinnen der
Beratungsstelle von 11:00 bis 13:00 Uhr vor der Bäckerei Bolten in
der Königstraße 36 anzutreffen. Dort informieren sie über
Hilfsangebote und verteilen Brötchen, die von den Bäckereien
gespendet werden. Zudem laden sie Passant:innen zu einer
Glücksradaktion ein.
Neben solchen öffentlichen Aktionen
bietet die Frauenberatungsstelle kostenfreie, vertrauliche und auf
Wunsch anonyme Beratungen für Frauen an, die Gewalt erfahren oder
erlebt haben. Gleichzeitig engagiert sich das Team in der
Prävention: In Schulen, Einrichtungen und Betrieben sprechen die
Mitarbeiter:innen über Rollenbilder, Grenzen und Wege aus
Gewaltbeziehungen.
„Wir wollen ins Gespräch kommen,
Aufmerksamkeit schaffen und Mut machen“, sagt Determann, die die
Brötchentütenaktion seit mehreren Jahren organisiert. „Jede dritte
Frau erlebt im Laufe ihres Lebens (sexualisierte) Gewalt. Dieses
Thema gehört nicht der Scham oder dem Schweigen – es gehört in die
Öffentlichkeit.
Mit der Aktion zeigt die Frauenberatungsstelle:
Ein sicheres Zuhause und ein Leben ohne Gewalt sind keine
Selbstverständlichkeit – aber ein Recht und unsere gemeinsame
Verantwortung.
Skywalk im RheinPark fertiggestellt
Der
RheinPark hat ein neues Wahrzeichen: Der Skywalk ist fertiggestellt.
Mit der filigranen Stahlkonstruktion ist ein markanter
Aussichtspunkt entstanden, der den Besucherinnen und Besuchern
künftig eindrucksvolle Perspektiven auf den Rhein und das Duisburger
Stadtgebiet eröffnet. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) haben
das Projekt im Rahmen der Arbeiten zur Internationalen
Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027 umgesetzt. Die Plattform
liegt westlich der bekannten Erzbunkerwand an der Skateanlage des
RheinParks und ist über eine rund 27 Meter lange Brückenkonstruktion
erreichbar. In etwa neun Metern Höhe bietet sie auf einer Fläche von
rund 400 Quadratmetern – etwa 50 Meter lang und 8 Meter breit –
großzügig Platz zum Verweilen und Genießen des Panoramas.
Für
den Bau kam verzinkter, besonders robuster Stahl zum Einsatz, der
den Witterungsbedingungen am Rhein dauerhaft standhält. Der
Bodenbelag ist rutschfest ausgeführt, um auch bei Regen und Nässe
ein sicheres Begehen zu ermöglichen. Der Zugangssteg weist eine
sanfte Steigung von maximal sechs Prozent auf – damit bleibt der
Skywalk vollständig barrierefrei und für alle gut erreichbar. Die
Plattform ruht auf mehreren massiven Einzelfundamenten, die speziell
für die besonderen Bodenverhältnisse des ehemaligen Industrieareals
entwickelt wurden. Sie tragen die gesamte Konstruktion und sorgen
für Stabilität, auch bei hohen Besucherzahlen und Windbelastungen.
Die Tragwerksplanung wurde exakt auf diese Anforderungen abgestimmt,
um den Skywalk langlebig, sicher und wartungsarm zu gestalten.
Skywalk im RheinPark: Stimmungsvoller Anziehungspunkt
Ab 2027 wird die Plattform nachts sanft illuminiert und so zu einem
stimmungsvollen Anziehungspunkt – auch nach Sonnenuntergang.
Der
Skywalk ist ein zentrales Element der IGA 2027 im RheinPark. Er
steht symbolisch für den Wandel des Areals vom industriell geprägten
Standort hin zu einem modernen, offenen und erlebbaren Stadtraum am
Wasser.
Nach Fertigstellung der Aussichtsplattform erfolgen
nun die Arbeiten an der Zuwegung. Besucherinnen und Besucher müssen
sich noch ein wenig in Geduld üben, um die neue Aussicht genießen zu
können. Der RheinPark wird erst zur Internationalen Gartenschau 2027
ab dem 23. April 2027 wieder zugänglich sein.

Der Skywalk auf der Bunkergalerie ermöglicht zur IGA 2027 neue
Ausblicke auf den Rhein. Foto: wbd/Adria Chodkowski
EU-Kommission begrüßt Einigung auf
EU-Haushalt für 2026
Die Europäische Kommission begrüßt
die Einigung zwischen Europäischem Parlament und den EU-Staaten auf
den EU-Jahreshaushalt für 2026. Haushaltskommissar Piotr
Serafin sagte: „Die rechtzeitige Einigung zwischen den beiden
gesetzgebenden Organen gewährleistet die Vorhersehbarkeit eines
EU-Haushalts, mit dem die gemeinsamen politischen Prioritäten der
Union weiter vorangebracht werden.“
Knapp 193 Milliarden
Euro
Das Budget wird sich auf insgesamt 192,77 Milliarden Euro
belaufen. Es ist Teil des Finanzrahmens von 2021 bis 2027.
Schwerpunkte sind die stabile und vorhersehbare Finanzierung der
Ukraine über die Ukraine-Fazilität, eine Aufstockung der Mittel für
humanitäre Hilfe und Nachbarschaftspolitik sowie für Sicherheit und
Verteidigung.
Haushaltskommissar Serafin sagte: „Dieses
Haushaltsverfahren hat gezeigt, dass wir durch Zusammenarbeit auf
kosteneffizientere Weise mehr erreichen können. Wir haben mehr in
externe Sicherheit, Verteidigung, Innovation, aber auch in Programme
investiert, die unseren Bürgerinnen und Bürgern, Studierenden und
Landwirten unmittelbar zugutekommen.“
Geld fließt zurück in
die Mitgliedsstaaten
Größte Posten sind wie in den vergangenen
Jahren auch die Bereiche „Zusammenhalt, Resilienz und Werte“ mit
etwa 72 Milliarden Euro und „Natürliche Ressourcen und Umwelt“ mit
etwa 57 Milliarden Euro.
Im Bereich „Zusammenhalt,
Resilienz und Werte“ sind beispielsweise die Regionalfonds
enthalten, mit denen die EU regionale Projekte in den
Mitgliedsstaaten stärkt. Der Bereich „Natürliche Ressourcen und
Umwelt“ beinhaltet vor allem die Zahlungen an Europas Landwirtinnen
und Landwirte.
Nächste Schritte
Der Jahreshaushaltsplan
für 2026 sollte nun vom Rat der Europäischen Union und vom
Europäischen Parlament förmlich angenommen werden. Die Abstimmung im
Plenum, mit der das Verfahren abgeschlossen wird, ist derzeit für
den 26. November 2025 geplant.
Sören Link eröffnet Live-Escape Room zum Thema Flucht und
Migration
Die Kindernothilfe lädt heute um 1130 Uhr zur
Eröffnung des Live-Escape Rooms "Unbekanntes Unbehagen" ein, der vom
18. November bis zum 17. Dezember in der Geschäftsstelle in Duisburg
(Düsseldorfer Landstraße 180 47249 Duisburg) Station macht.
Im Escape Room wandern die Spielenden in die Republik Fremdistan aus
und erfahren, wie es sich anfühlt, wenn plötzlich alles fremd ist.
Ein unvergessliches Erlebnis, das weit über das Spiel hinaus
nachwirkt! Über Geflüchtete wird viel gesprochen - mit ihnen aber
oft nicht. Der Live-Escape Room "Unbekanntes Unbehagen" wurde von
der Flüchtlingshilfe Bonn gemeinsam mit jungen Geflüchteten
entwickelt und soll den Spielenden vermitteln, wie es ist, plötzlich
einen Alltag zu erleben, in dem alles fremd ist.
Das Ziel:
Mehr Verständnis und Empathie füreinander in unserer Gesellschaft
wecken. Bei der Eröffnung gibt ein ganz besonderes Team alles, um
die Herausforderungen im Escape Room zu meistern: Duisburgs
Oberbürgermeister Sören Link spielt gemeinsam mit Katrin Weidemann
(CEO Kindernothilfe) und Carsten Montag (CPO Kindernothilfe).
Unterstützt werden sie von David (16) und Kira (16) vom
Kindernothilfe-Jugendrat.
Bundesweiter Vorlesetag
mit Oberbürgermeister Sören Link in der Zentralbibliothek
Zum Bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 21. November, ab 15.30
Uhr findet in der Zentralbibliothek an der Steinschen Gasse 26 in
der Stadtmitte ein ganz besonderes Vorlese-Event für Kinder ab sechs
Jahren statt: Oberbürgermeister Sören Link lässt es sich nicht
nehmen auch in diesem Jahr in der Kinder- und Jugendbibliothek
vorzulesen. Die Stadtbibliothek engagiert sich in allen Stadtteilen
das gesamte Jahr über für das Lesen und Vorlesen.
Vorlesepatinnen und Vorlesepaten arbeiten ehrenamtlich und mit
ganzem Herzen für die Leseförderung. Darüber hinaus unterstützen
auch zahlreiche Künstlerinnen und Künstler sowie Autorinnen und
Autoren dabei, die Sprach- und Lesefähigkeiten von Kindern und
Jugendlichen zu stärken.
Der Eintritt ist frei. Eine
Anmeldung ist online auf www.stadtbibliothekduisburg.de unter
„Veranstaltungen“ möglich. Fragen beantwortet das Team der
Bibliothek gerne persönlich oder telefonisch unter 0203 283-4218.
Die Servicezeiten sind montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis
freitags von 11 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 16 Uhr.

Zum internationalen Vorlesetag liest Oberbürgermeister Sören Link
zwei vierten Klassen der GGS Böhmerstraße in der Stadtbibliothek
vor. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
Realitätsnahe Simulationen: RVR gibt Startschuss für Verkehrsmodell
"ruhrMobil"
Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat jetzt im
Rahmen des "planer:in_netzwerk" offiziell den Startschuss für das
neue Verkehrsmodell „ruhrMobil“ gegeben. Dieses ermöglicht, den
täglichen Verkehr im Ruhrgebiet realitätsnah zu simulieren und die
Wirkung geplanter verkehrlicher Maßnahmen zu bewerten. Ab 2026 soll
das Informationssystem ruhrMobil in einer Testphase für regionale
und kommunale Projekte zum Einsatz kommen.
"Wir freuen uns,
interessierten Kommunen ein Werkzeug anbieten zu können, mit dem das
Mobilitätsverhalten von rund fünf Millionen Einwohnerinnen und
Einwohnern im Ruhrgebiet analysiert und prognostiziert werden kann",
erklärt Stefan Kuczera, RVR-Beigeordneter für Regionale Planung und
Entwicklung. Das ruhrMobil bildet sämtliche Verkehrsträger ab:
motorisierten Individualverkehr, öffentlichen Nahverkehr, Rad- und
Fußverkehr sowie den straßengebundenen Wirtschaftsverkehr.
Dadurch lassen sich sowohl Pendlerströme als auch Lieferverkehre
umfassend darstellen. Auch intermodale – mit unterschiedlichen
Verkehrsträgern zurückgelegte – Wege, Regelungen für den ruhenden
Verkehr und Veränderungen in der kommunalen Flächennutzung können
berücksichtigt werden. Für eine besonders realitätsnahe Simulation
wird die Bevölkerung anhand verschiedener soziodemographischer
Merkmale nachgebildet.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer – im Modell als
Agenten dargestellt – folgen individuellen Tagesabläufen und wählen
dabei jeweils das für sie passende Verkehrsmittel. So können
beispielsweise typische Pendelrouten oder Wegeketten mit
Zwischenstopps untersucht werden. Das Modell basiert auf der
international etablierten Open-Source-Software MATSim.
Für
den Einsatz im Ruhrgebiet wurden zusätzliche Module entwickelt.
Aufgebaut wurde die Anwendung durch die TU Berlin in enger
Zusammenarbeit mit dem RVR; Ergänzungen kamen von der Bergischen
Universität Wuppertal. Die Entwicklung wurde zudem durch den
Arbeitskreis Verkehrsdaten und -modelle beim RVR begleitet. idr
Infos:
http://www.rvr.ruhr/themen/mobilitaet/verkehrsmodell-ruhr
Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung -
Ausgangsbedingungen für mehr Chancengleichheit
Kurz vor
Inkraftreten des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung im
Grundschulalter zum Schuljahr 2026/27 ist Deutschland von der
flächendeckenden Zugänglichkeit von Ganztagsangeboten noch weit
entfernt. Der soeben erschienene IAQ-Report der Universität
Duisburg-Essen bündelt die Ausgangsbedingungen für eine erfolgreiche
Umsetzung des Rechtsanspruchs.
Das Team um Prof. Dr. Sybille
Stöbe-Blossey hat darin außerdem die aktuelle Lage analysiert. Der
Ausbau der Ganztagsförderung an Grundschulen verfolgt ein politisch
essentielles Ziel: die Verbesserung der Chancengleichheit im
Bildungssystem. Bereits 2021 wurde ein ab dem Schuljahr 2026/27
geltender Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung beschlossen.
Damit verbunden ist das Ziel, allen Kindern im Rahmen des
Ganztagsangebots zusätzliche Bildungs- und Förderangebote zu
ermöglichen. Nicht zuletzt für Kinder, die in schwierigen
Rahmenbedingungen aufwachsen, sollen sich so bessere Chancen auf
Bildung und gesellschaftliche Teilhabe ergeben. Dazu sind Konzepte
erforderlich, die Lernen, Freizeit und individuelle Förderung
verbinden.
Ein Fokus sollte dabei auf sozialen Kompetenzen,
Sprachförderung und kindgerechter Beteiligung liegen, so die
Wissenschaftlerinnen der IAQ-Forschungsabteilung Bildung,
Entwicklung, Soziale Teilhabe (BEST) unter der Leitung von Prof. Dr.
Sybille Stöbe-Blossey im aktuellen IAQ-Report. „Am besten lassen
sich solche Angebote durch eine kommunal koordinierte Zusammenarbeit
zwischen Schule und Trägern der Kinder- und Jugendhilfe
realisieren“, erläutert Stöbe-Blossey.
Bislang nehmen Kinder
aus bildungsbenachteiligten Familien, die mit Blick auf bessere
Bildungschancen in besonderem Maße eine Förderung benötigen,
unterdurchschnittlich oft an Ganztagsangeboten teil. Hier verweisen
die Forscherinnen auf aktuelle Auswertungen der
Kinderbetreuungsstudien (KiBS) des Deutschen Jugendinstituts (DJI),
die im Rahmen einer
Studie für
das Deutsche Institut für Sozialpolitikforschung (DIFIS)*
durchgeführt wurden. Besonders benachteiligt sind demnach Kinder aus
Familien, in denen die Eltern einen niedrigen Bildungsstand haben
oder die Betreuungskosten nicht tragen können.
Fazit: „Die
bildungs- und sozialpolitischen Potenziale der Ganztagsförderung
können nur ausgeschöpft werden, wenn es Angebote gibt, die allen
Kindern den Zugang zu einer kooperativen Förderung ermöglichen. Die
Voraussetzung dafür ist eine finanzielle Förderung, die einen
bedarfsdeckenden Ausbau ermöglicht und die sowohl soziale als auch
kommunale Ungleichheiten berücksichtigt“, erläutert Prof. Dr.
Sybille Stöbe-Blossey.
Am Montag, 24.11.2025 diskutieren
Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey und Iris Nieding im Rahmen der
Onlineveranstaltung „IAQ debattiert“ u.a. mit Beteiligten aus dem
Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMBFSFJ) und aus der kommunalen Praxis die Frage, wie eine
kindorientierte und sozialräumlich verankerte Förderung an
Ganztagsschulen in Kooperation zwischen Schule, Trägern der Kinder-
und Jugendhilfe und kommunalen Akteuren gelingen kann – und welche
Rahmenbedingungen dafür notwendig sind.
* Neimanns, Erik und
Antonella Faggin. 2025. Zugangshürden zu Betreuung im Kita- und
Grundschulalter trotz Rechtsanspruch. DIFIS-Studie 2025-05.
Duisburg, Bremen: Deutsches Institut für Interdisziplinäre
Sozialpolitikforschung. Weitere Informationen: Sybille
Stöbe-Blossey, Stella Glaser, Iris Nieding, Corin Wimmers, 2025:
Ganztagsförderung an Grundschulen: Ein bildungs- und
sozialpolitisches Konzept für mehr Chancengleichheit? Duisburg:
Inst. Arbeit und Qualifikation.
IAQ-Report 2025-11.
Vorlesen, Mitmachen,
Basteln: Winter- und Nikolausgeschichten in der Rumelner Bibliothek
Die Bibliothek in Rumeln-Kaldenhausen, Schulallee 11,
lädt Kinder ab sieben Jahren zu einer gemütlichen Mitmach-Aktion in
der Vorweihnachtszeit ein. Am Dienstag, 18. November, dreht sich von
16 bis 17 Uhr alles um Winterund Nikolausgeschichten. Gemeinsam wird
gelesen, gelauscht und gelacht – mit schönen Geschichten, die Lust
aufs Lesen machen. Im Anschluss gibt es passend zum Thema eine
Bastelaktion.
Die Veranstaltung richtet sich an Kinder, die
Freude am Lesen und Basteln haben. Sie ist eine schöne Gelegenheit,
spielerisch das Lesen zu üben und dabei neue Geschichtenwelten zu
entdecken. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung auf
www.stadtbibliothekduisburg.de (unter „Veranstaltungen“) wird
gebeten.
Fragen beantwortet das Team der Bibliothek gerne
persönlich oder telefonisch unter 02151 41908158. Die Öffnungszeiten
sind dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,
sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.
Europäischer
Gipfel zur digitalen Souveränität: Studie: Öffentliche Förderung für
Entwicklung offener, freier Software kann funktionieren
Freie Software ist das Rückgrat der digitalen Infrastruktur. Eine
Gesellschaft, die sich nicht von einzelnen Konzernen und
undurchschaubaren Technologien aus anderen Ländern abhängig machen
will, sollte ihre Entwicklung unterstützen. Das kann auch über
öffentliche Förderung funktionieren, zeigt eine neue, von der
Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie*.
Die
Wissenschaftler haben beispielhaft die Arbeit der deutschen
Sovereign Tech Agency (STA) untersucht. Open-Source-Software ist
auch ein Thema auf dem Europäischen Gipfel zur digitalen
Souveränität, der morgen in Berlin stattfindet.
OpenSSL,
OpenPGP oder libcurl sind politisch. Diese offenen digitalen
Standards – ein Protokoll zur sicheren Datenübertragung, ein
Verschlüsselungsstandard, eine Programmbibliothek – stehen
beispielhaft für einen entscheidenden Teil der Infrastruktur
demokratischer Gesellschaften im digitalen Zeitalter.
Offene
digitale Infrastruktur, die jedem und jeder zur Verfügung steht,
kann man sich wie die „Straßen und Brücken“ der digitalen Welt
vorstellen, so René Lührsen, Prof. Dr. Maximilian Heimstädt und
Prof. Dr. Thomas Gegenhuber in der Studie. Freie Software bildet den
Großteil praktisch aller digitalen Anwendungen, so die
Wissenschaftler.
Sie wird von Gemeinschaften von
Programmierer*innen überall auf der Welt entwickelt und gepflegt.
Obwohl ihr wirtschaftlicher Wert auf das Doppelte des deutschen
Bruttoinlandsprodukts geschätzt wird, braucht niemand Gebühren für
die Nutzung zu zahlen. Und niemand kann andere an der Nutzung des
Programmcodes hindern.
Dieses offene, gemeinschaftliche
Modell der Technologienentwicklung ist jedoch bedroht, fürchten
Lührsen, Heimstädt und Gegenhuber. Die Forscher von der Leuphana
Universität Lüneburg, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg und
Johannes Kepler Universität Linz sehen Gefahren von zwei Seiten: Das
eine sind die großen Digitalkonzerne, häufig Big Tech genannt, das
andere sind autoritäre politische Regime.
Um im Bild von den
Straßen und Brücken zu bleiben: Sie haben Interesse daran, Wegzölle
zu erheben oder nur ihnen genehme Personengruppen durchzulassen und
überall Überwachungskameras zu installieren. Daher halten es die
Wissenschaftler dringend für nötig, der globalen, dezentralen,
unabhängigen Gemeinde der Entwicklerinnen und Entwickler offener
Software politisch und finanziell mit zusätzlichen öffentlichen
Mitteln den Rücken zu stärken.
Das ist allerdings kein
leichtes Unterfangen, weil die Logik und Abläufe der
Softwareentwicklung nur bedingt mit den Mechanismen staatlicher
Verwaltung kompatibel sind. Ob und wie es trotzdem funktionieren
kann, haben Lührsen, Heimstädt und Gegenhuber am Beispiel der
Sovereign Tech Agency (STA) untersucht. Die STA wurde 2022 vom
Bundeswirtschaftsministerium ins Leben gerufen und hat sich der
Förderung von „Open-Source-Software als Schlüsselkomponente einer
modernen Industriestrategie und zur Sicherung unserer digitalen
Souveränität“ verschrieben.
Das Beispiel STA zeigt den
Autoren zufolge, dass öffentliche Förderung freier
Softwareentwicklung funktionieren kann – entgegen möglicher
Einwände: dass staatliche Beteiligung zu Bürokratisierung und
politischer Einflussnahme führe und inkompatibel mit dezentraler,
selbstorganisierter und wenig hierarchischer Projektarbeit sei.
In ihrer Analyse machen die Forscher drei Herausforderungen aus,
vor denen Förderprogramme für offene digitale Infrastruktur stehen:
Zunächst geht es um Sichtbarkeit, also darum, den gesellschaftlichen
Nutzen sehr speziell anmutender Programmierarbeit herauszustellen.
Zweitens gilt es, geeignete Arbeitstechniken zu finden, um
die formalisierten Strukturen öffentlicher Finanzierungsprogramme
mit der „fluiden Struktur“ der Gruppen von Programmierenden
zusammenzubringen. Drittens muss die Autonomie der
Programmierer*innen gewahrt bleiben. In diesem Sinne sollte der
Staat Projekte ermöglichen, aber nicht als klassischer Auftraggeber
oder Kontrolleur auftreten.
So hat sich die STA, die Lührsen,
Heimstädt und Gegenhuber als ein Beispiel sehen, von dem weitere
Förderprogramme lernen können, den Prinzipien verpflichtet, die in
der Open-Source-Community gelten. Das bedeutet unter anderem: Für
einen „digitalen Nationalismus“ oder unter
Datenschutzgesichtspunkten fragwürdige Ansinnen der Politik –
aktuelles Beispiel: Nutzung von Internetdaten zur Gesichtserkennung
– ist kein Raum.
Bedenke man, wie viel die Bundesregierung an
große amerikanische IT-Konzerne zahlt, sei es „dringend geboten,
mehr in offene digitale Infrastruktur und damit in digitale
Souveränität zu investieren“, sagt Christina Schildmann, Leiterin
der Forschungsförderung in der Hans-Böckler-Stiftung.
OCEANO NOX – Naturgewalt, Lebensraum, Schicksalsraum: Victor
Hugo, Jules Michelet und das Meer
Lesung: Dirk Schäfer
/ Vortrag: Wolfgang Schwarzer Das Kultur- und Stadthistorische
Museum lädt am Sonntag, 23. November, um 11.15 Uhr in Kooperation
mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft zur diesjährigen
Abschlussveranstaltung der Mercator Matinée ein. Eine besondere
Verbindung zwischen dem Historiker Jules Michelet (1798– 1874) und
dem großen Literaten Victor Hugo (1802–1885) ist ihre Erfahrung mit
dem Meer.
Michelets „Das Meer“ (1861) und Hugos „Die
Arbeiter des Meeres“ (1866) nähern sich diesem Thema auf
unterschiedliche Weise: Michelet als reisenden und zugleich
poetischer Wissenschaftler, Hugo als Schriftsteller, der auf die
Insel Guernsey verbannt wurde.
Die Lesung von Dirk Schäfer
und der Vortrag von Wolfgang Schwarzer Spannung zeichnen die
Spannung nach, die zwischen der Neugier des wissenschaftlichen
Reisenden und der leidenschaftlichen Darstellung eines gewaltigen
Kräftemessens zwischen Mensch und Natur im Roman entsteht.
Die Teilnahme kostet für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Das
vollständige Programm ist unter www.stadtmuseum-duisburg.de
abrufbar. Kartenreservierungen werden empfohlen unter Tel. 0203 283
2640 oder per E-Mail an ksm-service@stadt-duisburg.de.
Sammeln für weihnachtlichen Lichterglanz in Röttgersbach
Am kommenden Freitag, den 21.November von 16.00 bis 18.00 Uhr
sammelt die Initiative Röttgersbach um Renate Gutowski vor Edeka
Engel, Ziegelhorststraße 54 Spenden für die beliebte
Weihnachtsbeleuchtung. „Dies ist in gewohntem Umfang nur möglich,“
so Renate Gutowski, „wenn Stadt Duisburg, Geschäftsleute und
Bürgerinnen und Bürger sich gemeinsam engagieren!“

„Wir brauchen Unterstützer durch die Röttgersbacherinnen und
Röttgersbacher, so dass wir unsere Beleuchtung rund um den
Kreisverkehr Ziegelhorststraße / Röttgersbacher Straße wieder
einschalten können.“ Zeitnah soll dann die Lichterkette durch
einen Fachbetrieb installiert werden.

Vor 10 Jahren in der BZ:
Erstes
Stadtwerke-Weihnachtssingen ein voller Erfolg
Das Stadtwerke-Weihnachtssingen hat über 3.000 Teilnehmer in die MSV-Arena
gelockt und damit die Erwartungen der Stadtwerke
Duisburg als Mitveranstalter mehr als übertroffen.
"Diese Resonanz und die Begeisterung der Menschen
war einfach überwältigend", blickt David Karpathy,
Vorstand des Unternehmens auf das stimmungsvolle
Ereignis zurück.

Zum ersten Mal haben die Stadtwerke Duisburg, die
Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung
und der MSV Duisburg zum gemeinsamen Singen in der
Adventszeit eingeladen. Familien, Freunde, Chöre und
Fans haben Weihnachtslieder, Heimatlieder und
Fußballgesänge angestimmt , begleitet von Chören,
Sängern und Musikgruppen.
Ziel des Abends war
insbesondere, Menschen mit und ohne Behinderung
zusammenzubringen, um sich gemeinsam als großer Chor
auf die Weihnachtszeit einzustimmen.
"Diese Idee hat uns sofort angesprochen, weshalb wir
das Event gerne organisatorisch und als
Namenssponsor unterstützen", betont Karpathy. Nach
dem Erfolg der Premiere steht eine Fortsetzung des
Stadtwerke-Weihnachtssingens im kommenden Jahr
bereits fest.

Fotos Stadwerke Duisburg
Meidericher Gemeinde lädt zum Spieleabend
für Jung und Alt ins Begegnungscafé
Zu einem bunten
Spieleabend lädt die Evangelische Kirchengemeinde Meiderich in
ihr Begegnungscafé "Die Ecke" auf der Horststr. 44a ein. Dort warten
am Dienstag, 25. November von 19 bis 21 Uhr alte Klassiker und neue
Spiele darauf, entdeckt zu werden. Wer mag, bringt gerne eigene
Spiele - egal ob Klassiker, Karten-, Brett- oder Gesellschaftsspiele
- mit, die mit anderen ausprobiert werden können. Getränke und
Snacks gibt's zum Selbstkostenpreis.
Wenn der Abend
weiterhin gut ankommt, wird es monatlich einen Spieleabend im
Gemeindezentrum geben. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter
www.kirche-meiderich.de

Foto von 2025 von einem Meidericher Spieleabend mit höchster
Konzentration (Foto: kirche-meiderich.de).
Flötenzirkus beim Literaturabend im
Untermeidericher Begegnungscafé
Engagierte der Evangelischen
Kirchengemeinde Duisburg Meiderich servieren im Begegnungscafé „Die
Ecke“, Horststr. 44a, regelmäßig auch kulturelle Leckerbissen. Den
nächsten literarischen Happen gibt es am Dienstag, 18. November 2025
um 19 Uhr, wenn Pfarrer Klaus Fleckner, der lange in der
Evangelischen Kirchengemeinde Ruhrort-Beeck tätig war.
Wolfgang Steinweg ist sein selbstgewählter Schriftstellername. Unter
diesem Namen hat er das Buch „Flötenzirkus und andere unerhörte
Darbietungen“ geschrieben. Es beinhaltet Geschichten, die ein
humorvolles, warmherziges und melancholisches Bild der Zeit um die
Jahrtausendwende zeichnen. Das Team des Begegnungscafés lädt zu
einer spannende Zeitreise.
Der Eintritt ist frei. Mehr Infos
hat Yvonne de Temple-Hannappel, die Leiterin des Begegnungscafés
(Tel. 0203 45 57 92 70, E-Mail: detemple-hannappel@gmx.de). Infos
zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.kirche-meiderich.de.

Pfarrer i.R. Klaus Fleckner 2022 vor seinem Ruhestand in
der Beecker Kirche (Foto: Reiner Terhorst).

9,5 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. bis 3.
Quartal 2025 als im Vorjahreszeitraum
• Aufgaben
größerer Betriebe nehmen ebenfalls zu (+4,8 %)
• Gesamtzahl der
Neugründungen steigt um 6,9 % • Gesamtzahl der vollständigen
Gewerbeaufgaben steigt um 1,1 %
In den ersten drei Quartalen
des Jahres 2025 wurden in Deutschland rund 99 300 Betriebe
gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere
wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 9,5 % mehr neu gegründete
größere Betriebe als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig stieg jedoch
auch die Zahl der vollständigen Aufgaben von Betrieben mit größerer
wirtschaftlicher Bedeutung um 4,8 % auf rund 74 300.
Insgesamt 487 700 Neugründungen und
360 700 vollständige Gewerbeaufgaben Die Neugründungen von Gewerben
waren in den ersten drei Quartalen 2025 mit insgesamt rund 487 700
um 6,9 % höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der
Gewerbeanmeldungen stieg um 5,6 % auf rund 578 400.
Zu den
Gewerbeanmeldungen zählen neben Neugründungen von Gewerbebetrieben
auch Betriebsübernahmen (zum Beispiel Kauf oder
Gesellschaftereintritt), Umwandlungen (zum Beispiel Verschmelzung
oder Ausgliederung) und Zuzüge aus anderen Meldebezirken. Die Zahl
der vollständigen Gewerbeaufgaben war im 1. bis 3. Quartal 2025 mit
rund 360 700 um 1,1 % höher als im 1. bis 3. Quartal 2024.
Die Gesamtzahl der Gewerbeabmeldungen stieg um 0,8 % auf rund
446 500. Neben Gewerbeaufgaben zählen dazu auch Betriebsübergaben
(zum Beispiel Verkauf oder Gesellschafteraustritt), Umwandlungen
oder Fortzüge in andere Meldebezirke.
Erzeugerpreise
landwirtschaftlicher Produkte im September 2025: +2,2 % gegenüber
September 2024 - Obst erstmals seit April 2023 wieder günstiger
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, September
2025
+2,2 % zum Vorjahresmonat
-1,5 % zum Vormonat
Preise
für pflanzliche Erzeugnisse
-10,5 % zum Vorjahresmonat
Preise
für Tiere und tierische Erzeugnisse
+9,9 % zum Vorjahresmonat
Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im
September 2025 um 2,2 % höher als im September 2024. Im August 2025
hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls
bei +2,2 % gelegen, im Juli 2025 bei -0,2 %. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Erzeugerpreise
landwirtschaftlicher Produkte im September 2025 gegenüber dem
Vormonat August 2025 um 1,5 %.
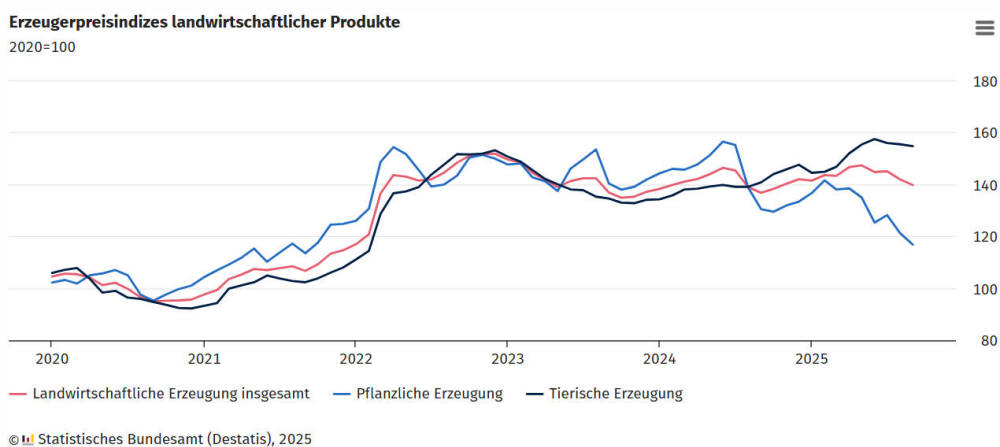
Im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelten sich die Preise für
Produkte aus pflanzlicher und tierischer Erzeugung im September 2025
erneut gegenläufig. So sanken die Preise für pflanzliche Erzeugnisse
um 10,5 % gegenüber September 2024, während die Preise für Tiere und
tierische Erzeugnisse um 9,9 % stiegen.
Im Vergleich zum
Vormonat verbilligten sich im September 2025 sowohl Produkte aus
pflanzlicher Erzeugung (-3,7 %) als auch Produkte aus tierischer
Erzeugung (-0,4 %).
Preisrückgang bei Speisekartoffeln hält
an
Der Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 10,5 % im
Vergleich zum Vorjahresmonat ist erneut unter anderem auf die
gesunkenen Preise für Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese waren
im September 2025 um 44,0 % niedriger als im September 2024. Im
August 2025 hatte die Vorjahresveränderung bei -52,5 %, im Juli 2025
bei -53,0 % gelegen. Auch gegenüber dem Vormonat August 2025 sanken
die Speisekartoffelpreise um 27,7 %.
Preise für Gemüse,
Obst, Getreide, Handelsgewächse und Futterpflanzen gesunken, für
Wein gestiegen
Die Preise für Gemüse fielen binnen Jahresfrist
um 4,8 %, wobei insbesondere Gurken (-28,7 %), Eissalat (-7,8 %) und
Kohlgemüse (-7,1 %) günstiger waren. Eine Preissteigerung war
hingegen unter anderem bei Champignons zu beobachten, die sich
binnen Jahresfrist um 8,8 % verteuerten. Die Erzeugerpreise für Obst
waren im September 2025 um 0,6 % niedriger als ein Jahr zuvor. Dies
war der erste Preisrückgang im Vorjahresvergleich seit April 2023.
Preissenkungen gab es unter anderem bei Erdbeeren mit
-11,0 %. Bei Tafeläpfeln hingegen kam es zu einer Preissteigerung um
+5,7 %. Getreide war im September 2025 im Vergleich zum September
2024 um 11,5 % günstiger. Die Preise für Handelsgewächse insgesamt
lagen im September 2025 um 12,3 % niedriger als ein Jahr zuvor,
wobei sich Raps im Gegensatz zu den meisten anderen Handelsgewächsen
verteuerte (+1,5 %).
Die Preise für Futterpflanzen waren mit
einem Rückgang von 9,3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat weiterhin
rückläufig. Beim Wein war im September 2025 eine Preissteigerung um
2,1 % gegenüber September 2024 zu verzeichnen. T
ierische
Erzeugung: Preisanstieg bei Rindern, Geflügel sowie Milch und Eiern
Die Preise für Tiere lagen im September 2025 um 11,5 % höher als
im September 2024. Maßgeblich dafür war der Preisanstieg bei Rindern
um 42,1 %. Bei Schlachtschweinen sanken die Preise hingegen um
4,6 %.
Die Preise für Geflügel waren im September 2025 um
10,9 % höher als im September 2024. Ausschlaggebend hierfür waren
die Preissteigerungen bei Sonstigem Geflügel (Enten und Puten) um
16,3 % und bei Hähnchen um 7,6 %.
Der Milchpreis lag im
September 2025 um 8,2 % höher als im Vorjahresmonat. Im Vergleich
zum Vormonat August 2025 sanken die Preise für Milch (-1,6 %). Bei
Eiern kam es binnen Jahresfrist zu einer Preissteigerung von 9,7 %.