






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 46. Kalenderwoche:
12. November
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Donnerstag, 13. November 2025
Von romantisch bis bergmännisch: Weihnachtsmärkte und
Winterzauber







Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, dann
beginnt das Ruhrgebiet, sich auf Weihnachten einzustimmen. Zwischen
Industriekulisse, Fachwerkcharme und Klostermauern lädt die Region
zu ganz unterschiedlichen vorweihnachtlichen Erlebnissen ein.
Sogar einen Weihnachtsmarkt unter Tage gibt es! Natürlich darf
in keiner großen Stadt der Region der traditionelle Weihnachtsmarkt
fehlen: In Duisburg weht schon ab dem 13. Novemberder Duft von
Glühwein und gebrannten Mandeln durch die Innenstadt, einen Tag
später (14. November) eröffnen die Märkte in der Essener Innenstadt
und am Centro Oberhausen.
Am 20. November folgen u. a.
Dortmund, Bochum und Herne. Neben den großen Weihnachtsmärkten in
den Innenstädten locken zahlreiche kleine, aber feine Angebote:
Stimmungsvoll wird es ab dem 24. November in der Hattinger Altstadt,
wo die Stände vor mittelalterlicher Kulisse stehen. Am Alten Rathaus
erscheint Frau Holle jeden Nachmittag um 17 Uhr.
Das
LWL-Freilichtmuseum Hagen öffnet vom 28. bis 30. November seine Tore
für den romantischen Weihnachtsmarkt, und das LWL-Schiffshebewerk
Henrichenburg in Waltrop verbindet auf seinem Weihnachtsmarkt am 29.
und 30. November Industriekultur und Adventsflair.
"Weihnachten am Strand" feiert der Dortmunder Revierpark Wischlingen
in Dortmund an allen vier Adventswochenenden. Am See entsteht eine
winterliche Strandlandschaft mit Glashäusern, Fondue-Abenden und
Kunsthandwerk. Der Landschaftspark Duisburg-Nord erstrahlt "tief im
Westen" vom 28. bis 30. November beim Lichtermarkt mit
Lichtskulpturen, Laserprojektionen und Kunsthandwerk.
Über
den Adventsmarkt im Kloster Kamp kann am 13. und 14. Dezember
gebummelt werden. Am 29. November öffnen in Hünxe-Krudenburg die
Einwohner ihre Türen und Fenster und verwandeln den historischen
Dorfkern in ein lebendiges Weihnachtsdorf. Ende November verwandelt
sich auch der Maximilianpark Hamm ganz im Osten des Ruhrgebiets in
ein Lichtermeer.
Den Weihnachtsmarkt unter Tage öffnet zum
zweiten Mal das Trainingsbergwerk in Recklinghausen am 13. und 14.
Dezember. 50 Stände im Bergwerk bieten u. a. regionales Handwerk und
"Ruhrgebiet-Gedöns". Da schaut sogar das Christkind vorbei – auf
einem Grubenrad. idr - Weitere Infos zu den großen und kleinen
Weihnachtsmärkten in der Region unter
https://www.ruhr-tourismus.de/das-ruhrgebiet/weihnachtsmaerkte-im-ruhrgebiet
Sondervermögen muss in die Zukunft wirken: IHK NRW fordert
Nachteilsausgleich für den Verkehrsstandort NRW
Aktuelle Planungen der Bundesregierung zur Mittelausstattung im
Bundeshaushalt und den Vergaberegeln im Sondervermögen
benachteiligen NRW
IHK NRW warnt anlässlich der finalen
Haushaltsverhandlungen im Bundestag vor Standortnachteilen für
Nordrhein-Westfalen bei der Finanzierung der
Verkehrsinfrastrukturen: „Gerade hier ist der Zustand der
Verkehrsinfrastruktur besonders kritisch – bröckelnde Brücken,
überlastete Autobahnen und veraltete Wasserstraßen gefährden
Lieferketten und Wettbewerbsfähigkeit“, betont Dr. Ralf Mittelstädt,
Hauptgeschäftsführer von IHK NRW. „Doch so wie Haushalt und
Sondervermögen derzeit ausgestaltet sind, droht NRW weniger und
nicht mehr Investitionsmittel zu erhalten. Das ist das Gegenteil
dessen, was dieses Land jetzt braucht.“
NRW trägt im
Bundesvergleich eine überdurchschnittliche Last im Verkehrsnetz:
Fast 30 Prozent der Autobahnbrücken im Land sind sanierungs- oder
ersatzbedürftig (Bund: teils unter 10 %).
Ersatzneubauten in NRW
sind in der Regel mit Ausbau verbunden – und fallen damit aus vielen
Förderzugriffen des Sondervermögens heraus.
Die wichtigsten
Wasserstraßen für Industrie und Hafenstandorte sind im
Sondervermögen kaum berücksichtigt.
Zahlreiche Verkehrsprojekte
verzögern sich, weil Planungsverfahren in dicht besiedelten Räumen
besonders komplex sind.
„Die Lage ist eindeutig: Der Bedarf
in NRW ist am größten – aber die Mittelzuweisung berücksichtigt das
nicht“, erklärt Ocke Hamann, verkehrspolitischer Sprecher von IHK
NRW. „Das gefährdet die industrielle Basis und die
Logistikdrehscheibe NRW. Wir können nicht akzeptieren, dass das Land
mit dem größten Erhaltungs- und Ersatzbedarf am Ende am wenigsten
bauen kann. NRW braucht jetzt eine faire Mittelverteilung und
Planungssicherheit. Jeder Euro, der hier eine Brückensperrung
verhindert, ist ein Gewinn für den gesamten Standort.“
IHK
NRW fordert daher, dass sich die Vergabe aus Haushalt und
Sondervermögen am tatsächlichen Instandsetzungs- und Ersatzbedarf
orientieren, nicht an formalen Kriterien. Komplexe Förderprogramme
müssen durch klare Prioritäten, schnellere Planungsverfahren und
zentrale Unterstützung für Kommunen ersetzt werden. Für
Hafenstandorte, Stahl, Chemie und Logistik sind funktionierende
Wasserwege und belastbare Brücken wirtschaftskritische Infrastruktur
– diese müssen im Sondervermögen verbindlich berücksichtigt werden.
Die besondere NRW-Betroffenheit zeigt sich bei den folgenden
Baustellen:
NRW-Baustelle Nummer 1
In NRW sind die Autobahnen
und Bundesstraßen am Limit. Deshalb gibt es praktisch keine
Reparatur ohne Ausbau. Fast jede Brücke, die ersetzt wird, bekommt
eine zusätzliche Spur. Das bedeutet: Sie kann nicht aus dem
Sondervermögen bezahlt werden.
NRW-Baustelle Nummer 2
Durch Umschichtungen der Mittel im Bundeshaushalt ist dieser nicht
so gewachsen wie gedacht. Für den Straßenbau fehlt daher dringend
benötigtes Geld. Da sehr viele Maßnahmen in NRW nicht vom
Sondervermögen profitieren, sondern auf den Haushalt angewiesen
sind, kann bei uns vergleichsweise weniger gebaut werden.
NRW-Baustelle Nummer 3
Schnell gebaut wird besonders dort, wo die
Planungen fertig sind. Das Bundesverkehrsministerium hat mit seinem
Netz zur Brückensanierung (Brückensanierungsprogramm) an Autobahnen
Prioritäten gesetzt. Ein Nachteil für NRW, denn der Anteil der als
Priorität eingestuften Streckenabschnitte ist bei uns verglichen mit
anderen Bundesländern geringer.
NRW-Baustelle Nummer 4
Auf der vom Bundesverkehrsministerium veröffentlichten Liste,
welchen Vorhaben eine Verzögerung droht, stehen besonders viele
NRW-Projekte (29 von 74). Das liegt auch daran, dass in NRW in der
Regel in hochverdichteten Räumen gebaut wird. Diese Verfahren sind
deshalb sehr komplex und leiden besonders häufig unter den hohen
Anforderungen der Planfeststellung. NRW würde folglich von den
angekündigten Schritten zur Planungsbeschleunigung sehr profitieren
– genau diese Vorhaben der Bundesregierung aber sind noch nicht
umgesetzt.
NRW-Baustelle Nummer 5
In keinem anderen
Bundesland sind die Wasserstraßen für den Betrieb der Industrie
wichtiger. Ob Stahl, Chemie, Baustoffe, Container oder Futtermittel
– in den Häfen NRWs wird rund die Hälfte der Mengen, die mit
Binnenschiffen in Deutschland transportiert werden, umgeschlagen.
Kein anderes Bundesland braucht die Wasserstraße mehr, um Straßen
und Schienen zu entlasten. Dass im Haushalt kein zusätzliches Geld
für Wasserstraßen bereitgestellt wird und die Wasserstraßen vom
Sondervermögen ausgenommen sind, trifft NRW deshalb besonders hart.
Appell an die NRW-Verkehrspolitik
IHK NRW fordert daher,
dass NRW in den finalen Haushaltsberatungen bessere Chance bekommt,
seinen Wettbewerbsnachteile auszugleichen. „Beim Zustand der
Straßen, Schienen und Wasserwege muss NRW dringend zu den anderen
Bundesländern aufschließen, sonst droht die Industrie schneller
abzuwandern, als uns lieb sein kann“, so IHK
NRW-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Mittelstädt zu den aktuellen
NRW-Baustellen.
„Unser Bundesland braucht einen adäquaten
Nachteilsausgleich. Jede Brücke, die für LKW gesperrt wird, ist eine
Vollsperrung für die Wirtschaft. Umgekehrt ist jeder Euro, der eine
Sperrung verhindert, besonders gut investiert,“ drängt abschließend
Ocke Hamann, verkehrspolitischer Sprecher von IHK NRW, auf eine
breitere Nutzung der Mittel aus dem Sondervermögen und Vergabe nach
Bedarf.
BdSt NRW vergleicht Friedhofsgebühren 2025 in Großstädten
=> Download: Tabelle Friedhofsgebühen 2025 [pdf]
Die Friedhofsgebühren in Nordrhein-Westfalen steigen weiter, wie der
Bund der Steuerzahler NRW in seinem jährlichen Vergleich unter den
30 Großstädten festgestellt hat. Bei den Sargwahlgräbern bleibt
Leverkusen teurer Spitzenreiter, bei den Urnengräbern ist es Köln.

Der BdSt-Vergleich zeigt: Mehr als 5.000 Euro kostet eine
Sargbestattung in Leverkusen. In Gütersloh sind es knapp unter 2.000
Euro. (Foto: Thomas Lammertz / BdSt NRW)
Teurer Abschied:
Friedhofsgebühren in NRW steigen
BdSt NRW vergleicht die
Gebühren für die 30 größten Städte im Land
Eine Sargbestattung in
einem einstelligen Wahlgrab kostet in diesem Jahr im
NRW-Durchschnitt 3.644 Euro – ein Plus von 4 % gegenüber 2024. Damit
liegen die Gebühren deutlich über der allgemeinen Preissteigerung
von 2,3 %.
Eine Urnenbestattung im Reihengrab ist mit 1.612
Euro im Durchschnitt nur halb so teuer. Auch hier sind die Gebühren
gestiegen, um 5 %. Sargbestattung: Leverkusen bleibt mit 5.273 Euro
Spitzenreiter bei den Sargwahlgräbern. Gütersloh ist mit 1.934 Euro
am günstigsten. Bemerkenswert ist, dass sich in Gütersloh die
kirchlichen Friedhöfe offensichtlich positiv auswirken. Sie sorgen
für Konkurrenz und halten die städtischen Gebühren im Zaum.
In einigen Städten sanken die Gebühren – etwa in Bonn (-10 %) oder
Hamm (-3 %). Andere Städte wie z.B. Bottrop (+19 %), Oberhausen (+18
%) und Neuss (+12 %) meldeten kräftige Aufschläge.
Urnenbeisetzungen: 2.452 Euro zahlt man für eine Urnenbestattung in
Köln. Mit 531 Euro ist diese Form der Beisetzung in Gütersloh am
günstigsten. Besonders auffällig sind die Steigerungen für eine
Urnenbeisetzung in Bottrop (+78 %), Oberhausen (+21 %),
Mönchengladbach (+19 %) und Neuss (+12 %). In Bonn dagegen sanken
die Gebühren um 6 %.
Die hohe Gebührensteigerung in Bottrop
ist auf die Einführung des sogenannten „Kölner Modells“
zurückzuführen. Bei dieser Art der Berechnung fallen nicht nur
Kosten für die Grabstelle an, sondern es wird anteilig auch die
Infrastruktur des Friedhofs berücksichtigt. Die Verantwortung für
die Höhe der Friedhofsgebühren liegt bei den Stadträten – sie
beschließen die jeweilige Gebührensatzung und sollten prüfen, wie
sie die Gebühren mindestens stabil halten können.
Trauerhallen und Verwaltungsgebühren: Große Preisspannen
Die
Kosten für die Nutzung der Trauerhalle fallen je nach Kommune höchst
unterschiedlich aus. In Gelsenkirchen kostet ein kleiner
Feierraum 83 Euro, in Recklinghausen sind es 385 Euro für eine
Trauerhalle. Zusätzlich verlangen viele
Friedhofsverwaltungen Verwaltungsgebühren etwa für die Genehmigung
von Grabmalen oder das Bearbeiten von Grabnutzungsrechten.
Der BdSt NRW kritisiert solche Zusatzkosten – insbesondere, wenn sie
rein formaler Natur sind. Tipp: Gebühren vorab vergleichen Gerade in
Zeiten steigender Kosten lohnt sich ein Gebührenvergleich zwischen
kommunalen und kirchlichen Friedhöfen. Angehörige sollten sich daher
frühzeitig informieren und Kosten transparent gegenüberstellen –
pietätvoll und mit Blick auf die eigene finanzielle Belastung.
Die Verantwortung für die Höhe der Friedhofsgebühren liegt bei
den Stadträten – sie beschließen die jeweilige Gebührensatzung und
sollten prüfen, wie sie die Gebühren mindestens stabil halten können
Fazit: Eine würdevolle Bestattung darf kein Kostenrisiko sein. Der
BdSt NRW fordert die Städte auf, die Belastungen für Hinterbliebene
zu begrenzen und die Gebührenstrukturen regelmäßig zu überprüfen –
im Sinne der Bürger und ihrer Angehörigen.
Der Bund der
Steuerzahler NRW berücksichtigt in seinem Friedhofsgebührenvergleich
ausschließlich die städtischen Gebühren für Grabüberlassung,
Grabbereitung und Nutzung einer Trauerhalle. Aufwendungen für eine
Kremierung, für den Bestatter, den Steinmetz und den
Friedhofsgärtner fallen zusätzlich an. Manche Städte erheben
zusätzlich eine Verwaltungsgebühr, etwa für die Genehmigung von
Grabmalen oder das Bearbeiten von Grabnutzungsrechten. Der BdSt NRW
kritisiert solche Zusatzkosten – insbesondere, wenn sie rein
formaler Natur sind.
2. Eigentümerforum Hochfeld:
Informationsabend zur Regenwassernutzung, Begrünung und
Fördermöglichkeiten
Die Stadt Duisburg und das Team vom
Stadtteilbüro Duisburg-Hochfeld laden alle Eigentümerinnen und
Eigentümer von Gebäuden in Hochfeld am Montag, 17. November, ab 18
Uhr zum 2. Eigentümerforum in die Alte Feuerwache, Friedenstraße
5-7, 47051 Duisburg, ein. Als Referenten erwarten die Teilnehmenden
Dr. Mirko Salomon, Leiter der Regenagentur Duisburg, und die
Landschaftsarchitektin Ute Ellermann.
Die Veranstaltung ist
kostenlos. Titel und Schwerpunkt des Forums ist „Für ein besseres
Stadtklima – Regenwassernutzung und Begrünungsmaßnahmen“. Jörg
Dombrowski, Architekt im Stadtteilbüro, betont die Auswirkung von
Starkregenereignissen: „Immer häufiger wird in den Medien von
Starkregenereignissen berichtet, die zum Teil erhebliche Schäden
verursachen.
Angesichts dieser Entwicklung wird für
Immobilieneigentümer ein veränderter Umgang mit der Ressource Wasser
immer drängender. Hier möchten wir mit dem Forum praktische
Hilfestellung geben.“ Die „Regenagentur Duisburg“ berät seit 2022 zu
allen Fragen des Regenwassermanagements. Dr. Salomon informiert
zudem über städtische und andere Förderprogramme.
Ute
Ellermann stellt an dem Abend Bausteine einer nachhaltigen
Regenwassernutzung vor. Dazu gehören Dach- und Fassadenbegrünungen
sowie die naturnahe Gestaltung von Hofflächen. Die
Landschaftsarchitektin gibt praktische Tipps für Begrünungen – von
der Pflanzenauswahl bis zu vertikalen Gärten. Wer Fragen zum Hof-
und Fassadenprogramm in Hochfeld hat, kann sich an Jörg Dombrowski
wenden.
Der Stadtteilarchitekt berät kostenfrei vom
Antragsverfahren bis hin zur Abrechnung einer Erneuerungsmaßnahme.
Immobilienbesitzer können so bis zu 50 Prozent der Kosten
finanzieren. Wer an dem Forum teilnehmen möchte, kann sich noch bis
Freitag, 14. November, formlos anmelden: Tel. 0203 46 808 505 oder
per Mail an
stadtteilarchitektur@stadtteilbuero-hochfeld.de.
Gesamtschule Meiderich besucht Landtag
Einen
besonderen Ausflug machten Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule
Duisburg Meiderich: die Jahrgangsstufe EF besuchte den Düsseldorfer
Landtag. Im hochmodernen multimedialen Landtagsforum wurde die
Arbeitsweise des Parlaments vorgestellt. In der anschließenden
Fragerunde mit dem Abgeordneten Frank Börner wurde ein bunter
Blumenstrauß an Themen angesprochen und diskutiert.

Foto Büro Börner
Es ging um Allgemeines wie z. B. Verwendung
von KI, Umgang mit Social-Media-Plattformen aber auch um Lokales wie
Nachhaltigkeit in Duisburg oder der Ausbau der A59. „Vielen Dank für
das Interesse und die vielen Fragen, die Klasse hatte sich
ausgesprochen gut vorbereitet. Ich freue mich immer über den
Austausch mit Kindern und Jugendlichen. So kann früh ein Verständnis
von Demokratie gelingen.“, erklärt Börner.
Christkindpostfiliale Engelskirchen eröffnet – 40 Jahre himmlische
Tradition
Auftakt: Zum 40jährigen Jubiläum eröffnen
Ministerpräsident Hendrik Wüst und DHL-Vorständin Nikola Hagleitner
die himmlische Schreibstube
Am ersten Arbeitstag des Christkindes
sind bereits fast 9.000 Wunschzettel eingetroffen
Pferd mit rosa
Stulpen, Dinosaurier, DIY-Zubehör und Labubus aktuell im Trend
Jeder Brief wird beantwortet - in 14 Sprachen und erstmals mit
interaktiver Video-Botschaft.
Engelskirchen, 12. November
2025: Sechs Wochen vor Heiligabend öffnet die Christkindpostfiliale
der Deutschen Post wieder ihre Pforten und das Christkind beginnt
mit seiner Arbeit am Engels-Platz in Engelskirchen. Seit 40 Jahren
gibt es diese beliebte Tradition in der oberbergischen Gemeinde mit
dem wohlklingenden Namen. Seit 1985 beantwortet das Christkind
gemeinsam mit zwanzig fleißigen Helferinnen und Helfern liebevoll
Wunschzettel und Briefe von Kindern aus aller Welt.

Adresse für Wunschzettel:
Weitere Infos: https://www.deutschepost.de/engelskirchen
In dieser Zeit gingen insgesamt fast 3 Millionen Zuschriften aus
rund 60 verschiedenen Ländern ein! Heute, am ersten Arbeitstag des
Christkindes in diesem Jahr, stapeln sich bereits nahezu 9.000
Wunschzettel prall gefüllt mit Herzenswünschen im „himmlischen
Wunschzettel-Büro“.
Zum Auftakt der Jubiläumssaison
eröffneten heute Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes
Nordrhein-Westfalen, und Nikola Hagleitner, Vorständin Post & Paket
Deutschland der DHL Group, die festlich geschmückte Schreibstube des
Christkindes im „Alten Baumwolllager“ in Engelskirchen.

V.l.: Lukas Miebach, Burgermeister von Engelskirchen; Nikola
Hagleitner, Vorständin Post und Paket Deutschland; Hendrik Wüst,
Ministerpräsident NRW
Ministerpräsident Hendrik Wüst: „Seit
40 Jahren schreiben Kinder aus aller Welt ihre Wünsche an das
Christkind in Engelskirchen – und sie alle erhalten eine liebevolle
Antwort. Über 130.000 Briefe aus mehr als 50 Ländern zeigen jedes
Jahr, wie lebendig diese Tradition ist und wie besonders dieser Ort
bleibt. Die Christkindpostfiliale steht für gelebtes Brauchtum und
Herzlichkeit, die unser Land prägen und den besonderen Zauber der
Vorweihnachtszeit. Mein Dank gilt allen, die mit großem Engagement
und viel Herz dafür sorgen, dass der Traum vom Christkind Jahr für
Jahr Wirklichkeit wird.“
Nikola Hagleitner: „Ich freue mich,
heute gemeinsam mit Ministerpräsident Hendrik Wüst unsere
Christkindpostfiliale in Engelskirchen zu eröffnen. Fast 3 Millionen
Wunschzettel in 40 Jahren, das hat Engelskirchen weltweit bekannt
gemacht. Dabei erzählt jeder Brief seine eigene Geschichte.
Ich
bin stolz, dass wir diese Briefe als Post & Paket Deutschland
transportieren und beantworten dürfen. Ganz besonders finde ich: Die
Briefe ans Christkind fördern Schreib- und Lesekompetenz, denn oft
ist der Wunschzettel der erste Brief, den Kinder verfassen. Einen
eigenen Brief zu erhalten – und dann noch vom Christkind – ist für
Kinder ein unvergessliches Erlebnis.“
29 Kindergartenkinder
aus Engelskirchen übergaben dem Christkind ihre Herzenswünsche
höchstpersönlich. „Jeder Brief wird gelesen und beantwortet“,
verspricht das Christkind. Die Wunschzettel-Adresse ist auf der
ganzen Welt bekannt. Sogar aus Australien, Malaysia und Singapur
sind bereits erste Briefe eingetrudelt.
Vielfältige Wünsche –
von Klassikern bis Kreativideen
Die Wunschzettel spiegeln die
ganze Bandbreite kindlicher Fantasie wider. Sie sind liebevoll
gestaltet, oftmals mit Engeln bemalt und mit Glitzer beklebt.
Teilweise sind sie sogar versiegelt oder in Form eines „Himmel- und
Hölle“-Spiels. Die ersten Wünsche, die das Christkind erreichen sind
Perlenwebrahmen, Schmuckkästchen mit Schlüssel, Piratenschiff und
Schachspiel.
Für die sechsjährige Elin darf es ein Pferd mit
rosa Stulpen sein, Via hingegen wünscht sich einen Zauberstab, eine
Meerjungfrau und Sonnencreme für Puppen. Leo aus Hamm würde sich
über eine Drohne mit Controller freuen und verspricht: „dann bist du
das beste Christkind!“ Dinosaurier sind auf der ganzen Welt beliebt,
sogar bei Yuito aus Japan stehen sie hoch im Kurs. Er schenkt dem
Christkind noch ein Origami.
Eunice aus Singapur wünscht
sich mehr Zeit und Geld zum Reisen in 2026. Alyssa aus den USA mag
Deutschlernen, aber sie schreibt „ich konjugiere nicht gern“. Sie
wünscht sich eine Reise nach Deutschland, wo sie Schlösser sehen und
Schnitzel essen kann.
Klassiker wie Bücher, Puppenwagen,
Kuscheltiere und Fahrräder sind weiterhin gefragt.
Birgit Müller,
mit 35 Jahren Arbeitsjubiläum in der Christkindpostfiliale die
dienst-älteste Helferin, sagt: „Das Christkind und wir Helferinnen
sind oftmals gerührt über den exklusiven Einblick in die
Kinderherzen. Über neueste Trends sind wir stets gut informiert.“
In diesem Jahr neu dabei: der Wunsch nach einem Labubu –
einer beliebten Sammlerfigur. Ebenso ist viel Do-It-Yourself-Zubehör
gefragt. Ebenso gemeinsame, wertvolle Zeit mit der Familie zu
verbringen, ist den Kleinen wichtig. Und – wie der kleine Lucas
schreibt: - „dass wir alle zusammen glücklich sind“. „Schenk bitte
auch den Armen etwas“, steht oftmals auf den Wünschen und Emil
mahnt: „Vergiss keine Kinder auf der Erde glücklich zu machen.“

Antworten in 14 Sprachen und Blindenschrift – Neu: mit
Videobotschaft vom Christkind
Damit alle Kinder eine persönliche
Rückmeldung erhalten, antwortet das Christkind in 14 Sprachen –
darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch, Japanisch,
Polnisch, Spanisch, Niederländisch, Tschechisch, Ukrainisch, Hindi,
Griechisch, Thailändisch und Taiwanisch – sowie individuell auch in
Blindenschrift.
Jedes Kind, das seinen Wunschzettel bis zum
18. Dezember schickt, erhält eine Antwort. Das Christkind berichtet
darin über seine Arbeit und die Vorbereitungen auf´s Weihnachtsfest.
Ein weihnachtlicher Basteltipp ist ebenfalls enthalten. Die
Antworten werden auf himmlischem Briefpapier verfasst, mit
Weihnachtsbriefmarken beklebt und einem eigenen Sonderstempel
versehen.
Neu in diesem Jahr: Per QR-Code auf dem
Antwortschreiben können Kinder sich eine Videobotschaft vom
Christkind ansehen. Damit wird das Himmelswesen auf interaktive
Weise lebendig und verzaubert die Post-Empfänger mit weihnachtlicher
Vorfreude.
Im letzten Jahr hat das Christkind 132.000
Zuschriften aus 53 Ländern beantwortet.
Diejenigen, die ihre
Wunschzettel höchstpersönlich übergeben möchten, empfängt das
Christkind in seinem himmlischer Postfiliale am Engels-Platz am 12.
Dezember 2025 zwischen 15 Uhr und 18 Uhr und am 13. und 14. Dezember
2025 jeweils zwischen 13 Uhr und 18.00 Uhr.
Geschichte
1985 tauchten erstmals Briefe in den gelben Briefkästen der
Deutschen Post auf, die „An das Christkind bei den Engeln“
adressiert waren. Schnell war den Mitarbeitern klar: Eine schnelle,
praktische Lösung muss her, um die kleinen Absender nicht zu
enttäuschen. Gefunden wurde diese Lösung in der oberbergischen
Gemeinde Engelskirchen. In der dortigen Postfiliale nahm sich eine
Mitarbeiterin der Weihnachtsbriefe an, öffnete und beantwortete sie.
So entstand die Christkindpostfiliale Engelskirchen.
Arbeit in luftiger Höhe: 190 Gerüstbauer in Duisburg
Ohne sie kommt keine Farbe ans Haus: Für jeden
Fassadenanstrich werden Gerüstbauer gebraucht – neben Malern
natürlich. Die 190 Gerüstbauer in Duisburg sind auch dabei, wenn das
Dach neu gedeckt, die Fassade gedämmt oder der Kirchturm saniert
wird. 
Bei den
Gerüstbauern in Duisburg klettern jetzt auch die Löhne nach oben
- Foto: IG BAU | Tobias Seifert
„Alles, was über drei Meter
hinausgeht, ist ein Fall für die Gerüstbauer. Sie machen einen
harten Job. Gerüstbauer sind bei Wind und Wetter, bei Hitze und
Kälte im Einsatz. Und dafür bekommen sie jetzt mehr Geld“, sagt
Karina Pfau von der Industriegewerkschaft BAU Duisburg-Niederrhein.
Ab November bekommen Gerüstbauer 7,5 Prozent mehr Lohn.
„Ein
erfahrener Geselle hat dann gut 225 Euro mehr pro Monat in der
Tasche, wenn er Vollzeit arbeitet“, sagt Karina Pfau. Das habe die
IG BAU am Tariftisch für die Gerüstbauer erreicht. Ein weiteres
Lohn-Plus gebe es dann im Herbst nächsten Jahres. „Und vorher steigt
schon der Mindestlohn in der Branche: Ab Januar muss jeder, der auf
dem Gerüst in Duisburg arbeitet, mindestens 14,35 Euro pro Stunde
verdienen. Das sind 40 Cent mehr als bislang“, so Karina Pfau.
Außerdem habe sich die Bau-Gewerkschaft für den Nachwuchs stark
gemacht. Auch Azubis haben ab diesem Monat mehr im Portemonnaie, so
die IG BAU Duisburg-Niederrhein. Zum Start der Ausbildung bekomme
ein Azubi auf dem Gerüst ab sofort 1.125 Euro pro Monat. Im zweiten
Ausbildungsjahr dann 1.300 Euro. „Und im dritten Jahr gehen
Gerüstbauer-Azubis mit einer Ausbildungsvergütung von 1.550 Euro im
Monat nach Hause“, sagt IG BAU-Bezirksvorsitzende Karina Pfau.
Wie Stressfaktoren das Leben in Flüssen formen
- Erste weltweite Auswertung
Süßgewässer
verlieren unter dem Einfluss vieler gleichzeitiger Belastungen
schneller Arten als jedes andere Ökosystem. Ein Forschungsteam um
Biolog:innen der Universität Duisburg-Essen hat nun erstmals
vergleichend analysiert, wie verschiedene Stressfaktoren weltweit
auf fünf Gruppen von Flussorganismen wirken. Die Ergebnisse,
veröffentlicht in Nature Ecology & Evolution, liefern eine Grundlage
für künftige Vorhersagen.

Versalzung ist ein weltweites Problem, vor allem in trockenen
Regionen, und betrifft Gewässer und Landlebensräume gleichermaßen. ©
Dirk Jungmann Mehr...
Am 13. November 2015 in der
BZ: Änderung in der
Führungsetage der Wirtschaftsbetriebe Duisburg
Zum Ende dieses Jahres wird es in der Führungsetage
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg eine Änderung geben. Zum
31.12.2015 verlässt Dr. Peter Greulich das Unternehmen aus
gesundheitlichen Gründen.
In der Sitzung des
Verwaltungsrates wurde die
Abberufung von Dr. Peter Greulich
als Vorstand der Wirtschaftsbetriebe aus den oben
genannten Gründen beschlossen. Ein Aufhebungsvertrag wird
das Beschäftigungsverhältnis beenden. Die Position von
Dr. Peter Greulich wird bei den Wirtschaftsbetrieben nicht
wieder besetzt. Zukünftig wird das Unternehmen mit zwei
Vorständen geführt. Die künftige Führungsstruktur sieht
weiterhin Thomas Patermann als Sprecher des Vorstands und
Uwe Linsen als Vorstand vor.

Dr. Peter Greulich mit der jetzigen Landtagsabgeordneten Petra Vogt (CDU) Foto haje
„Gehen oder Bleiben – Duisburger Jüdinnen und Juden im
Nationalsozialismus.
Eine empirische Untersuchung von
Flucht, Migration und Verfolgung“ Migration, Flucht und Vertreibung
sind zentrale Themen der Gegenwart und auch die Frage des Gehens
oder Bleibens ist nicht nur in Untersuchungen von Flucht und
Emigration relevant, sondern bis heute eine „Kernfrage der
deutsch-jüdischen Existenz“.
Johanna Ritzel präsentiert am
Donnerstag, 13. November, im Zuge der Reihe „Stadtgeschichte
donnerstags“ um 18.15 Uhr in der „DenkStätte“ im Gebäude des
Stadtarchivs am Karmelplatz 5 die Ergebnisse ihrer Masterarbeit über
die Flucht- und Emigrationsbewegungen Duisburger Jüdinnen und Juden
mittels empirischer Datenauswertung.
Es handelt sich um die
erste systematische Erfassung seit der Veröffentlichung der
„Geschichte der Duisburger Juden“ von Günter von Roden und Rita
Vogedes von 1986. Zentrale Fragen der Arbeit lauten: Wie viele der
Jüdinnen und Juden in Duisburg flohen oder emigrierten? Wann fanden
Flucht- und Emigrationswellen statt? Wohin führten diese und wie
wirkten sich Herkunft, Alter und Geschlecht darauf aus?
Gleichzeitig werden beispielhaft Biografien von Duisburger Jüdinnen
und Juden vorgestellt, um die individuellen Lebenswege und
Motivationen für „Gehen oder Bleiben“ einzubeziehen und die
Auswirkungen der Verfolgung auf das persönliche Leben und die
Selbstwahrnehmung sowie Bewältigungsstrategien darzustellen.
Die systematische Untersuchung von Emigration und Flucht kann
dazu beitragen, die dominante Vorstellung von Juden als reine Opfer
der Verfolgung zu korrigieren. Die Teilnahme ist kostenfrei; eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist allerdings
auf maximal 60 Personen beschränkt.
Friedensklänge
in der Wanheimer Kirche
Abschalten, innehalten und die
meditativen Klänge der bekannten Taizé-Gesänge auf sich wirken
lassen - das können Gottesdienstbesucherinnen und
Gottesdienstbesucher am Buß- und Bettag, 19. November 2026 um 19 Uhr
in der Wanheimer Kirche an der Friemersheimer Straße. In dem
Gotteshaus sorgt dann viel Kerzenschein für eine besondere,
stimmungsvolle Atmosphäre.
Zum Mitsingen eingeladen sind die
Gläubigen bei den meditativen Taizé-Gesängen, die vom Chor
"PraiSing" und von Instrumentalisten unter Leitung von Popkantor
Daniel Drückes angestimmt werden. Die Evangelische Rheingemeinde
Duisburg und das Taizé-Team der Gemeinde laden herzlich zum
Mitfeiern ein.
Die Communité in Taizé/Frankreich ist ein
ökumenischer Orden, der jedes Jahr tausende von Pilgern einlädt,
Ruhe und Einkehr zu finden. Aus dieser Bewegung sind die bekannten
Taizé-Gesänge hervorgegangen, die in ihrer Einfachheit und ihrem
Klang für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen.
Das
Evangelische Kirchenparlament Duisburg tagte in Meiderich
Fester Rahmen jeder Tagung des evangelischen
Kirchenparlamentes in Duisburg sind der Gottesdienst zum
Auftakt und die Andacht zum Beginn des zweiten Tages.
Bei der Zusammenkunft der Synodalen des Evangelischen
Kirchenkreises Duisburg am 7. und 8. November war das
nicht anders, und so riefen die Predigtworte von Pfarrer
Frank Hufschmidt und die mahnende Andacht von Pfarrer
Sören Asmus in Erinnerung, was zählt: Sich zu weigern, den
Traum vom Frieden aufzugeben, wie Pfarrer Hufschmidt
eindrucksvoll ausführte, und sich gegen Antisemitismus zu
wehren, indem man sich auf die Seite der Menschen stellt —
„aller Menschen“, wie Pfarrer Asmus hervorhob.
Beide Redetexte sind auf kirche-duisburg.de
nachzulesen. Die nachdenklichen Worte klangen lange nach,
auch wenn die Synodalen - die gewählten Vertreterinnen und
Vertreter aus den Gemeinden und berufene Mitglieder –
schnell vom Geschäftsalltag einer Synodentagung eingeholt
wurden: Zunächst standen Jahresberichte der Gemeinden,
Einrichtungen und Werke auf der Tagesordnung, allen voran
der Bericht des Superintendenten, dessen schriftlicher
Teil auf kirche-duisburg.de ebenfalls nachzulesen ist.

Foto Rolf Schotsch
Dem Punkt folgten Diskussion und
Verabschiedung der Haushaltspläne des Kirchenkreises und
des Bildungswerkes für das nächste Jahr. Bei der
Haushaltsplanung der Kirchensteuerverteilung des
Kirchenkreises Duisburg für das Jahr 2026 ergibt sich
dieses Bild: Mit 54.234 Mitgliedern in den 11 Gemeinden
des Duisburger Kirchenkreises gerechnet, wird für das
Haushaltsjahr 2026 eine Summe von ca. 13.263.000 Euro an
geschätztem Brutto-Kirchensteueraufkommen einkalkuliert.
Im Vorwegabzug werden Gelder für u.a.
Gemeindepfarrstellen, kreiskirchliche Pfarrstellen oder
z.B. der Trägeranteil für die Kindergartenarbeit
entnommen. Nach diesen Abzügen erhalten die Gemeinden von
der restlichen Summe von 7.385.000 Euro einen anteiligen
Verteilbetrag von 75,36 %, der Kirchenkreis 24,64%. Das
ist geringfügig weniger als im Vorjahr.
Grund,
sich zurückzulehnen gibt es nicht, denn auch die
günstigsten Prognosen zur Finanzentwicklung bis 2035 gehen
von einem starken Rückgang der Finanzmittel aus. Auf
Kirchenkreisebene läuft dazu der im Juni 2025 von der
Synode beschlossene Prozess „Wirken mit weniger“: Schon in
fünf Jahren werden bei den gemeindeübergreifenden Aufgaben
min. 800.000 Euro fehlen.
Die Zahl der
Gemeindepfarrstellen soll deshalb schrittweise von 21,5
Stellen im Jahr 2025 auf 13,75 Stellen im Jahr 2030
reduziert werden. Darüber hinaus wird eine Erhöhung der
Refinanzierungen für mischfinanzierte kreiskirchliche
Arbeitsfelder angestrebt und der Übergang des
Bildungswerkes und der Beratungsstelle in diakonische
Trägerschaft geprüft.
Im Sommer wird „Wirken mit
Weniger“ erneut auf der Tagesordnung stehen. Vor
Beratungsende zückten die Synodalen ein letztes Mal ihre
Stimmzettel und besetzen durch ihre Voten einige
Fachausschüsse. Sie wählte zudem mit großer Mehrheit
Pfarrer Tillmann Poll aus der Gemeinde Hochfeld-Neudorf
zum 2. stellvertretenden Scriba und Presbyter Oliver
Teichert aus Ruhrort-Beeck zur Stellvertretung des 3.
Synodalältesten in den Kreissynodalvorstand.
Dieses Gremium leitet den Kirchenkreis im Auftrag der
Synode zwischen ihren Tagungen. Zur nächsten Tagung kommt
die Synode des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg am
29. und 30. Mai 2025 zusammen. Infos zum Evangelischen
Kirchenkreis Duisburg, den Gemeinden und Einrichtungen
gibt es im Netz unter
www.kirche-duisburg.de.

Inflationsrate im Oktober 2025 bei +2,3 %
Inflationsrate geht nach zwei Anstiegen in Folge leicht
zurück
Verbraucherpreisindex, Oktober 2025:
+2,3 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
+0,3 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Oktober 2025: +2,3 %
zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt) +0,3 %
zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
Die
Inflationsrate in Deutschland – gemessen als Veränderung
des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat – lag
im Oktober 2025 bei +2,3 %. Im September 2025 hatte sie
+2,4 % und im August 2025 +2,2 % betragen. "Nach zwei
Anstiegen in Folge ging die Inflationsrate im Oktober
wieder leicht zurück", sagt Ruth Brand, Präsidentin des
Statistischen Bundesamtes (Destatis).
"Inflationstreibend wirkten dabei die weiterhin
überdurchschnittlich steigenden Preise für
Dienstleistungen." Gegenüber dem Vormonat September 2025
stiegen die Verbraucherpreise im Oktober 2025 um 0,3 %.

Energieprodukte verbilligten sich um 0,9 % gegenüber
Oktober 2024
Die Preise
für Energieprodukte lagen im Oktober 2025 um 0,9 %
niedriger als im Vorjahresmonat. Der Preisrückgang für
Energie hat sich damit wieder leicht verstärkt (-0,7 %
gegenüber September 2024). Von Oktober 2024 bis Oktober
2025 verbilligte sich die Haushaltsenergie um 1,7 %.
Insbesondere konnten die Verbraucherinnen und Verbraucher
von günstigeren Preisen für leichtes Heizöl (-6,0 %)
profitieren.
Etwas günstiger als ein Jahr zuvor
wurden Strom (-1,4 %) und Fernwärme (-1,0 %). Teurer unter
der Haushaltsenergie waren hingegen Erdgas (+0,9 %) sowie
Brennholz, Holzpellets oder andere Brennstoffe (+2,5 %).
Die Kraftstoffpreise erhöhten sich binnen Jahresfrist um
0,4 %.

Nahrungsmittel verteuerten sich binnen Jahresfrist
unterdurchschnittlich um 1,3 %
Die Preise für
Nahrungsmittel waren im Oktober 2025 um 1,3 % höher als im
Vorjahresmonat. Im Oktober 2025 hat sich damit der Preisauftrieb
für Nahrungsmittel deutlich abgeschwächt (September
2025 gegenüber September 2024: +2,1 %).
Eine noch niedrigere Teuerungsrate für Nahrungsmittel
wurde zuletzt im Januar 2025 erreicht (+0,8 %). Von
Oktober 2024 bis Oktober 2025 waren vor allem Speisefette
und Speiseöle (-12,6 %, darunter Olivenöl: -22,7 %;
Butter: -16,0 %) günstiger. Zudem verbilligte sich Gemüse
gegenüber dem Vorjahresmonat (-4,0 %, darunter Kartoffeln:
-12,6 %).
Einige andere Nahrungsmittelgruppen
wurden hingegen spürbar teurer als ein Jahr zuvor,
insbesondere Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren
(+8,2 %, darunter Schokolade: +21,8 %). Auch für Fleisch
und Fleischwaren (+4,3 %) sowie Obst (+3,1 %) fiel die
Preiserhöhung deutlich aus.
Inflationsrate ohne
Nahrungsmittel und Energie bei +2,8 %
Im Oktober 2025
lag die Inflationsrate ohne Energie bei +2,5 %, nach
+2,7 % im September 2025. Die Inflationsrate
ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie,
häufig auch als Kerninflation bezeichnet, verharrte im
Oktober 2025 bei +2,8 % (September 2025: +2,8 %). Beide
Kenngrößen verdeutlichen, dass die Teuerung in anderen
wichtigen Güterbereichen weiterhin überdurchschnittlich
hoch war.
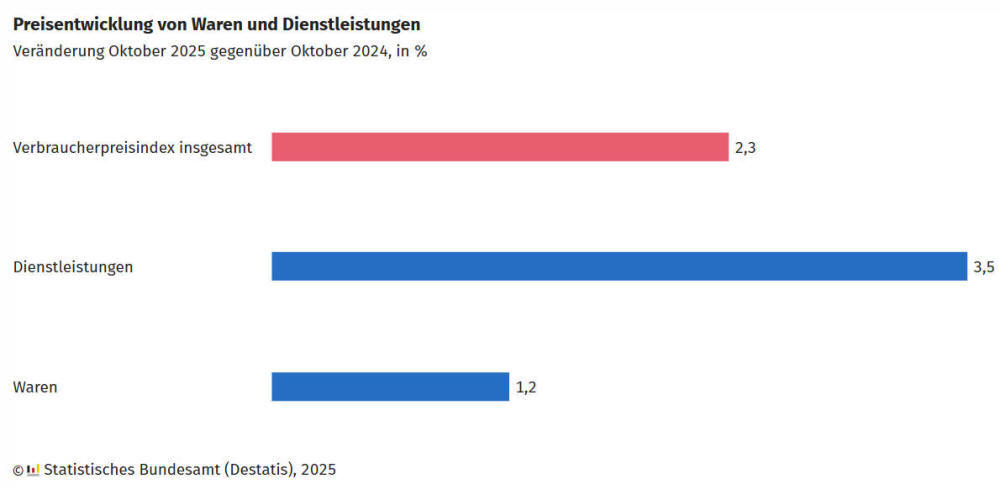
Dienstleistungen verteuerten sich binnen Jahresfrist
überdurchschnittlich um 3,5 %
Die Preise für Dienstleistungen
insgesamt lagen im Oktober 2025 um 3,5 % höher als im
Vorjahresmonat, nach +3,4 % im September 2025. Von Oktober
2024 bis Oktober 2025 erhöhten sich die Preise vor allem
für kombinierte
Personenbeförderung (+11,4 %) und Dienstleistungen
sozialer Einrichtungen (+8,0 %).
Deutlich teurer
als ein Jahr zuvor waren unter anderem auch stationäre
Gesundheitsdienstleistungen (+6,5 %), die Wartung und
Reparatur von Fahrzeugen (+5,3 %), Pauschalreisen (+5,1 %)
sowie Wasserversorgung und andere Dienstleistungen für die
Wohnung (+3,9 %).
Bedeutsam für die
Preisentwicklung insgesamt blieben auch im Oktober 2025
die Nettokaltmieten mit
+2,0 %. Dagegen waren nur wenige Dienstleistungen
günstiger als im Vorjahresmonat, zum Beispiel
Telekommunikationsdienstleistungen (-0,7 %).
Waren
verteuerten sich gegenüber Oktober 2024 um 1,2 %
Waren
insgesamt verteuerten sich von Oktober 2024 bis Oktober
2025 um 1,2 % (September 2025: +1,4 %). Die Preise für
Verbrauchsgüter stiegen dabei um 1,3 % und für
Gebrauchsgüter um 1,0 %. Neben dem Preisanstieg bei
Nahrungsmitteln (+1,3 %) wurden einige andere Waren
deutlich teurer, insbesondere alkoholfreie Getränke
(+7,2 %, darunter Kaffee
und Ähnliches: +21,3 %) sowie gebrauchte Pkw (+5,5 %).
Für die meisten Waren wurde eine moderate
Preiserhöhung ermittelt, zum Beispiel für
Bekleidungsartikel (+1,2 %) sowie für Möbel und Leuchten
(+0,9 %). Preisrückgänge waren hingegen außer bei der
Energie (-0,9 %) unter anderem bei Mobiltelefonen (-4,0 %)
und Geräten der Unterhaltungselektronik (-3,2 %) zu
verzeichnen.
Preise insgesamt stiegen gegenüber
dem Vormonat um 0,3 %
Im Vergleich zum September 2025
stieg der Verbraucherpreisindex im Oktober 2025 um 0,3 %.
Deutlich teurer gegenüber dem Vormonat wurden im Oktober
2025 Flugtickets (+19,4 %). Die Preise für Energie
insgesamt stiegen im gleichen Zeitraum geringfügig um
0,2 %. Insbesondere wurde hier Kraftstoff teurer (+0,5 %),
dagegen gaben die Preise für leichtes Heizöl nach
(-0,8 %). Die Preise für Nahrungsmittel insgesamt blieben
binnen Monatsfrist stabil (+0,0 %), unter anderem sanken
die Preise für Butter (-10,0 %) und Äpfel (-6,5 %)
deutlich.
Kosten der NRW-Krankenhäuser für die
stationäre Versorgung waren 2024 um 7,7 % höher als ein
Jahr zuvor
* 30,2 Milliarden Euro Kosten für
die stationäre Versorgung in 2024.
* Durchschnittliche
Kosten von 7.082 Euro je Behandlungsfall.
* 62 % der
Gesamtkosten entfallen auf Personalkosten.
Im Jahr
2024 summierten sich die Kosten der 316
nordrhein-westfälischen Krankenhäuser für die stationäre
Krankenhausversorgung auf rund 30,2 Milliarden Euro. Wie
Information und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt mitteilt, waren das 7,7 % mehr als
ein Jahr zuvor.

Zusammen mit den Kosten für nichtstationäre Leistungen
ergaben sich für die Krankenhausversorgung Kosten in Höhe
von rund 35,6 Milliarden Euro; das waren 7,0 % mehr als
2023. Die Zahl der vollstationären Behandlungsfälle ist im
selben Zeitraum um 1,8 % gestiegen.
Die Kosten je
Behandlungsfall erneut gestiegen
Die Pro-Kopf-Kosten
waren 2024 um 391 Euro bzw. 5,8 % höher als ein Jahr
zuvor: Umgerechnet auf alle rund 4,3 Millionen
vollstationär versorgten Patientinnen und Patienten lagen
die durchschnittlichen Kosten bei 7.082 Euro je
Behandlungsfall.
Bei 29,3 Millionen
vollstationären Berechnungs- bzw. Belegungstagen im Jahr
2024 ergaben sich für einen Krankenhaustag
durchschnittliche Kosten in Höhe von 1.029 Euro. Damit
kostete ein Belegungstag im Schnitt 72 Euro bzw. 7,5 %
mehr als im Jahr 2023.
Knapp zwei Drittel der
Gesamtkosten entfielen auf das Personal, mehr als ein
Drittel waren Sachkosten Die Personalkosten der
NRW-Krankenhäuser hatten mit 22,1 Milliarden Euro im Jahr
2024, wie auch in den Jahren zuvor, einen Anteil von
nahezu zwei Dritteln (62,0 %) an den Gesamtkosten.
Mit
36,4 % machten Sachkosten gut ein Drittel der Gesamtkosten
aus. Die restlichen 1,6 % entfielen auf Kosten für
Ausbildungsstätten, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie
Steuern.