






 |
'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |


• Sitemap •
Archiv
• 13. Kalenderwoche:
28. März
•
Baustellen •
DVG-Umleitung •
Bahn-VRR
Samstag, 29., Sonntag, 30. März 2025
 Umstellung
Winter- auf Sommerzeit: So.30.03.2025
Uhr
von 2 Uhr auf 3 Uhr.
Umstellung
Winter- auf Sommerzeit: So.30.03.2025
Uhr
von 2 Uhr auf 3 Uhr.
Zeitumstellung historisch
Zeitumstellung: Geänderte
Abfahrtszeiten für die DVG-Nachtexpress-Linien
Winterlaufserie: Buslinien machen Platz für die
Läuferinnen und Läufer
Der dritte Lauf der diesjährigen
Winterlaufserie am Samstag, 29 März, wirkt sich auf den Fahrplan der
Buslinien 928, 930, 931 und 942 der Duisburger Verkehrsgesellschaft
AG (DVG) aus. Die Kruppstraße wird zwischen Kalkweg und Masurenallee
gesperrt, die Masurenallee zwischen Kruppstraße und Wedauer Straße.
Daher müssen die Busse von ihren normalen Linienwegen abweichen.
Haltestellen werden verlegt oder entfallen ganz.
Linien 928
und 942
Die Haltepunkte „Ausbesserungswerk“ und „Barbarasee“ der
Linie 928 sowie „Elbinger Straße“ und „Ausbesserungswerk“ der Linie
942 müssen von 14.30 bis 17 Uhr entfallen. Die Haltestelle
„Kiesendahl“ wird für beide Fahrtrichtungen in den Kalkweg zu der
Haltestelle „Kiesendahl“ der Linie 934 verlegt. Die DVG bittet die
Fahrgäste die Haltestellen „Kiesendahl“ und „Wedau Bahnhof“ zu
nutzen.
Linien 930 und 931
Die Haltestellen „Wildstraße“,
„Sportpark“, „Bertaallee“, und „Regattabahn“ können in der Zeit von
13 bis 15.45 Uhr nicht angefahren werden. Die DVG bittet die
Fahrgäste die Haltestellen „Koloniestraße“ und „MSV Arena“ zu nutzen
oder auf die Linie 928 auszuweichen.
SPACEBUZZ ONE
des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) landet in
Duisburg
Duisburg greift nach den Sternen: Die
Bezirksverwaltung Duisburg-Mitte holt mit dem SPACEBUZZ ONE des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Samstag, 5.
April, ein atemberaubendes Bildungserlebnis in die Duisburger
Innenstadt. Von 13 bis 17 Uhr wird das Hightech-Fahrzeug, das von
außen wie eine Rakete aussieht, am Kuhtor seine Türen öffnen.

Fotos
©
Deutsche Raumfahrtagentur im DLR
Im Inneren der SPACEBUZZ ONE erwartet die Besucher modernste
VRTechnologie, mit der sie für 25 Minuten die Erde verlassen und aus
der Perspektive von Astronauten den Planeten umkreisen. Neben
beeindruckenden Weltraumbildern vermittelt die Reise wertvolle
Einblicke in den Klimawandel und die Bedeutung unseres
Heimatplaneten.
Mit dieser Veranstaltung wird Kindern (ab 10
Jahren) und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen gezeigt, dass
Bildung spannend, interaktiv und voller Entdeckungen ist. Ziel ist
es, die Neugier zu wecken und die Motivation an Bildung zu stärken.
Pro „Flug“ können neun Personen teilnehmen. Der Eintritt ist frei.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahmeplätze sind aber
begrenzt, deshalb kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Städtische Auszubildende helfen beim Frühjahrsputz
beim Tiergnadenhof und Jugendfarm e. V.
Für mehrere
städtische Auszubildende ging es gestern nicht ins Büro, sondern mit
festem Schuhwerk, Greifern und Müllsack in die Rheinwiesen: sie
engagierten sich ehrenamtlich für einen Social Day auf dem Gelände
vom Verein Tiergnadenhof und Jugendfarm in Duisburg-Rheinhausen.

Foto Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
Die Auszubildenden,
darunter angehende Bachelor, Kaufleute für Büromanagement und
Verwaltungsfachangestellte, packten tatkräftig an und befreiten die
Weideflächen auf dem weitläufigen Gelände von alledem, was das
Hochwasser des Rheins in den letzten Monaten angeschwemmt hatte.
Auch die Boxen und Stallungen des Gnadenhofs wurden gereinigt.
„Der Social Day bietet die Chance, über den Tellerrand
hinauszublicken und sich für das Ehrenamt zu begeistern“, sagt
Oberbürgermeister Sören Link. „Unsere Azubis haben die Gelegenheit
genutzt und sich für diese gute Sache am Gnadenhof stark gemacht.“
Die Entscheidung am Social Day mitzuwirken, fiel Bachelorstudentin
Fiona Heinke leicht: „Gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten und
somit andere zu unterstützen ist für mich sehr wichtig.
Schon kleinste Beiträge bewirken meiner Meinung nach einen
Fortschritt. Engagement bedeutet selbst aktiv zu werden. Hierzu
hatten wir heute eine gute Möglichkeit.“ Und auch der Spaß, dies mit
anderen Auszubildenden der Stadt Duisburg umzusetzen, bleibt nicht
auf der Strecke: „Wir können so unsere Gemeinschaft stärken und auch
für uns selbst einen Mehrwert mitnehmen“.

Foto Tanja Pickartz / Stadt Duisburg
Für Kurskollegin Neele
Sondermann war ebenfalls sofort klar, dass sie am Social Day
teilnehmen wird, weil sie sich bereits in ihrer Freizeit
ehrenamtlich bei den Pfadfindern im Duisburger Süden engagiert:
„Dort habe ich gelernt, wie wichtig es ist, Verantwortung zu
übernehmen und sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Die Arbeit auf
dem Gnadenhof bietet mir die Chance, diese Werte in die Tat
umzusetzen und gleichzeitig mit meinen Kolleginnen und Kollegen
einen besonderen Tag zu erleben.“
Für das Ausbildungsjahr
2025 werden insgesamt 356 Ausbildungsplätze bei der Stadt Duisburg
angeboten. Die Stadt Duisburg bietet insgesamt vielfältige
Ausbildungsmöglichkeiten an. In einigen Berufsbildern sind
Bewerbungen noch bis zum 30. März 2025 möglich. Weitere
Informationen gibt es im Internet unter www.duisburg.de/ausbildung
sowie über die Social-Media-Kanäle unter
www.facebook.de/ausbildung.DU oder
www.instagram.com/stadtduisburg_ausbildung
Steffi
Neu kommt mit ihrem Kneipenquiz nach Duisburg
Nach dem
Tourauftakt am kommenden Mittwoch in Geldern kommt Steffi Neu mit
ihrem Kneipenquiz nach Duisburg - zu Gast ist sie am Donnerstag, 3.
April, ab 19 Uhr in Paddy's Pub in Meiderich. Als Talkgast freut
Steffi sich auf Wolfgang Trepper. Der Abend ist ausverkauft.
Arbeitslosenzahlen im März: Stagnation auf dem Arbeitsmarkt
im Ruhrgebiet Im März 2025 sind im Ruhrgebiet insgesamt
282.182 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind im Vergleich zum
Vorjahresmonat (März 2024) 13.726 Personen mehr ohne Arbeit, was
einer Zunahme von 5,1 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Februar
2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 158 Personen an, was einem
Anstieg von 0,1 Prozent entspricht.
Ursächlich für die
Stagnation auf dem Arbeitsmarkt ist die anhaltend schwache
Konjunktur und die daraus resultierende verhaltene
Einstellungsbereitschaft vieler Betriebe. Erschwerend kommen
Passungsprobleme hinzu. So suchen viele Unternehmen nach wie vor gut
qualifizierte Arbeitskräfte, welche jedoch nicht zur Verfügung
stehen. Gleichzeitig fällt es vielen Arbeitssuchenden zunehmend
schwer eine passende Stelle zu finden.
Die Arbeitslosenquote
bleibt im Vergleich zum Vormonat im Ruhrgebiet konstant bei 10,3
Prozent. Die höchsten Arbeitslosenquoten verzeichnen dabei
unverändert die kreisfreien Städte Gelsenkirchen (15,2 Prozent) und
Duisburg (13,4 Prozent). Mit 7,3 Prozent weist der Ennepe-Ruhr-Kreis
ruhrgebietsweit die niedrigste Arbeitslosenquote auf. Unter den
kreisfreien Städten sind es Bottrop (8,2 Prozent) und Mülheim an der
Ruhr (8,1 Prozent).
In NRW ist die Zahl der Arbeitslosen im
Vergleich zum Vormonat um 966 Personen gesunken. Die
Arbeitslosenquote in NRW liegt im März unverändert bei 7,9 Prozent.
Hinweis für die Redaktion: Die in der Meldung genannten
Arbeitslosenzahlen für das Ruhrgebiet wurden vom Statistikteam des
Regionalverbandes Ruhr (RVR) errechnet. Sie weichen von den Daten
der NRW-Arbeitsagentur ab, da auch die Zahlen für den Kreis Wesel
eingebunden werden. idr
IMK prognostiziert 1,7 Prozent Wirtschaftswachstum
für 2026 – Investitionsprogramm wesentlicher Faktor
Die
von Union und SPD vereinbarten Finanzpakete für höhere Investitionen
haben das Potenzial, die deutsche Wirtschaft aus der hartnäckigen
Stagnation zu befreien. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP)
schrumpft im Jahresdurchschnitt 2025 zwar noch einmal leicht um 0,1
Prozent, weil die schwache konjunkturelle Entwicklung im Winter
einen hohen statistischen Einfluss hat.
Im Verlauf des
Jahres, wenn die Investitionen langsam anlaufen, nimmt die Dynamik
aber zu. Im kommenden Jahr ist dann eine deutliche Erholung zu
sehen: Im Jahresdurchschnitt 2026 wird die deutsche Wirtschaft um
1,7 Prozent wachsen. Die BIP-Entwicklung ist damit 2026 ein wenig
stärker als in den USA (1,6 Prozent) und im Durchschnitt des
Euroraums (1,5 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für
Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der
Hans-Böckler-Stiftung in seiner neuen Konjunkturprognose*.
Da der Arbeitsmarkt zeitversetzt reagiert, bringt das anziehende
Wachstum noch keine positive Trendwende bei der Arbeitslosigkeit.
Die Arbeitslosenquote steigt 2025 auf 6,2 Prozent und verharrt 2026
auf diesem Niveau. Immerhin wächst die Zahl der Erwerbstätigen nach
einem leichten Rückgang in diesem Jahr 2026 wieder – um 0,2 Prozent.
Die Inflationsrate liegt laut IMK-Prognose im Jahresdurchschnitt
2025 sowie 2026 bei 2,0 Prozent und damit genau beim Inflationsziel
der EZB.
Gegenüber seiner vorherigen Prognose vom Dezember
2024 nimmt das IMK die Wachstumserwartung beim BIP für dieses Jahr
um 0,2 Prozentpunkte zurück. Für 2026 legen die Düsseldorfer
Konjunkturexpert*innen erstmals eine Prognose vor. „Fest steht: Ohne
die jetzt absehbare Kurswende bei den Investitionen, die Einigung
mit den Grünen und die Zustimmung im Bundesrat wäre unsere
Vorhersage für 2026 deutlich niedriger ausgefallen“, sagt Prof. Dr.
Sebastian Dullien, der wissenschaftliche Direktor des IMK.
„Mit der Einigung der Union und der SPD auf ein 500 Milliarden Euro
schweres Infrastruktur-Sondervermögen wurden die Karten neu
gemischt. Wenn die öffentlichen Investitionen wie anvisiert
umgesetzt werden, könnten sie der deutschen Wirtschaft den seit
Längerem erforderlichen Nachfrageschub zur Überwindung der
Stagnation liefern, die Standortbedingungen und die Stimmung bei den
Unternehmen verbessern“, umreißen Dullien und seine
Forscherkolleg*innen das neue Konjunkturbild. Die zusätzlichen
Investitionen würden zwar zunächst langsam anlaufen – konkret
rechnen die Ökonom*innen 2025 mit 12 Milliarden Euro zusätzlich für
Infrastruktur, Klimaschutz und Verteidigung mit einem Schwerpunkt
bei der Rüstung.
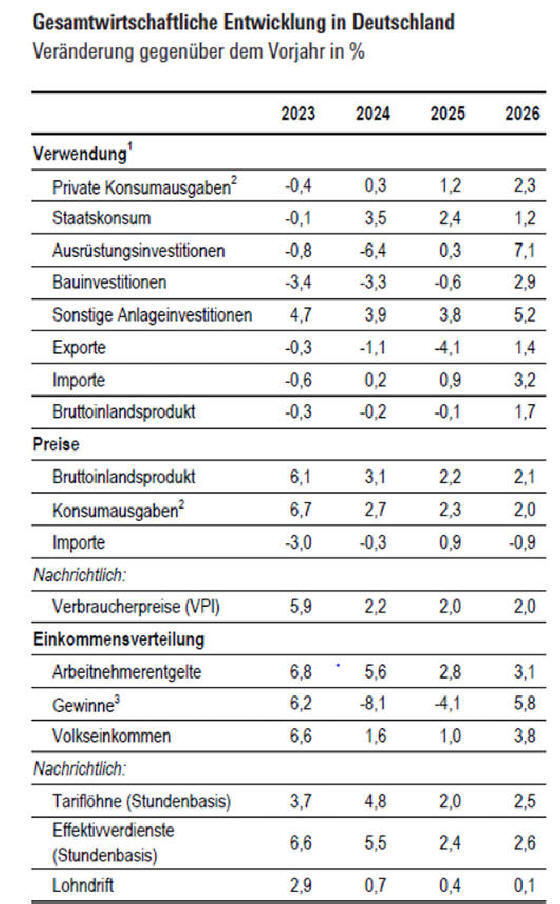
Arbeitsmarkt
Die schwache konjunkturelle Dynamik bremst in
diesem Jahr die lange Zeit positive Entwicklung der Erwerbstätigkeit
aus. Die Zahl der Erwerbstätigen nimmt im Jahresdurchschnitt 2025
leicht ab – um 0,1 Prozent. Die Arbeitslosigkeit steigt um rund
120.000 Personen auf knapp 2,91 Millionen im Jahresmittel, die
Arbeitslosenquote liegt bei 6,2 Prozent nach 6,0 Prozent 2024. Für
2025 veranschlagen die Forschenden dann wieder eine moderate Zunahme
der Erwerbstätigenzahl um jahresdurchschnittlich 0,2 Prozent. Die
Arbeitslosigkeit steigt noch einmal marginal um 10.000 Personen, die
Quote verharrt bei 6,2 Prozent.
Mehr...
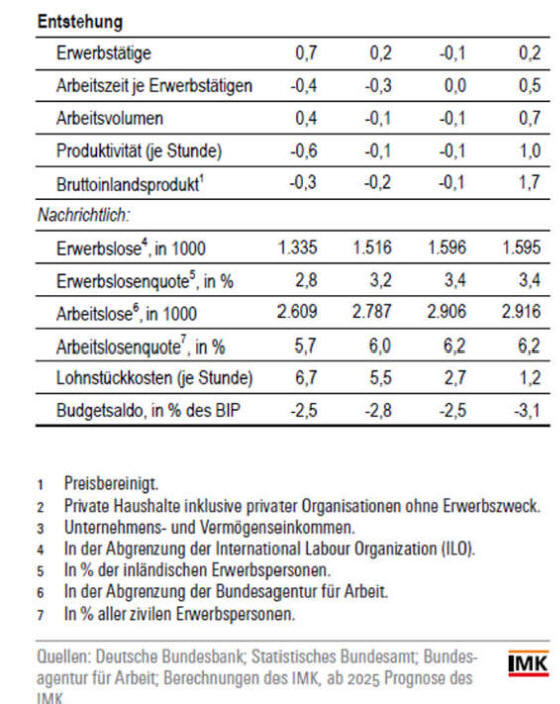
Zentralbibliothek: „Isidor“ – Spurensuche mit
Shelly Kupferberg
Die renommierte Journalistin und
Autorin Shelly Kupferberg ist am Montag, 31. März, um 20 Uhr in der
Zentralbibliothek auf der Steinschen Gasse 26 zu Gast. Sie liest aus
ihrem gefeierten Roman „Isidor“, in dem sie die bewegende
Lebensgeschichte ihres Urgroßonkels rekonstruiert – ein
faszinierendes Porträt eines außergewöhnlichen Mannes und ein Stück
lebendige Zeitgeschichte.

Mit großer erzählerischer Kraft zeichnet Kupferberg den Aufstieg und
Fall des Isidor Geller nach, der aus einem osteuropäischen Schtetl
nach Wien kommt, um sich dort seine Träume eines besseren, größeren
Lebens zu erfüllen. Zunächst führt sein Weg nur nach oben – aus
einfachen Verhältnissen arbeitet er sich bis zum angesehenen Wiener
Hofrat hoch, zum Multimillionär, Kunstfreund und Berater des
österreichischen Staates, bis die Nazis ihm alles rauben, was er
erreicht hat – materiell und immateriell.
Die Autorin hat
die Geschichte ihres Verwandten minutiös recherchiert und ist dabei
auf eine Vielzahl an Dokumenten, Fotos und persönlichen
Aufzeichnungen gestoßen. Während der Lesung wird sie nicht nur aus
ihrem Buch vortragen, sondern auch historische Materialien
präsentieren, die einen zusätzlichen Einblick in ihre Recherche und
die Vergangenheit des Isidor Geller ermöglichen.
Nach der
Lesung besteht die Möglichkeit zum Gespräch mit der Autorin. Karten
gibt es zum Preis von 6 Euro online auf
www.stadtbibliothekduisburg.de, bei eventim und den
Vorverkaufsstellen vor Ort. Die Lesung findet in Kooperation mit der
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit statt.
„Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements“ geht in
die dritte Runde
Bewerbungen bis Ende Juni möglich
Minister Oliver Krischer: „Mit dem Programm unterstützen wir
kreative Ideen aus der Zivilgesellschaft und verhelfen ihnen zu
langfristigem Erfolg“ 27.03.2025 Ob die Errichtung eines Schul-
oder Gemeinschaftsgartens, die Schaffung eines Begegnungsortes für
Umweltbildung oder die Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit – der
freiwillige Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern leistet einen
enormen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz und für eine nachhaltige
Mobilitätswende.
Um dieses bürgerschaftliche Engagement
zu fördern, startet das Umwelt- und Verkehrsministerium die dritte
Runde des Programms „Qualifizierung des bürgerschaftlichen
Engagements. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie
Organisationen können sich bis zum 30. Juni 2025 bewerben. Dafür
beschreiben sie ihre Ideen in einer Projektskizze und machen
deutlich, wofür sie fachliche Beratung benötigen.
Das
Ministerium prüft die eingereichten Vorschläge und trifft anhand
fachlicher Kriterien eine Auswahl. „Die vielen engagierten Menschen
in NRW leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und
Natur, sowie zur Mobilitätswende. Wir brauchen kreative
Lösungsansätze und Impulse aus der Zivilgesellschaft für eine
zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung“, erklärte Umwelt- und
Verkehrsminister Oliver Krischer zum Start des dritten
Programmaufrufes.
Die ausgewählten Initiativen werden von
einem Beratungsbüro über einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten bei
der Umsetzung ihrer Ideen begleitet. Umfang und Inhalt der Beratung
richten sich an den individuellen Bedürfnissen der Ehrenamtlichen
aus. Dabei reicht das Spektrum der Beratung von der Unterstützung
bei der Entwicklung einer Organisations- und Verantwortungsstruktur
über die Suche nach Mitwirkenden bis hin zur Erarbeitung von
Finanzierungsmöglichkeiten.
Mit dem Programm zur
„Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements“ unterstützt das
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Projektideen von
Vereinen, Initiativen, Einzelpersonen und gemeinwohlorientierten
Unternehmen in den folgenden Themenfeldern: Naturschutz,
Biodiversität, Artenschutz Nachhaltige Entwicklung,
sozial-ökologische Transformation Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE), Umweltbildung Anpassung an den Klimawandel,
Natürlicher Klimaschutz Klima- und Umweltschutz im Verkehr Mobilität
der Zukunft, Rad- und Fußverkehr, Verkehrssicherheit
Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, Abfallvermeidung
Umweltwirtschaft Wasserwirtschaft und Bodenschutz Immissionsschutz,
Umwelt und Gesundheit.
Informationsveranstaltung für Weiterbildungen zum
Techniker - Berufstätige können sich in Duisburg beraten lassen
Am Samstag, dem 29.03.2025 um 11:00 Uhr informiert die gemeinnützige
Bildungseinrichtung DAA-Technikum vor Ort über die
berufsbegleitenden Fortbildungs-Lehrgänge zum Staatlich geprüften
Techniker in fünf verschiedenen Fachrichtungen in der Deutschen
Angestellten Akademie (DAA), Kasinostr. 21-23, 5.OG, Seminarraum
K503 in Duisburg.
Facharbeiter, Gesellen und techn.
Zeichner der Industrie und des Handwerks aus den Bereichen
Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Mechatronik, Maschinenbau und
Metallverarbeitung, Bautechnik (Hoch- und Tiefbau), Holztechnik und
Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik können sich persönlich vor Ort über
die Aufstiegsqualifikationen informieren und u.a. spätere Dozenten
kennen lernen.
Bei der Veranstaltung wird konkret auf
folgende Themen eingegangen: Samstagsunterricht, Studienablauf und
Aufwand, aktuelle Studieninhalte, eingesetzte Software,
Zulassungsvoraussetzungen, Erwerb der Fachhochschulreife sowie
Studienfinanzierung u.a. mit dem neuen „Aufstiegs-BaföG“ und
weiteren Förderungsmöglichkeiten.
Anwesende können sich auch
zu individuellen Fragen und Problemen im Zusammenhang mit einer
beruflichen Fortbildung beraten lassen. Kostenlose ausführliche
Informationsunterlagen zu den Lehrgängen sind bei der zentralen
Studienberatung des gemeinnützigen DAA-Technikums erhältlich:
Telefonnr. 0800 - 245 38 64 (gebührenfrei) oder über das Internet:
www.daa-technikum.de
Pluto-Picknick mit Mick
Von „Sein
zu Schein“ ist es oftmals nicht ganz so weit, wenn man nur ein wenig
umdenkt! Was, wenn wir uns eine Reise von der Sonne bis zum
Zwergplaneten Pluto wünschen? „Unmöglich!“ sagt das Sein. Der Schein
hingegen denkt kurz nach und sagt: „Moment mal!“ Rikscha-Gästeführer
Mick Haering hat am Maßstab geschraubt und fliegt – natürlich
gewohnt kurzweilig und packend - in sechsfacher Lichtgeschwindigkeit
die gesamte Strecke mit Gästen ab.
Wir starten im Zentrum
unseres Sonnensystems: In Ruhrort an der kleinen Bassinbrücke. Dort
wartet bereits die Sonne (von Mick auf einen Meter im Durchmesser
geschrumpft). So „fliegen“ wir bis zum Pluto und erfahren jede Menge
spannender Geschichten und Fakten über Dimensionen, Planeten und
Illusionen.
Da die Planetenreise zu Fuß stattfindet,
sind’s am Ende nicht 5.899.900.000 Kilometer, sondern „nur“ 4,21
Kilometer entlang des Rheins. Selbst mitgebrachte Astronautenkost
wird auf dem Pluto „gepicknickt“.
Pluto-Picknick mit Mick
Treffpunkt: Dammstraße auf der blauen Brücke über dem
Eisenbahnbassin, 47119 Duisburg-Ruhrort Sonntag, 30. März 2025, 11
Uhr und 16 Uhr Eintritt: frei - Hutveranstaltungen Um
Platzreservierung wird gebeten:
https://www.eventbrite.de/e/1231589680889
Scheint so klein und ist so groß | Literarisches
Menu
Am Samstag um 19:00 Uhr lädt das Team der
Ruhrorter HOFkultur ein ins Das PLUS am Neumarkt zum literarischen
Menu in der Ausstellung "Scheint so klein und ist so groß" zu den
46. Duisburger Akzenten "Sein und Schein".
Die
kulinarischen Happen werden von der Kombüse der Ankerbar serviert,
die literarischen Menupunkte servieren Barbara Wedekind und Folkert
Küpers. Die musikalischen Zwischenhappen liefert
Hoflieferanten-Akkordeonist Ivan Zsymbal.

Foto Iris Frank-Graefen
Für die bei dieser Veranstaltung
gereichten Speisen fällt eine Unkostenbeteiligung von 12,50 € pro
Person an. Wegen der begrenzten Plätze ist auch eine
Platzreservierung nötig. Anmeldung über „Ankerbar“, Tel. 0203
48455800 oder
ankerbar.duisburg@gmail.com
Scheint so klein und ist so
groß | Literarisches Menu Samstag, 29. März 2025, 19 Uhr Das PLUS am
Neumarkt, Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort
ruhrKUNSTort an der Fabrikstraße in
Ruhrort
Ab dem 29.03.2025 wieder
eine Gäste-Ausstellung im ruhrKUNSTort an
der Fabrikstraße 23 in Duisburg-Ruhrort
stattfindet. Die Vernissage zur Ausstellung
ist am 29.03. ab 17:00 Uhr. Thematisch und
inhaltlich passt die Ausstellung sehr gut
zum diesjährigen Motto der „Duisburger
Akzente - Schein und Sein”.
Weitere
Informationen zur Ausstellung: (wie)
gemalt! Vom 29. März bis 1. Mai 2025 sind
die beiden Künstlerinnen Siggi. und Sandra
Schwidurski mit ihren Werken zu Gast in der
Galerie ruhrKUNSTort in Duisburg-Ruhrort.
Siggi. malt ihre abstrakten Bilder in Acryl
auf Leinwand. Dabei sorgt ein
vielschichtiger Farbauftrag für eine gewisse
Tiefe und Struktur.

Die Naturfotografin Sandra Schwidurski
gestaltet ihre Bilder mit der Kamera, so
dass diese wie gemalt oder
malerisch-poetisch wirken. Inspiriert wird
sie dabei von der impressionistischen
Malerei, bei der flüchtige Momente und
Stimmungen im Mittelpunkt stehen.
Imagine - I have a Dream | conterBande
Braun, schwarz, gelb oder weiß. Liberté, Égalité, Fraternité.
Scheißdreck! Menschenrechte sind keine Selbstverständlichkeit –
sie müssen geschützt, gepflegt und gelebt werden. Unter diesem
Leitgedanken lädt die Gruppe conterBande ( Adriana Kocijan, Dijana
Brnić) zur Performance ein, die am Sonntag um 18 Uhr im Lokal
Harmonie im Kreativquartier Ruhrort stattfindet.

Conterbande by Andrè Szymann
Imagine – I have a Dream
Sonntag, 30.3.2025, 18:00 Uhr Lokal Harmonie, Harmoniestr. 41, 47119
Duisburg Eintritt: frei - Hutveranstaltung Eine Veranstaltung des
Kreativquartier Ruhrort zum Kulturfestival 46. Duisburger Akzente
"Sein und Schein"
Große Besetzung für Dvoraks Geisterbraut in der
Salvatorkirche
Gänsehaut pur ist garantiert, wenn im
Rahmen der Duisburger Akzente am 30. März um 17 Uhr in der
Salvatorkirche die Duisburger Erstaufführung von Antonin Dvoraks
Meisterwerk „Die Geisterbraut“ zu hören ist. Die Gespensterballade
besteht aus einem Tumult der Gefühle zwischen Sehnsucht, Grauen,
Hoffnung, Verzweiflung und am Ende Erleichterung.
Das
Werk nach einem Gedicht von Jaromír Erben hat so viel
szenisch-dramatisches Potenzial, dass es auch als Opern-Einakter
durchgehen könnte. In großer Besetzung singen und spielen die
Salvatorkantorei, die Solistinnen und Solisten Inga-Britt Andersson,
Martin Koch, Peter Schöne sowie Mitglieder der Duisburger
Philharmoniker unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Marcus
Strümpe.
Karten zu 26 Euro, ermäßigt 16 Euro gibt es unter
www.westticket.de und an der Abendkasse. Infos zur Musik in der
Gemeinde gibt es im Netz unter www.ekadu.de und
www.salvatorkirche.de.

Mitglieder der Kantorei der Salvatorkirche im Jahr 2015 (Foto:
www.salvatorkirche.de
Mode-Tag beim Weltladen Duisburg - mit Fair-Fashion-Show
Das Team des Weltladens Duisburg lädt herzlich zum
Mode-Tag am 29. März 2025 in das Neudorfer Geschäft an der
Koloniestr. 92 ein. Zwischen 10 und 15 Uhr ist Stöbern in der
neuen Frühjahrs- und Sommerkollektion von Mode und Schmuck gerne
gesehen. Um 13 Uhr wird der Weltladen mit der Fair-Fashion-Show zum
Laufsteg.

Fair bedeutet, dass die Menschen, die die Produkte herstellten,
Sozialleistungen und faire Löhne erhielten, was keine
Selbstverständlichkeit in vielen Ländern der Welt ist. „Wenn Sie bei
uns ein T- Shirt einkaufen, dann wissen Sie wo es gemacht wurde,
woraus es besteht und dass die Produzenten, die Näherinnen und Näher
faire Löhne erhalten“ sagt Andrea Nadolny vom Weltladen.
Der Duisburger Weltladen ist ein Fachgeschäft des fairen Handels
und wird als Verein seit über 40 Jahren durch ausschließlich
ehrenamtliche Mitarbeitende geführt und wirtschaftlich erfolgreich
betrieben. Mehr Infos zum Weltladen gibt es unter
www.weltladen-duisburg.de oder unter Tel.: 0203 / 358692
bzw.weltladenduisburg@t-online.de.

Ehrenamtliche des Weltladens bei einem Planungstag im Januar 2025.
Neumühl:Kunst, Musik und Literatur „Literatur-
und Kulturwelt Deutschland“
Am Sonntag, 30. März, ist
das Team der „Literatur- und Kulturwelt Deutschland“ zu Gast in der
Gnadenkirche am Neumühler Markt, Hohenzollernplatz/Obermarxloher
Straße. In Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde
Duisburg Neumühl startet um 15 Uhr das neue Veranstaltungsformat
„Kultur unterm Kirchturm“ mit Kunst, Musik und Literatur. Dann sagt
die Duisburger Künstlerin Gabi Schwarz „Bitte Platz nehmen.“
Damit weist sie auch auf ihre bunten Kunststühle hin, die
optisch-kunstvolle Hingucker sind, auf denen man aber während der
Veranstaltung auch sitzen, staunen, zusehen und zuhören kann. Zudem
zeigt die weit über die Grenzen der Region hinaus anerkannte
Künstlerin weitere Bilder und Exponate ihres kreativen Schaffens und
steht den Besuchern für Gespräche gerne zur Verfügung.
Den
literarischen Teil bei Kultur unterm Kirchturm übernehmen die
Autoren Dieter Ebels und Uwe Daniel. Ebels, der als Neumühler in der
Gnadenkirche ein Heimspiel hat, liest aus seinem aktuellen Krimi
„Das Schwert des Damokles“, gibt aber zugleich Kostproben aus
weiteren seiner zahlreichen Veröffentlichungen. Uwe Daniel
präsentiert mit- und einnehmend sein aktuelles Geschichtenbuch
„Tränen auf der Autobahn“, eine berührende Lovestory.
Henrick verbringt ein paar Wochen an der Ostsee und lernt den
charmanten Tim kennen und lieben. Henrick erlebt einige skurrile
Begebenheiten. Auch die Musik kommt nicht zu kurz. Improvisationen,
Eigenkompositionen und bekannte Songs von Christian Märtin (E-Piano)
vervollständigen das Kulturangebot. Moderiert wird die Veranstaltung
von Presbyter Reiner Terhorst.
Schon in der Pause bei Kaffee
und Kuchen gibt es reichlich Gelegenheit zum Kennenlernen der
Akteure und anregenden Small-Talks. Der Eintritt zu dem etwa
zweistündigen Kulturevent, Einlass ab 14.30 Uhr, ist frei. Eine
Spende für weitere Initiativen der Kirchengemeinde ist natürlich
gerne gesehen. Reiner Terhorst

Mitglieder der „Literatur- und Kunstwelt Deutschland“ mit
Verantwortlichen der Neumühler Gemeinde bei den Planungen für die
„Kultur unterm Kirchturm“ am 30. März (Foto: Sebastian Schulz).

13,8 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
nutzten 2020 die Pendlerpauschale - Gut die Hälfte der
Pendler/-innen mit Jahresbruttolohn von 20 000 bis unter 50 000 Euro
Im Zuge der Koalitionsverhandlungen wird auch eine
Erhöhung der Pendlerpauschale diskutiert. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) auf Basis der Daten aus den Steuererklärungen
mitteilt, nutzten im Jahr 2020 rund 13,8 Millionen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer die Entfernungspauschale, auch Pendlerpauschale
genannt.
Auf ihrem Weg zur Arbeit legten sie
durchschnittlich 28 Kilometer zurück. Hierbei wurden nur Fälle
erfasst, bei denen die Werbungskosten über dem
Arbeitnehmer-Pauschbetrag von damals 1 000 Euro lagen. Diejenigen,
die unterhalb dieses Betrags blieben, gaben ihre gependelten
Kilometer häufig nicht in ihrer Steuererklärung an beziehungsweise
reichten gar keine Steuererklärung ein. 84 % der Pendlerinnen und
Pendler (11,6 Millionen) nutzten zumindest für einen Teil der
Strecke das eigene Auto.
Großteil der Pendler/-innen mit
Jahresbruttolohn zwischen 20 000 und 100 000 Euro Ein Großteil der
Pendlerinnen und Pendler hatte ein mittleres Einkommen: Mehr als die
Hälfte (54 %) von ihnen erhielt einen jährlichen Bruttolohn von
20 000 bis unter 50 000 Euro, bei weiteren 30 % lag er zwischen
50 000 und 100 000 Euro im Jahr. Unter 20 000 Euro verdienten 11 %
aller Pendlerinnen und Pendler, mindestens 100 000 Euro 5 %.
Insgesamt machten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
die Pendlerpauschale nutzten, 43 % aller veranlagten Steuerfälle mit
Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit aus. Der Anteil war bei
Pendlerinnen und Pendler mit einem jährlichen Bruttolohn von 50 000
bis unter 100 000 Euro am höchsten (62 %). Bei einem Bruttolohn von
mindestens 100 000 im Jahr lag er bei 56 %, bei 20 000 bis unter
50 000 Euro brutto jährlich bei 49 %.
Unter den
veranlagten Steuerfällen mit einem Jahresbruttolohn von unter 20 000
Euro machten 17 % von der Pendlerpauschale Gebrauch. Personen
außerhalb von Großstädten pendelten im Schnitt weiter Die Längen der
Pendelstrecken unterscheiden sich je nach Wohnort. Lebten
Pendlerinnen oder Pendler in einer Großstadt mit mindestens 100 000
Einwohnerinnen und Einwohnern, legten sie durchschnittlich rund 24
Kilometer zur Arbeit zurück.
In Mittelstädten mit 20 000
bis unter 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern waren es mit 29
Kilometern bereits 5 Kilometer mehr. In Kleinstädten mit 5 000 bis
unter 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie in Landgemeinden
betrug der durchschnittliche Arbeitsweg 30 beziehungsweise 31
Kilometer. Je ländlicher eine Person wohnte, desto häufiger fuhr sie
zudem mit dem Auto. In Großstädten gaben 68 % der Pendlerinnen und
Pendler an, zumindest für einen Teil der Strecke das Auto zu nutzen.
In Mittel- und Kleinstädten betrug der Anteil 87 % beziehungsweise
91 %, in Landgemeinden 93 %.
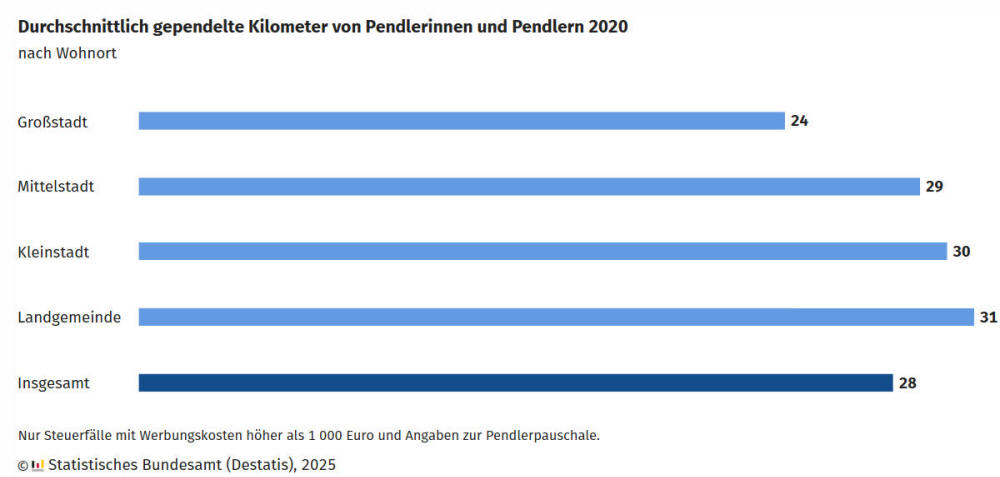
Öffentliche Schulden im 4. Quartal 2024 um 2,6 % höher
als Ende 2023
Öffentlicher Schuldenstand steigt um 63,9
Milliarden Euro
Der Öffentliche Gesamthaushalt war beim
nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende 2024 mit 2 509,0
Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, stieg die
öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem Jahresende 2023 um 2,6
% oder 63,9 Milliarden Euro.
Gegenüber dem 3. Quartal 2024
stieg die Verschuldung um 0,8 % oder 20,5 Milliarden Euro. Zum
Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte von Bund, Ländern,
Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung
einschließlich aller Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich
gehören Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und
ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und
Ausland.
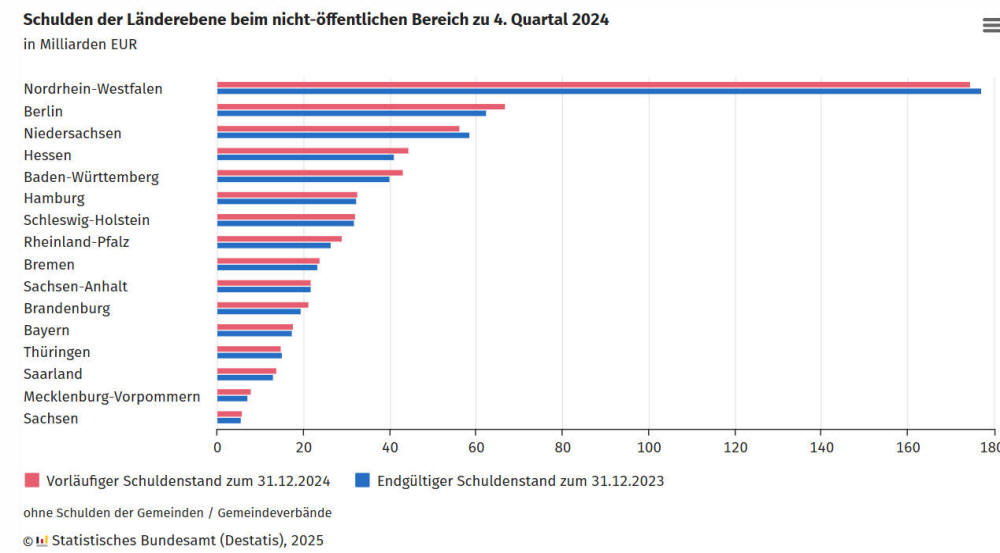
Schulden des Bundes steigen um 2,1 %
Die
Schulden des Bundes waren zum Ende des 4. Quartals 2024 um 2,1 %
beziehungsweise 36,5 Milliarden Euro höher als Ende 2023. Ursächlich
hierfür war insbesondere der Anstieg der Verschuldung des
"Sondervermögen Bundeswehr" um 295,6 % oder 17,2 Milliarden Euro auf
nunmehr 23,0 Milliarden Euro. Die Verschuldung des Sondervermögens
"Wirtschaftsstabilisierungsfonds Corona" hingegen sank binnen
Jahresfrist um 40,2 % oder 14,9 Milliarden Euro auf
22,1 Milliarden Euro.
Gegenüber dem 3. Quartal 2024 stieg die
Verschuldung des Bundes um 0,8 % oder 13,6 Milliarden Euro.
Schulden der Länder erhöhen sich ebenfalls um 2,1 % D
ie Länder
waren zum Ende des 4. Quartals 2024 mit 606,9 Milliarden Euro
verschuldet, das waren 2,1 % oder 12,7 Milliarden Euro mehr als zum
Jahresende 2023.
Gegenüber dem 3. Quartal 2024 stieg die
Verschuldung der Länder um 0,1 % oder 796 Millionen Euro. Am
stärksten stiegen die Schulden gegenüber dem Jahresende 2023
prozentual in Mecklenburg-Vorpommern (+10,9 %), Rheinland-Pfalz
(+9,7 %), Brandenburg (+8,9 %) und Hessen (+8,3 %). In
Mecklenburg-Vorpommern wurden auslaufende Kredite beim öffentlichen
Bereich am Kapitalmarkt (nicht-öffentlicher Bereich) teilweise
refinanziert.
Der Schuldenanstieg in Rheinland-Pfalz ist
im Wesentlichen dadurch begründet, dass im Rahmen des Programms
"Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz"
(PEK-RP) zum 31. Dezember 2024 insgesamt 2,8 Milliarden Euro an
kommunalen Kassenkrediten vom Land übernommen wurden. Dadurch sank
im Gegenzug die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände in
Rheinland-Pfalz.
Schuldenrückgänge gegenüber dem Jahresende
2023 wurden lediglich für Niedersachsen (-4,1 %), Thüringen
(-1,8 %), Nordrhein-Westfalen (-1,5 %) sowie Sachsen-Anhalt (-0,8 %)
ermittelt. Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände wachsen um
9,5 % Auch bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden nahm die
Verschuldung zum Ende des 4. Quartals 2024 gegenüber dem Jahresende
2023 zu.
Sie stieg um 9,5 % oder 14,7 Milliarden Euro auf
169,4 Milliarden Euro. Gegenüber dem 3. Quartal 2024 erhöhten sich
die kommunalen Schulden um 3,7 % oder 6,1 Milliarden Euro. Den
höchsten prozentualen Schuldenanstieg gegenüber dem Jahresende 2023
wiesen dabei die Gemeinden und Gemeindeverbände in
Mecklenburg-Vorpommern (+17,7 %) auf, gefolgt von Sachsen (+17,3 %),
Niedersachsen (+15,0 %), Bayern (+14,0 %) und Nordrhein-Westfalen
(+12,8 %).
Einen Rückgang der Verschuldung gab es lediglich
in Rheinland-Pfalz (-21,3 %) wegen des Entschuldungsprogramms PEK-RP
sowie in Thüringen (-4,0 %) und im Saarland (-0,3 %). Die
Verschuldung der Sozialversicherung sank im 4. Quartal 2024
gegenüber dem Jahresende 2023 um 1,4 Millionen Euro (-3,5 %) auf
39,5 Millionen Euro.
Zeitumstellung
 Uhr 1 Stunde vorstellen |
 Im Oktober Uhr 1 Stunde zurückstellen |
Im März Uhr um eine Stunde auf die Sommerzeit vorstellen - im Oktober um eine Stunde zurückstellen
Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Sommerzeit wieder eingeführt.
Unmittelbar nach dem Krieg wurde die
jährliche Umstellung auf Sommerzeit von den westlichen Besatzungsmächten
bestimmt. 1947 wurden die Uhren zwischen
dem 11. Mai und 29. Juni im Rahmen der so genannten Hochsommerzeit zwei
Stunden vorgestellt. Diese endete mit Ende des Jahres 1949. Ursprünglich
galt die MESZ in Deutschland für die Zeit zwischen dem letzten Sonntag
im März und dem letzten Sonntag im September. Von 1950 bis 1979 gab es
in Deutschland keine Sommerzeit.
Die erneute Einführung der Sommerzeit wurde in der „alten“
Bundesrepublik 1978 beschlossen, trat jedoch erst 1980 in Kraft.
Zum einen wollte man sich bei der Zeitumstellung den westlichen
Nachbarländern anpassen, die bereits
1977 als Nachwirkung der Ölkrise von 1973 aus energiepolitischen Gründen
die Sommerzeit eingeführt hatten. Zum anderen musste man sich mit der
DDR über die Einführung der Sommerzeit einigen, damit Deutschland und
insbesondere Berlin nicht zusätzlich noch zeitlich geteilt war.
Die
Bundesrepublik und die DDR führten die Sommerzeit zugleich ein, das
diente der Harmonisierung. In der DDR regelte die Verordnung über die
Einführung der Sommerzeit vom
31. Januar 1980
die Umstellung.
Von 1981 bis 1995 begann in Deutschland die Sommerzeit am letzten
Sonntag im März um 2.00
Uhr MEZ und endete am letzten Sonntag im September um 3.00 Uhr MESZ.
Durch die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Sommerzeitregelungen
in der Europäischen Union wurde die Sommerzeit 1996 in Deutschland um
einen Monat verlängert und gilt seitdem vom letzten Sonntag im März um
2.00 Uhr MEZ bis zum letzten Sonntag im Oktober um 3.00 Uhr MESZ. (Richtlinie 2000/84/EG des Europäischen
Parlamentes).
Die Zeit
Man kann die Zeit am Lauf der Gestirne oder mit Atomuhren präzise
messen. Uns allen steht am Tag gleich viel davon zur Verfügung,
nämlich 24 Stunden. Die Zeit ist somit etwas Objektives. Dennoch hat
Zeit auch eine subjektive Dimension. Möchten Sie nicht auch in
schönen Momenten die Zeit anhalten? Scheint sie nicht in anderen
Fällen zu kriechen oder dann wieder rasend schnell zu vergehen,
fragte einmal Johann
Hahlen, Präsident des Statistischen Bundesamtes.
Drei Stunden täglich wenden Personen ab 10 Jahren im Durchschnitt für
Bildung und Erwerbstätigkeit auf. Eine halbe Stunde mehr Zeit ( 3
Stunden) wird mit unbezahlter Arbeit für Haushalt und Familie und mit
Ehrenämtern verbracht. Ein gutes Drittel seiner Zeit verschläft der
Durchschnittsmensch und rund 2 stunden braucht er für persönliche Dinge
wie Anziehen, Körperpflege und Essen. Gut 25 % des Tages - das sind
sechs Stunden - nehmen Freizeitaktivitäten wie Fernsehen, Sport, Hobby
und Spiele sowie das soziale Leben in Anspruch.
Frauen leisten mehr unbezahlte Arbeit und wenden mehr Zeit für soziale
Kontakte. Dagegen stehen bei den Männern Erwerbstätigkeit sowie Spiele
und die Mediennutzung stärker im Vordergrund. Im Vergleich zum Anfang
der 90er Jahre wird in Deutschland weniger gearbeitet, sowohl bezahlt
als auch unbezahlt. Dafür steht mehr Freizeit und mehr Zeit für
persönliche Dinge wie das Essen zur Verfügung.
In anderen Ländern mit vergleichbaren Erhebungen beansprucht
insbesondere die Erwerbstätigkeit - hier ohne den Weg zur Arbeit - mehr
Zeit als die durchschnittlich 2 Stunden pro Tag bei Männern und 1 œ
Stunden bei Frauen in Deutschland. In Ländern wie Finnland und
Großbritannien, in denen deutlich mehr Personen erwerbstätig sind, wird
insgesamt bis zu einer halben Stunde pro Tag mehr gegen Bezahlung
gearbeitet. Dafür ist hier die unbezahlte Arbeit eine Viertelstunde
geringer als in Deutschland oder Belgien.
Personen, die vollzeiterwerbstätig sind, arbeiten über die Woche von
Montag bis Sonntag verteilt durchschnittlich knapp fünf Stunden pro Tag.
Wenn sie zu Hause sind, wartet weitere Arbeit auf sie: Das Essen
vorbereiten, die Kinder ins Bett bringen und andere unbezahlte Arbeiten
nehmen etwas mehr als 2 œ Stunden in Anspruch. Das ist eine Stunde
weniger unbezahlte Arbeit als im Durchschnitt der gesamten erwachsenen
Bevölkerung.
Zur Entspannung lesen, fernsehen, ab und zu zum Sport und
seinen Hobbys nachgehen - das macht insgesamt 3 Stunden aus. Knapp zwei
Stunden werden für das soziale Leben aufgebracht. Für Schlafen, Essen
und Körperpflege bleiben dann noch 10 Stunden.
Rentner machen durchschnittlich 4 Stunden Hausarbeit über den ganzen Tag
verteilt und von vielen Pausen unterbrochen. Zwischendurch lesen sie,
sehen fern oder gehen spazieren - alles in allem knapp fünf Stunden
täglich.
Da Rentner oft allein leben, ist die tägliche Stunde an
Gesprächen, Telefonaten und Besuchen von Verwandten oder Bekannten für
sie sehr wichtig. Nahezu ebensoviel Zeit nehmen der Besuch von
Veranstaltungen und die Ruhepausen während des Tages in Anspruch. Für
Schlafen, Körperpflege und Essen nehmen sie sich mit gut 11 Stunden mehr
Zeit als in jüngeren Jahren. Vieles dauert im Alter einfach älter.
Die bezahlten Arbeitsstunden, die die Bevölkerung in Deutschland
einbringt, fließen in jedem Quartal in die Größe des
Bruttoinlandsprodukts ein. Das Bruttoinlandsprodukt ist der am
häufigsten gebrauchte Maßstab für die wirtschaftlichen Leistungen einer
Volkswirtschaft.
Doch gearbeitet wird nicht nur gegen Bezahlung.
Unbezahlte Arbeit wird in beträchtlichem Umfang in den privaten
Haushalten von und für die Familie erbracht. Diese unbezahlten
Tätigkeiten umfassen mehr Stunden als die bezahlte Arbeit. In Zahlen
bedeutet das, daß über die ganze Woche verteilt alle Personen ab 10
Jahren durchschnittlich gut 25 Stunden unbezahlt, bezahlt dagegen etwa
17 Stunden arbeiten.
Die Bewertung der unbezahlten Arbeit in Euro ist ein schwieriges
Unterfangen. Eine sinnvolle Bewertung besteht darin, den Stundenlohn
einer Hauswirtschafterin heranzuziehen. Diese Personen erledigen und
organisieren alle Arbeiten im Haushalt.
Da mit der unbezahlten Arbeit
keine soziale Absicherung verbunden ist, also keine oder nur geringe
Ansprüche an die Renten-, Arbeitslosen- oder Krankenversicherung
entstehen, erscheint aus dieser Perspektive eine Bewertung mit dem
Nettolohn angemessen. Dieser betrug 1992 knapp 6 Euro, in 2001 gut 7
Euro je Stunde. Obwohl das Jahresvolumen in Stunden zurückgegangen ist,
ist der Wert der unbezahlten Arbeit im Haushalt damit von 603 Milliarden
Euro in 1992 auf 684 Milliarden Euro in 2001 angestiegen.
Nicht alles, was im Haushalt produziert wird, beruht allein auf
unbezahlter Arbeit. So werden für ein Mittagessen Zutaten eingekauft und
dauerhafte Gebrauchsgüter wie Kühlschrank oder Herd genutzt. Auch muss
die Küche entsprechend groß und ausgestattet sein, was Kosten für die
Kücheneinrichtung mit sich bringt.
Der Gesamtwert der unbezahlten
Produktion im Haushalt, der alle diese Komponenten einbezieht, war 2001
mit 1121 Milliarden Euro um 22 % höher als im Jahre 1992. Der Wert der
Produktion im Haushalt, der bei Unternehmen am ehesten mit dem Umsatz
vergleichbar wäre, ist somit deutlich stärker angestiegen als der Wert
der unbezahlten Arbeit mit 13 % und etwas stärker als der
Verbraucherpreisindex, der in diesem Zeitraum um gut 18 % zulegt.
In
2001 entfielen 61 % des Wertes der Produktion auf unbezahlte Arbeit und
27 % auf Käufe von Gütern, die mit der Haushaltsproduktion verbraucht
werden. Die Abschreibungen auf die im Haushalt genutzten dauerhaften
Gebrauchsgüter hatten nur einen Anteil von 3 %.
Insbesondere die Haus- und Gartenarbeit sowie die Pflege und Betreuung
von Kindern und anderen Haushaltsmitgliedern werden nach wie vor
überwiegend von Frauen durchgeführt.
Während sich bei der Haus- und
Gartenarbeit das Verhältnis des Zeitaufwands von Frauen und Männern im
früheren Bundesgebiet von 2,7 auf 2,3 und in den neuen Bundesländern von
gut 2,2 auf knapp 1,9 verbesserte, ergibt sich bei der Pflege und
Betreuung von Kindern bzw. anderen Haushaltsmitgliedern zumindest im
früheren Bundesgebiet ein anderes Bild.
Hier hat sich die Arbeitsteilung
sogar noch weiter zu Ungunsten der Frauen verschoben. Je nach Alter, der
Einbindung ins Berufsleben und der Familienstruktur arbeiten die Frauen
zwischen einer Dreiviertelstunde und 4 Stunden mehr im Haushalt.
In den
Paarhaushalten sind Männer nach wie vor für Reparaturen und
handwerkliche Aktivitäten zuständig. Daneben beteiligen sie sich
insbesondere an Einkauf und Haushaltsplanung. In Paarhaushalten mit
Kindern, in denen nur der Partner erwerbstätig ist, beteiligen sich
Männer zu 34 % an den Einkäufen. Sind beide erwerbstätig, werden 39 %
der Einkäufe von Männern erledigt (jeweils eine halbe Stunde). Bei
Rentnerehepaaren investieren die Männer sogar mehr Zeit in den Einkauf
und die Haushaltsplanung als die Frauen.
Das Leben der Frauen in den neuen Bundesländern war Anfang der 90er
Jahre ganz wesentlich von der Erwerbstätigkeit bestimmt. Die
Erwerbszeiten von erwerbstätigen Frauen, die in Paarhaushalten mit
Kindern leben, haben zwar seitdem abgenommen. Trotzdem wenden diese
Frauen in 2001 / 2002 von Montag bis Freitag mit durchschnittlich 6 Œ
Stunden deutlich höhere Zeiten für Erwerbstätigkeit und Bildung auf als
im früheren Bundesgebiet mit knapp 4 Stunden.
In den neuen Bundesländern
ist der Anteil der vollzeiterwerbstätigen Mütter immer noch höher und
teilzeiterwerbstätige Mütter arbeiten länger als im früheren
Bundesgebiet.
Die tatsächlich praktizierte Arbeitsteilung besagt nichts darüber, ob
die Menschen nach ihrer eigenen Einschätzung über genügend, zu wenig
oder zu viel Zeit für eigene Lebensbereich verfügen. Generell gilt:
Sowohl bei Paaren mit Kindern als auch bei Paaren ohne Kind betrachtet
die Mehrheit ihren Zeitaufwand für Beruf und Qualifikation bzw. für die
Hausarbeit als gerade richtig.
Etwa zwei Fünftel der Bevölkerung finden neben Erwerbstätigkeit und
familiären Aufgaben Zeit für bürgerschaftliches Engagement. Das
Engagement in einer Elternvertretung kann ebenso dazu zählen wie die
Initiative im Mütterzentrum oder die Übungsleitung im Sportverein. Im
breiten Feld bürgerschaftlichen Engagements bildet das Ehrenamt im
engeren Sinne ein wichtiges Element. Immerhin 18 % der Erwachsenen
nehmen sich Zeit für ein Ehrenamt.
In welchem zeitlichen Umfang einer
solchen Aufgabe nachgegangen wird, ist nicht zuletzt vom familiären
Rahmen und der Einbindung in das Erwerbsleben bestimmt. Wird der
Durchschnitt über alle Erwachsene herangezogen, scheint der wöchentliche
Zeitaufwand von 52 Minuten eher gering. Wenn aber tatsächlich ein
Ehrenamt ausgeübt wird, so nimmt diese Aufgabe mit gut 4 Ÿ Stunden pro
Woche bei der ausübenden Person einen erheblichen Teil der freien Zeit
ein. Am stärksten ist das Engagement bei den Alleinlebenden.
In welcher Weise sich Männer und Frauen die Kinderbetreuung teilen,
hängt nicht nur von Traditionen und persönlichen Neigungen, sondern auch
stark von der Erwerbstätigkeit des Partners ab. Erwerbstätige Frauen mit
Kindern unter 6 Jahren wenden für die Betreuung ihres Nachwuchses mit 2
Œ Stunden doppelt so viel Zeit auf wie erwerbstätige Männer, nicht
erwerbstätige Frauen mit 3 Œ Stunden sogar etwa das Dreifache.
Mit
steigendem Alter der Kinder reduziert sich die Betreuungszeit spürbar.
Bei Paaren, deren jüngstes Kind zwischen 6 und 18 Jahren alt ist, macht
sie weniger als ein Drittel der Zeit aus, die Eltern mit Kindern unter 6
Jahren aufwenden. Dabei verändert sich die Verteilung der zeitlichen
Belastung auf Mütter und Väter kaum.
Viele Haushalte erhalten Hilfe von Verwandten, Nachbarn oder Freunden,
sei es bei Haushaltstätigkeiten oder der Betreuung der Kinder, beim
Bauen oder Reparieren. Nicht immer handelt es sich um praktische
Hilfestellungen. Manchmal kann ein Gespräch mit Freunden ein ebenso
wichtiger Beistand sein. 56 % aller Alleinerziehenden- und 46 % aller
Paarhaushalte mit minderjährigen Kindern sind im Alltag auf
Unterstützung angewiesen.
Das Lernen gehört zu den wichtigsten Aktivitäten überhaupt. Vieles
lernen wir von unseren Eltern, anderes in Schule oder Hochschule, am
Arbeitsplatz, auf Kursveranstaltungen, durch Beobachten und Ausprobieren
oder auch durch Selbststudium.
Bildung und Lernen wird jedoch gemeinhin
mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Verbindung gebracht.
Allerdings machen die sich immer schneller wandelnden Anforderungen in
Beruf und Gesellschaft ein kontinuierliches Lernen durch verstärkte
Weiterbildung erforderlich.
Doch wie viel Zeit nimmt eigentlich das
Lernen in verschiedenen Lebensabschnitten in Anspruch?
Für den Besuch von Schule und Hochschule, die berufliche Fortbildung
während und außerhalb der Arbeitszeit und die allgemeine Weiterbildung
bringen Personen im Alter ab 10 Jahren durchschnittlich eine knappe
Dreiviertelstunde pro Tag auf. Frauen geringfügiger als Männer.
Die
Jugendlichen lernen deutlich länger. So wenden die 10- bis 18jährigen
einschließlich Hausaufgaben und Selbststudium durchschnittlich etwa 3 œ
Stunden täglich für das Lernen auf. Während bei den 18- bis 25jährigen
noch 1 œ auf Lernaktivitäten entfallen, ist es in der Gruppe der 25- bis
45jährigen lediglich noch eine gute Viertelstunde. Personen über 45
Jahren sind durchschnittlich nur wenige Minuten täglich mit Bildung und
Lernen beschäftigt. Mädchen und junge Frauen bis zum Alter von 25 Jahren
beteiligen sich insgesamt etwas mehr an Lernaktivitäten als Männer,
ältere Frauen etwas weniger oder gleich lang.
In unserer schnelllebigen Zeit werden berufliche und allgemeine
Weiterbildung immer wichtiger. Dennoch finden bei allen Personen ab 10
Jahren gut 85 % aller Bildungs- und Lernaktivitäten im Rahmen von Schule
bzw. Hochschule statt. Berufliche Weiterbildungsaktivitäten innerhalb
und außerhalb der Arbeitszeit haben mit knapp 4 % bzw. gut 3 % zusammen
ein ähnliches Gewicht wie die allgemeine Weiterbildung (7,5 %).
Welche Bedeutung hat der formale Bildungsabschluss für die Beteiligung
an beruflicher und allgemeiner Weiterbildung? Bei Personen, die bereits
über einen Abschluss einer Wissenschaftlichen Hochschule (insbesondere
Hochschule) verfügen, steht mit gut 86 % das selbst organisierte Lernen,
etwa durch selbst organisierte Gruppen oder das Selbstlernen mit Büchern,
dem Computer o. ä., eindeutig im Vordergrund. Unter jenen, die eine
berufliche Lehre absolvieren, beträgt dieser Anteil gut zwei Drittel.
Den Feierabend als freie Zeit nach der Erwerbsarbeit gibt es sicherlich
nicht so uneingeschränkt. Zwar endet für viele die Erwerbsarbeit schon
ab 16 Uhr. Das bedeutet aber nicht, dass danach nicht mehr gearbeitet
wird. Gerade in der Zeit 16 bis 20 Uhr wird eine ganze Menge für den
Haushalt getan.
Trifft die Vorstellung zu, dass nicht erwerbstätige
Menschen - jung oder alt - freie Zeit im Übermaß haben?
An einem durchschnittlichen Wochentag haben Jugendliche zwischen 10 und
14 Jahren tatsächlich viel Zeit für Mediennutzung, ihr soziales Leben,
Hobbys und Sport. Von Montag bis Freitag beanspruchen diese Aktivitäten
durchschnittlich 6 Stunden am Tag: 5 Stunden bei Mädchen und 6 bei
Jungen. Schule und Hausaufgaben nehmen bei den Jungen und Mädchen
durchschnittlich gute 5 Stunden ein. Bei den unbezahlten Arbeiten im
Haushalt helfen Mädchen mit gut 1 Stunden bereits mehr mit als Jungen
mit etwa einer Stunde.
Mit steigendem Alter nimmt der Anteil derer zu, die erwerbstätig sind.
So befinden sich von den Jugendlichen bzw. Erwachsenen zwischen 15 und
20 Jahren viele in einer beruflichen Ausbildung. Dies spiegelt sich an
den Wochentagen in 1 Stunden Erwerbsarbeit bei den jungen Frauen und gut
2 Stunden bei den jungen Männern wider.